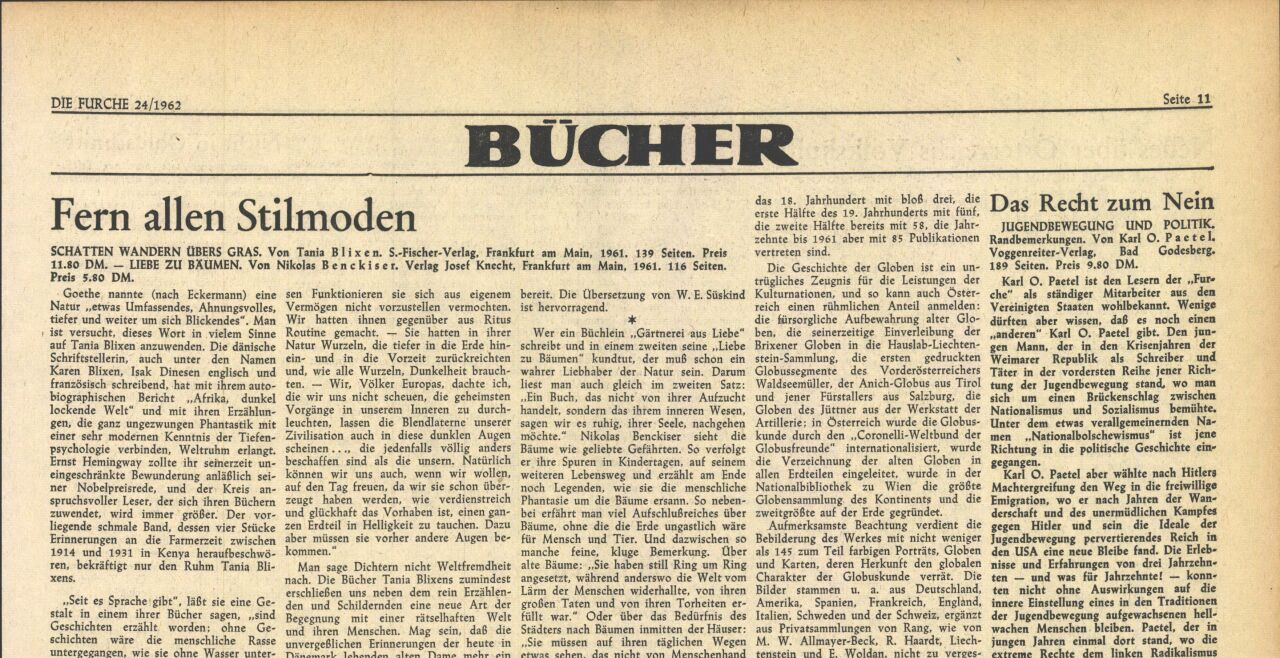
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fern allen Stilmoden
Goethe nannte (nach Eckermann) eine Natur „etwas Umfassendes, Ahnungsvolles, tiefer und weiter um sich Blickendes“. Man ist versucht, dieses Wort in vielem Sinne auf Tania Blixen anzuwenden. Die dänische Schriftstellerin, auch unter den Namen Karen Blixen, Isak Dinesen englisch und französisch schreibend, hat mit ihrem autobiographischen Bericht „Afrika, dunkel lockende Welt“ und mit ihren Erzählungen, die ganz ungezwungen Phantastik mit einer sehr modernen Kenntnis der Tiefenpsychologie verbinden, Weltruhm erlangt. Ernst Hemingway zollte ihr seinerzeit uneingeschränkte Bewunderung anläßlich seiner Nobelpreisrede, und der Kreis anspruchsvoller Leser, der sich ihren Büchern zuwendet, wird immer größer. Der vorliegende schmale Band, dessen vier Stücke Erinnerungen an die Farmerzeit zwischen 1914 und 1931 in Kenya heraufbeschwören, bekräftigt nur den Ruhm Tania Blixen s.
„Seit es Sprache gibt“, läßt sie eine Gestalt in einem ihrer Bücher sagen, „sind Geschichten erzählt worden; ohne Geschichten wäre die menschliche Rasse untergegangen, wie sie ohne Wasser untergegangen wäre.“ Genauso, aus einem spontanen Verhältnis zu allem Lebendigen, erzählt Tania Blixen, fern allen Stilmoden und Richtungen, souverän das Wort beherrschend, klar Gestalten und Dinge beschreibend, die wache Intelligenz durch einen für eine Frau seltenen Humor durchwirkt. Hinter jedem Satz wird eine Persönlichkeit spürbar, die aus großer Welt-und Lebenserfahrung sich nachsichtig und gütig zu jedem Geschöpf verhält, aber bei aller Einfühlungsgabe jene Distanz wahrt, die von vorneherein alles Sentimentale und Überflüssige fernhält und so eine makellose Form schaffen hilft — in der Kunst der Prosa wie im menschlichen Zusammenleben.
Tania Blixen muß eine wunderbare Herrin gewesen sein auf ihrer Kaffeeplantage im ostafrikanischen Hochland, dieser „wahren Heimat ihres Herzens“. Es war das natürliche Verhältnis zwischen Herr und Diener ohne Überheblichkeit und Anmaßung, erfüllt von angeborener Würde und echter Verantwortung — etwas. Was unsere Zeit kaum mehr kennt. Gleich in der ersten Skizze gedenkt sie eingehend ihres damaligen Dieners und schreibt: „Ich werde das Kapitel über Farah ganz anspruchslos nennen .Bildnis eines Herrn'.“ Das ist durchaus nicht ironisch gemeint, denn dieser selbstbewußte und äußerst intelligente Mohammedaner aus dem Somaliland, der selbstherrlich ihren Haushalt führte und, prächtig gekleidet, stets einige Respektschritte hinter seiner gar nicht damemäßig gekleideten Herrin ein-herschritt, war für sie wirklich ein Herr — weil er sich selber ernst nahm. So entsteht ein ungemein anschauliches und fesselndes Charakterbildnis des Afrikaners, aber zugleich — über alles Persönliche und Private weit hinausreichend — ein Bild Afrikas. Eingeschaltete Überlegungen beleuchten scharf die Kluft zwischen der unverrückbaren Elementarordnung des Lebens, der die farbigen Völker anhängen, und den ihnen vermittelten Gesellschaftsformen, die von Weißen erdacht worden sind. In „Farah“ heißt es an einer Stelle: „Die protestantischen Missionsstationen wandten viel Zeit, Energie und Geld an das Vorhaben, die Eingeborenen an das Tragen von Hosen zu gewöhnen — in denen sie aussahen wie Giraffen im Harnisch. Die französischen Missionspriester verstanden sich besser mit den Kindern des Landes; aber auch sie hatten nicht — wie es eigentlich hätte sein sollen — den heiligen Franz von Assisi auf ihrer Station, sondern waren selber nur schwache Seelen und hatten zu Hause eine schwer gemischte Kulturlast aufgepackt bekommen, die sie nicht abzuwerfen wagten. Die Geschäftsleute, nach dem Motto: ,Und lehrt die Eingeborenen, was Bedarf heißt', schärften den Afrikanern ein, sich nach dem Maßstab des Besitzers einzuschätzen und im Lebensstandard auf ehrbare Weise nach dem Nachbarn zu richten. Die Regierung schließlich, indem sie die weiten wilden Steppen in Großwildreservate verwandelte, legte es mit Erfolg darauf an, auch noch den Löwen das Gehabe freundlicher Familienväter aufzunötigen.“
In der ergreifenden Geschichte „Die große Geste“ erzählt Tania Blixen, wie sie einmal in Tränen der Empörung über die Undankbarkeit eines kleinen verwundeten Afrikaners ausbrach, und wie am anderen Morgen die Eingeborenen scharenweise zu ihr kamen, um auf ihre Weise, durch eine seltsam „große Geste“ wortlos die Kränkung wieder gutzumachen. In dieser Erzählung stellt sie Erwägungen über die Afrikaner an, die Schmerzen und Tod weniger fürchten als die Weißen tun, weil das Leben sie die Unbeständigkeit aller Dinge gelehrt hat. „Sie bekamen unsere Kultur kleingehackt verabreicht, als unzusammenhängende Teilchen eines Mechanismus, den sie nie hatten funktionieren sehen und dessen Funktionieren sie sich aus eigenem Vermögen nicht vorzustellen vermochten. Wir hatten ihnen gegenüber aus Ritus Routine gemacht. — Sie hatten in ihrer Natur Wurzeln, die tiefer in die Erde hinein- und in die Vorzeit zurückreichten und, wie alle Wurzeln, Dunkelheit brauchten. — Wir, Völker Europas, dachte ich, die wir uns nicht scheuen, die geheimsten Vorgänge in unserem Inneren zu durchleuchten, lassen die Blendlaterne unserer Zivilisation auch in diese dunklen Augen scheinen ..., die jedenfalls völlig anders beschaffen sind als die unsern. Natürlich können wir uns auch, wenn wir wollen, auf den Tag freuen, da wir sie schon überzeugt haben werden, wie verdienstreich und glückhaft das Vorhaben ist, einen ganzen Erdteil in Helligkeit zu tauchen. Dazu aber müssen sie vorher andere Augen bekommen.“
Man sage Dichtern nicht Weltfremdheit nach. Die Bücher Tania Blixens zumindest erschließen uns neben dem rein Erzählenden und Schildernden eine neue Art der Begegnung mit einer rätselhaften Welt und ihren Menschen. Mag sein, daß die unvergeßlichen Erinnerungen der heute in Dänemark lebenden alten Dame mehr ein Afrika von gestern erstehen lassen — ein Kenya zum Beispiel, in dem es noch keine barbarische Mau-Mau-Bewegung und deren Terror und keine 250.000 Arbeitslose gab — ihre Tiefblicke aber dringen auch in das völlig ungewisse Morgen vor. Tania Blixen hielte wohl einige Schlüssel zur Bewältigung so mancher Schwierigkeiten und Ratlosigkeiten in dem dunklen Kontinent bereit. Die Übersetzung von W. E. Süskind ist hervorragend.
Wer ein Büchlein „Gärtnerei aus Liebe“ schreibt und in einem zweiten seine „Liebe zu Bäumen“ kundtut, der muß schon ein wahrer Liebhaber der Natur sein. Darum liest man auch gleich im zweiten Satz: „Ein Buch, das nicht von ihrer Aufzucht handelt, sondern das ihrem inneren Wesen, sagen wir es ruhig, ihrer Seele, nachgehen möchte.“ Nikolas Benckiser sieht die Bäume wie geliebte Gefährten. So verfolgt er ihre Spuren in Kindertagen, auf seinem weiteren Lebensweg und erzählt am Ende noch Legenden, wie sie die menschliche Phantasie um die Bäume ersann. So nebenbei erfährt man viel Aufschlußreiches über Bäume, ohne die die Erde ungastlich wäre für Mensch und Tier. Und dazwischen so manche feine, kluge Bemerkung. Über alte Bäume: „Sie haben still Ring um Ring angesetzt, während anderswo die Welt vom Lärm der Menschen widerhallte, von ihren großen Taten und von ihren Torheiten erfüllt war.“ Oder über das Bedürfnis des Städters nach Bäumen inmitten der Häuser: „Sie müssen auf ihren täglichen Wegen etwas sehen, das nicht von Menschenhand geschaffen ist, etwas, was die Willkür freien Wachstums zeigt statt der rationalen Linie der Nützlichkeit.“ Nikolas Benckiser schreibt im Hauptberuf Leitartikel in einer der führenden Tageszeitungen der Bundesrepublik Deutschland. Seine gelassene Art und sein sicheres Urteil entspringen nicht zuletzt der Freude am allmählich Wachsenden und Reifenden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































