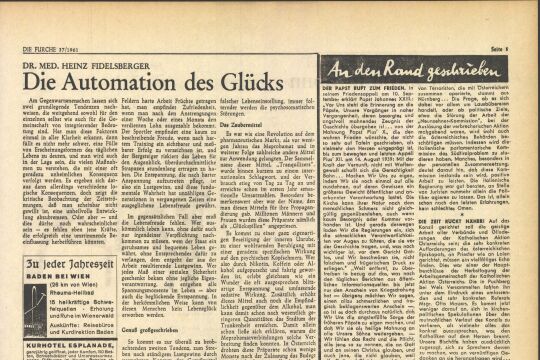Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Kampf nähergekommen
Der jüngste Staat Afrikas ist in Europa weitgehend unbekannt. Ein Lokalaugenschein fördert eine Gesellschaft im Umbruch zutage, in der die Religionen (noch?) nicht aufeinanderprallen. Das Lächeln der Eritreer ist eines der Gesichter des Landes; andere sind sorgenvoll: die politische Zukunft ist ungewiß.
Der jüngste Staat Afrikas ist in Europa weitgehend unbekannt. Ein Lokalaugenschein fördert eine Gesellschaft im Umbruch zutage, in der die Religionen (noch?) nicht aufeinanderprallen. Das Lächeln der Eritreer ist eines der Gesichter des Landes; andere sind sorgenvoll: die politische Zukunft ist ungewiß.
Das Rote Meer ist blau. Man muß es kennen, sagen die Einheimischen, um zu verstehen, warum die Äthioper das kleine Eritrea mit seiner kargen, gebirgigen I .andschaft für sich beanspruchten. Es ist ihnen allerdings nicht gut bekommen. Heute steht der prunkvolle Palast des äthiopischen Kaisers Haile Se-lassie in der Hafenstadt Massawa genauso da, wie ihn der Krieg hinterlassen hat: mit eingestürzten Freitreppen und riesigen Einschußkratern im Mauerwerk. In der aufgerissenen Kuppel nisten Vögel. Niemand hat Interesse, das verhaßte Herrschaftssymbol wiederherzustellen.
„Erythra thalassa” nannten die Griechen das Rote Meer. Von dort leitet sich der Name „Eritrea” ab, den die Italiener für ihre Kolonie verwendeten. Nach 1945 wurde das Land bri -tisches Mandatsgebiet, bevor es 1952 per Völkerratsbeschluß innerhalb einer Föderation mit Äthiopien für autonom erklärt wurde. Kaiser Haile Se-lassie scherte sich freilich kein bißchen um die Abmachungen, annektierte das Land und unterzog es einer gezielten Anpassungsstrategie. Amharisch wurde als neue Amtssprache eingeführt, die eritreische Fahne eingezogen. Ab 1961 sprachen die Waffen - 30 Jahre lang. Die Weltmächte mißverstanden den Krieg einerseits als inneräthiopische Auseinandersetzung und hielten ihn andererseits in bewährter Manier als sowjetisch-amerikanischen Stellvertreterkrieg am Kochen. 1991 erloschen die Kämpfe; das Land war an die eritrei-schen Patrioten gefallen. Seit 1993 ist Eritrea unabhängig und wird nicht müde, die Segnungen des teuer erkämpften Status zu preisen: das neue, das freie, das unabhängige Eritrea als stete Erinnerung daran, wie unerfüllbar der Traum einmal schien.
Lächeln der Eritreer
Es dürfte kaum eine Familie geben, die kein Kriegsopfer zu beklagen hätte. Überall im Land sind Patrioten -friedhöfe angelegt. Invalide humpeln an jeder Ecke. Kriegswitwen, die vor Jahren ihren Männern mutig ins Kampfgebiet gefolgt sind, stehen jetzt ohne Hilfe da. Der Staat kann es sich nicht leisten, sie zu unterstützen. Umso mehr überrascht der erste Eindruck: Es ist ein freundliches Land. Die Menschen sind offen, gehen auf Fremde zu, lächeln viel und reden gerne. Die Hauptstadt Asmara, im Zentrum ganz italienisch, ist eine saubere und sichere Stadt. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß es an allen Ecken und Enden fehlt: Gegen die drückende Armut ist bisher kein Kraut gewachsen. Über 80 Prozent der Bevölkerung können nicht lesen, aber bei den I lungerlöhnen, die man Lehrern zugesteht, ist es kein Wunder, wenn die Lehrerbildungsanstalten leer bleiben. Wirtschaft, Gesundheitswesen, Medien, Fremdenverkehr: Überall fehlen geschulte Kräfte. Ihre Plätze nehmen hoch motivierte, aber ebenso schlecht bezahlte wie ausgebildete ehemalige Kämpfer ein. Einer von ihnen, Chefredakteur Yitbarek von der in der Landessprache Tigrinya erscheinenden Zeitung „Hadas Eritrea” („Neues Eritrea”) gibt es unumwunden zu: „Wir fangen auf jedem Gebiet bei Null an”.
Christen und Muslime
Die Euphorie der Unabhängigkeit muß ihre ganze Integrationskraft entfalten. Denn nicht nur ethnisch, auch religiös ist das eritreische Volk alles andere als einheitlich. Christen und Muslime halten sich in etwa die Waage. Katholiken und Protestanten bilden kleine Minderheiten; die eritreisch-orthodoxe ist die größte Kirche des Landes. Sie hat sich nach der Unabhängigkeit von der äthiopisch-orthodoxen Kirche losgesagt. Glaubt man den offiziellen Stimmen, so gibt es zwischen Christen und Muslimen keinerlei Konflikte. „In religiösen Dingen sind Christen und Muslime zwar getrennt”, sagt Abuna Jacob, der Vize-Vorsitzende des orthodoxen Heiligen Synods, „aber im gemeinsamen Kampf sind sie einander nähergekommen, sodaß sie heute in Frieden leben können”. Der Mufti von Asma-ra, Sheikh Al-Amin Osman, bekräftigt diese Sicht der Dinge: „Die Religion darf die Menschen nicht auseinanderbringen. Sie verlangt Frieden und Einheit”, sagt er.
Viele Eritreer besuchen Feierlichkeiten der jeweils anderen Religion. Es gibt zahlreiche Mischehen, und man genießt es, daß die hohen Feiertage beider Glaubensbekenntnisse staatlich geboten und damit für alle frei sind. Einen offiziellen Dialog der Religionen hält man da gar nicht für notwendig, solange das Zusammenleben reibungslos klappt.
Aber ganz ungetrübt ist die Wonne denn doch nicht. Aus dem benachbarten Ausland (vor allem dem Sudan) drängen fundamentalistische Gruppen nach Eritrea und stiften zunehmend Unruhe. Bisweilen kommt es sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Begierungstruppen und Moslemrebellen. Und die auf den ersten Blick völlig sinnlose Ermordung einer belgischen Touristengruppe im März dieses Jahres spricht eine deutliche Sprache: Wir sind da. Dementsprechend wächst die Beunruhigung im christlichen Teil der Bevölkerung. „Insgeheim wollen sie ja doch nichts anderes als einen islamischen Staat”, vermutet ein orthodoxer Journalist und unterscheidet gar nicht mehr extra zwischen „guten” und „fundamentalistischen” Moslems. Aber auch auf moslemischer Seite argwöhnen manche, die Christen seien darauf versessen, den gemeinsamen Staat zu dominieren.
Die Regierung versucht, mögliche Religionskonflikte im Keim zu ersticken. Mit dem Hinweis auf die Trennung von Religion und Staat ist sie bestrebt, die Religionsgemeinschaften auf rein religiöse Tätigkeiten festzulegen und sie von politischer Aktion fernzuhalten. Im Innenministerium gibt es ein eigenes Religionsreferat. Zudem ist die Gründung jeder religiösen Partei verboten.
Politik des Prestiges
Was auf der einen Seite mit Rücksicht auf die notwendige Einheit des jungen Staates durchaus plausibel erscheint, weist andererseits ziemlich bedenkliche Aspekte auf. Die Regierungspartei PFDJ (Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit) unter Staatspräsident Issaias Afewerki macht keine Anstalten, die Macht teilen zu wollen. Obwohl die dieser Tage verabschiedete Verfassung Eritrea als Mehrparteiendemokratie bezeichnet, zweifelt niemand, daß die PFDJ bis auf weiteres regieren wird - und zwar alleine. Chefredakteur Yitbarek beruhigt in diesem Punkt: „Parteien kann man nicht machen, sie müssen entstehen”, sagt er. Genau das aber wird der Präsident zu verhindern wissen, halten kritische Geister - und solche gibt es immer mehr - dagegen.
Ein katholischer Lehrer, der sich aus Sicherheitsgründen nur Pietros Yohannes nennt, sagt es unverblümt: Hinter der demokratischen Maske des Regimes verberge sich schlicht eine Einparteiendiktatur, die jetzt langsam ihr Gesicht zeige. Was Pietros der Regierung vorwirft, ist eine „Prestige-Politik”: Da werden teure Häuser gebaut, die sich niemand leisten kann. Da hält man die Hauptstadt sicher, indem man Bettler von der Straße weg verhaftet und in einem alten Krankenhaus interniert. Da werden hunderte Familien aus ihren armseligen Quartieren vertrieben - ohne zu wissen, wohin. Da gehen die Gefängnisse über, weil in einer sogenannten „Kampagne gegen die Korruption” unliebsame Oppositionelle aus dem Verkehr gezogen werden.
Der Kritik entzieht sich die Begie-rung durch Gleichschaltung der Presse. Zeitungen, Radio und Fernsehen werden vom Informationsministerium nicht nur kontrolliert, sondern gleich selbst produziert. Ob es aufgrund der neuen Verfassung Pressefreiheit geben wird? „Ich hoffe es und bete dafür”, sagt Chefredakteur Yitbarek, ein Angestellter des Informationsministeriums.
Schimmern da also durch das weiße Unschuldskleid des jungen Staates die alten, häßlichen Umrisse der Diktatur? - Zugegeben, Eritrea befindet sich in einem schwierigen Übergang. Jetzt erst wird die Verfassung verabschiedet, jetzt erst wird es Wahlen geben. Die weitere Entwicklung steht noch aus. Wenigstens in einem Punkt herrscht Konsens: Die schlimmste eritreische ist immer noch besser als die beste äthiopische Regierung. Das Land braucht Hoffnung wie einen Bissen Brot.
Das Bote Meer ist blau. Vielleicht hat Eritrea eine Chance, den Verir-rungen der Macht zu entkommen. Sonst wäre Afrika um eine große Hoffnung ärmer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!