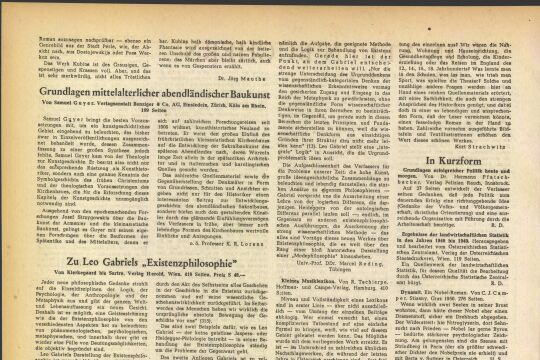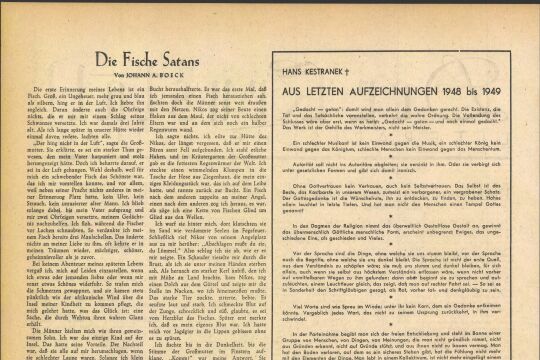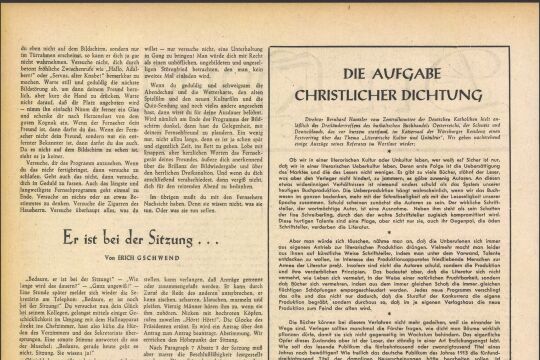Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kleiner Mann und großer Philosoph
Der junge Angestellte einer Seifenfirma entwarf einen Werbetext. Br schrieb:
.Das Alkali-Element und die Fette sind in diesem Produkt so gemischt, daß sie die höchste Qualität von Seifung mit einer solchen spezifischen Schwere verbinden, daß diese Seife sich auch auf der Wasserober- • fläche hält und der Badende sich nicht der Mühe zu unterziehen braucht, auf dem Boden der Badewanne danach zu fischen.“ , Der Chef der Werbeabteilung strich den wohlüberlegten Satz durch und sagte das gleiche mit den Worten: „Sie schwimmt. Es mag blasphemiscji wirken, wenn neben diese hausschlachtene Anekdote der ausdrucksvolle Satz eines Philosophen unserer Tage gesetzt wird:
„Die Absolutheit des Absoluten, die absolvent sich absolvierende Absolution, ist die Arbeit des Sidibegreifens der unbedingten Selbetbewußt’heit.“
Es ist unwichtig, zu sagen, daß dieser Satz von Heidegger stammt, wichtig ist vielmehr, zu erkennen, daß die Blasphemie, den Satz des kleinen Seifenwerbers neben den des großen Philosophen Zu stellen, gar nicht so ungeheuerlich war. Den Seifenhymnus kann man auf zwei faßliche Wörter reduzieren, bei dem Satz des Philosophen mit seiner barocken Umständlichkeit 1st das so sicher nicht.
Mit beiden Beispielen soll nur auf die immer unerfreulicher weidende Aufschwemmung der deutschen Sprache hingewiesen werden. Wenn die Philosophen und philosophierenden Poeten, die doch zu Menschen reden wollen und sollen, sich im Manierismus verlieren, wie soll man dann von der Alltagssprache Natürlichkeit verlangen? In einer Auseinandersetzung mit dem Heidegger-Deutsch schreibt ein Philosophiekollege Heideggers, Karl Löwith:
„Was den einen in Heideggers Sprache als fesselnder Tiefsinn berührt, wird darum einen änderen wie ein Spiel mit Worten anmuten, und dies um so mehr, als die wahrhaft gefundenen und die bloß erfunden Worte mit dem gleichen tödlichen Ernst formuliert werden.“
Löwith hat recht, nur steckt mehr als Spielerei dahinter, nämlich Angst, Unsicherheit, Mißtrauen gegenüber einer schon unverbindlich gewordenen, nach allen Regeln der Kunst ausgeglühten und ausgekälteten Sprache. Das ist die eigentliche (Nerven-) Krankheit unserer Spräche. Unsere Worte haben Gewicht und Münzwert eingebüßt, die Sprache ist nicht mehr zuverlässig. Zuverlässigkeit endet, wo das Vieldeutige, überhaupt das Deutbare beginnt. Wenn Goethe „merkwürdig schrieb, meinte er wirklich, etwas sei würdig, gemerkt zu werden, wenn wir „merkwürdig“ sagen, denken wir uns gewöhnlich wenig dabei. Unsere Gehirne sind vollgepfropft mit Ausdrücken, wie „Gebiet , „Wesen“, „Ebene“, „Anliegen , „Vorhaben , „Belange“ und anderen Abstraktionen. Wer sagt heute noch „Sein oder Nichtsein“? Man sagt: Die Angelegenheit der Existenz, unter dem Blickpunkt einer zu erwägenden Frage betrachtet.“ Das Undeutliche hinterläßt freilich immer einen benommenen “Kopf.
Woher kann Hilfe kommen? Von Akademien? Deren Mittel sind eng und eben — akademisch. Aus der Alltagssprache? Die ist selbst nicht gesund und lebenskräftig. Die gerühmte „Alltagssprache“ mancher neuerer Schriftsteller, vor allem der Amerikaner, ist eine künstliche, eine synthetische Sache. Spradie lebt und muß sich entwickeln. Aber nicht in Ideentreibhäusern und Gehirnretorten. Die Sprache, mag man sie unser Herz oder unsere ITaut nennen, gedeiht nur in frischer Luft. Papierdeutsch hat es immer gegeben — kaum jemals mehr als zu Goethes Zeit! —, aber übel ist es bestellt, wenn Phrasen und Floskeln, Mißbildungen der Amtssprache und berufssprachliche Unarten die Keimkraft der Sprache ersticken.
Es ist kaum anzunehmen, daß unsere Philosophen mehr zu sagen haben, als unsere Sprache ausdrücken kann, sie tun aber so. Wenn sie ehrlicher wären und weniger eitel, würden sie deutsch reden und schreiben. Und unsere Schriftsteller auch. Auch sie sollten wissen, daß man eine Spradie erlernen muß, sogar die eigene. Ja, die erst recht. Mag jeder beginnen, das Wort wieder zu wägen, haushälterisch damit zu sein und nichts zu vergeuden und zu verdeuteln. Das Bündige allein ist bindend. Anton Tschechow meinte, Prosa müsse sein „wie das Deck e:nes Kriegsschiffes; nichts überflüssiges“! Und Nietzsche: „An einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten!“ Tucholsky schrieb freilich skeptisch dahinter: „So siehst du aus!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!