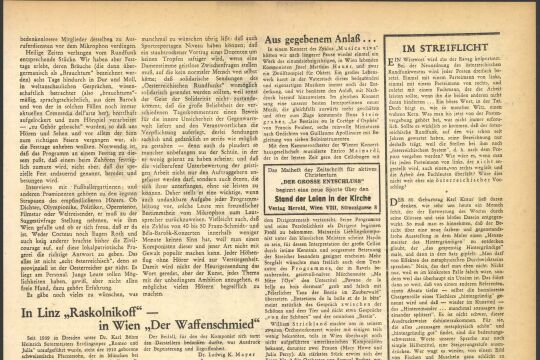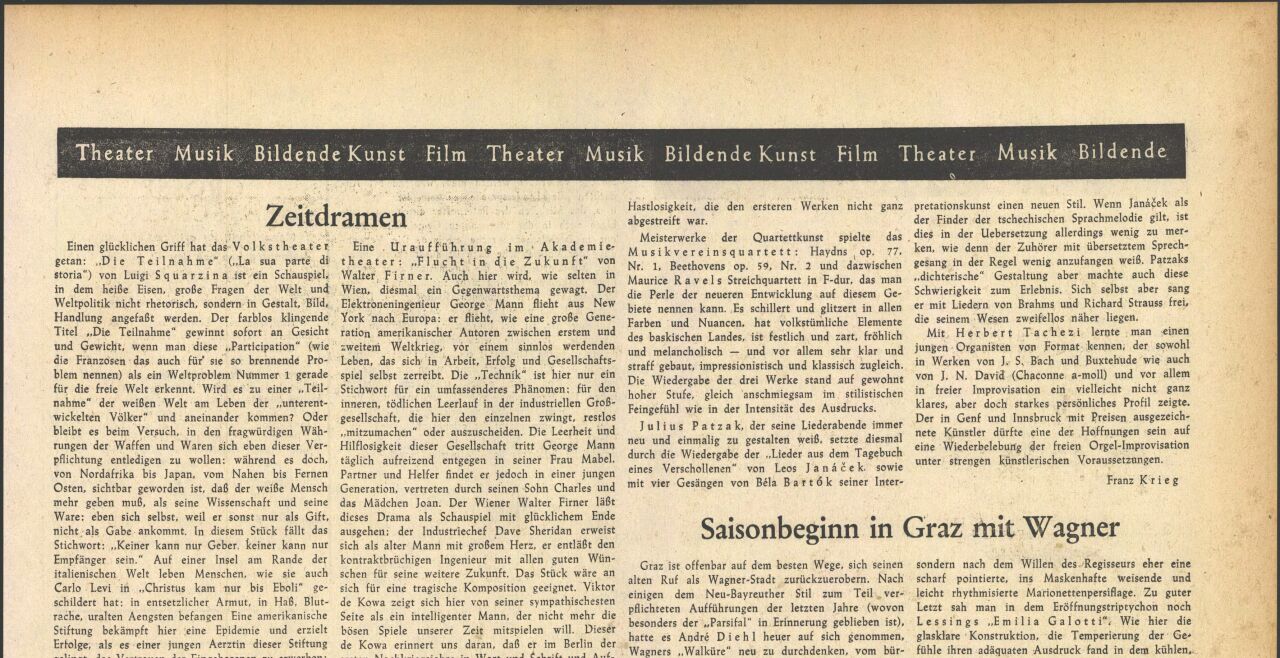
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zeitdramen
Einen glücklichen Griff hat das V o 1 k s t h e a t e r getan: „D i e Teilnahme“ („La sua parte di storia“) von Luigi S q u a r z i n a ist ein Schauspiel, in dem heiße Eisen, große Fragen der Welt und Weltpolitik nicht rhetorisch, sondern in Gestalt, Bild, Handlung angefaßt werden. Der farblos klingende Titel „Die Teilnahme“ gewinnt sofort an Gesicht und Gewicht, wenn man diese „Participation“ (wie die Franzosen das auch für“ sie so brennende Problem nennen) als ein Weltproblem Nummer 1 gerade für die freie Welt erkennt. Wird es zu einer „Teilnahme“ der weißen Welt am Leben der „unterentwickelten Völker“ und aneinander kommen? Oder bleibt es beim Versuch, in den fragwürdigen Währungen der Waffen und Waren sich eben dieser Verpflichtung entledigen zu wollen: während es doch, von Nordafrika bis Japan, vom Nahen bis Fernen Osten, sichtbar geworden ist, daß der weiße Mensch mehr geben muß, als seine Wissenschaft und seine Ware: eben sich selbst, weil er sonst nur als Gift, nicht als Gabe ankommt. In diesem Stück fällt das Stichwort: „Keiner kann nur Geber, keiner kann nur Empfänger sein.“ Auf einer Insel am Rande der italienischen Welt leben Menschen, wie sie auch Carlo Levi in „Christus kam nur bis Eboli“ geschildert hat: in entsetzlicher Armut, in Haß, Blutrache, uralten Aengsten befangen Eine amerikanische Stiftung bekämpft hier eine Epidemie und erzielt Erfolge, als es einer jungen Aerztin dieser Stiftung gelingt, das Vertrauen der Eingeborenen zu erwerben: durch participation, durch „Teilnahme“. Diese aber bringt die junge Frau in schwere Konflikte mit ihrer Stiftung, da diese aus vielen Gründen dieses existentielle Engagement ablehnen muß, nicht nur hier, wo es mit zur Verflechtung in einen Rachestreit der Einheimischen führt. Die Repräsentantin der Stiftung und der leitende Arzt (Elisabeth Epp und Hannes Schiel) kämpfen mit allen Mitteln, um ihre junge, tapfere Kollegin (Lotte Ledl) aus dieser inneren Bindung zu lösen. — Das Stück endet innerlich ganz offen; das zu sehen ist wichtig, denn das Ende des letzten Aktes ist keine „Lösung“ dieser heute noch kaum lösbaren Probleme.
Die Besetzung der Rollen vermag diesen meist nicht die mögliche Leuchtkraft zu geben. Am stärksten wirkt Heinrich Trimbur als allesverstehender Dorfarchivar, Bote zwischen den zwei Welten, dann Ludwig Blaha als aufrechter Dorfarzt, eine Tragödie für sich, und sein Gegenspieler, der korrupte Sanitätschef der Insel, Viktor Gschmeidler. Sehr treffend das Bühnenbild von Christof Heyduck, bemüht die Regie Gerd Omar LeutnerS.
Eine . Uraufführung im/ Akademietheater: „FlucTitin die Zukunft“ von Walter, Firner. Auch hier wird, wie selten in Wien, diesmal: ein Gegenwartsthema gewagt. Der Elektrbneningenieur George Mann flieht aus New York nach Europa: er flieht, wie eine große Generation amerikanischer Autoren zwischen erstem und zweitem Weltkrieg, yör einem sinnlos werdenden Leben, das sich in Arbeit, Erfolg und Gesellschaftsspiel selbst zerreibt. Die „Technik“ ist hier nur ein Stichwort für ein umfassenderes Phänomen: für den inneren, tödlichen Leerlauf in der industriellen Großgesellschaft, die hier den einzelnen zwingt, restlos „mitzumachen“ oder auszuscheiden. Die Leerheit und Hilflosigkeit dieser Gesellschaft tritt George Mann täglich aufreizend entgegen in seiner Frau Mabel. Partner und Helfer findet er jedoch in einer jungen Generation, vertreten durch seinen Sohn Charles und das Mädchen Joan. Der Wiener Walter Firner läßt dieses Drama als Schauspiel mit glücklichem Ende ausgehen; der Industriechef Dave Sheridan erweist sich als alter Mann mit großem Herz, er entläßt den kontraktbrüchigen Ingenieur mit allen guten Wünschen für seine weitere Zukunft. Das Stück wäre an sich für eine tragische Komposition geeignet. Viktor de Kowa zeigt sich hier von seiner sympathischesten Seite als ein intelligenter Mann, der nicht mehr die bösen Spiele unserer Zeit mitspielen will. Dieser de Kowa erinnert uns daran, daß er im Berlin der ersten Nachkriegsjahre in Wort und Schrift und Auftreten einen auch bei Schauspielern nicht gewöhnlichen politischen Mut, aus der Reihe zu tanzen, besaß. Martha Marbo macht als seine Frau Mabel diese unselige, in sich und den Konventionen ihrer geschlossenen Gesellschaft verlorene Dame glaubwürdig, ohne in die naheliegende Versuchung, zu übertreiben, zu verfallen. Von den „Jungen“ ist vor allem der Sohn Manns, Charles, hier Ernst Anders, als sympathische Begabung zu erwähnen. Inge Brücklmeier hat sich eine statische Maske für Mädchen dieses Genres festgelegt, die nur annehmbar wirkt, wenn sie nicht zu oft hintereinander getragen wird. Sehr treffend, als Zeitstudien, denen man in der Bundesrepublik Deutschland Tag für Tag begegnet, Norbert Ecker als erfolgreicher Kaufmann Hans Lüders, und Hans Obonya als Rechtsanwalt Copland. Heinz Moog gibt den edlen Chef Sheridan, Lilly Caroly die Neger-Mami Carol, mit entsprechender Würde. — Ein Abend, der nicht so verloren erscheint wie so manche Abende zuvor im Akademietheater.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!