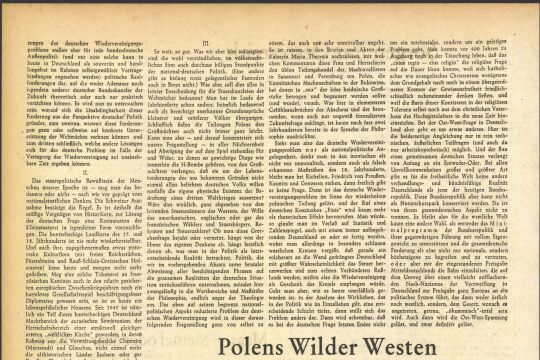Der Friede wird ermordet
Teheran hat einen Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbeidschan vermittelt Doch 4er Kampf um Berg-Karabach geht weiter. Während der Friedensgespräche wurde um Schu-scha gekämpft. Vor kurzem besuchte KIPA-Redakteurin Brigitte Muth-Oelschner das Kriegsgebiet.
Teheran hat einen Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbeidschan vermittelt Doch 4er Kampf um Berg-Karabach geht weiter. Während der Friedensgespräche wurde um Schu-scha gekämpft. Vor kurzem besuchte KIPA-Redakteurin Brigitte Muth-Oelschner das Kriegsgebiet.
Seit drei Jahren gibt es in der armenischen Enklave Nagorny Karabach, rings umgeben von Aserbeidschan, immer wieder blutige Auseinandersetzungen. Zur Zeit der Sowjetunion wurde das Land als autonomes Gebiet in Aserbeidschan von Moskau respektiert. Aserbeidschan widersetzte sich jedoch, kaum, daß es seinen Austritt aus der Sowjetunion erklärt hatte, dem Wunsch Karabachs, sich Armenien anzuschließen. Daraufhin kam es in Aserbeidschan zu Ausschreitungen. In der Stadt Sumgait wurden unter den dort lebenden Armeniern mindestens 200 getötet: seitdem eskaliert die Gewalt. Im Dezember 1991 hat Karabach sich in einem Volksreferendum auch als unabhängig von Armenien erklärt.
Zuri Balayan, Arzt und Schriftsteller, früher Mitglied im Obersten Sowjet, ist so etwas wie eine Vaterfigur des Landes. Obwohl er zur Zeit kein offizielles Amt bekleidet, hat das Wort des glühenden Patrioten Gewicht. „Wir wurden seit Stalins Zeiten gezwungen, wie Sklaven zu leben", setzt er uns, ausländischen Journalisten und Ärzten, auseinander, die auf Einladung von „Christian Solidarity International" (CSI) für eine Woche in die Enklave gekommen sind. Er nutzt jede Gelegenheit, um die Situation des seit Jahrhunderten geschundenen armenischen Volkes zu schildern.
Immer wieder von fremden Mächten erobert und unterworfen, sahen die christlichen Armenier im zaristischen Rußland zunächst ihren natürlichen Verbündeten. Beim schrecklichen Völkermord von 1915, als die ,Jungtürken" 1,5 Millionen Armenier ermordeten, sah die Welt ungerührt zu, bis Stalin schließlich Armenien und Nagorny Karabach unter seinen „Schutz" stellte: Er schlug das Gebiet von Karabach Aserbeidschan zu, beließ ihm jedoch einen autonomen Status. Schließlich waren sowohl Armenien als auch das überwiegend von Armeniern bewohnte Karabach sowie Aserbeidschan Teile der Sowjetunion. Als die UdSSR zu zerbröckeln begann, wollten auch die Armenier von Karabach die Gunst der Stunde nutzen. Sie sprachen sich zunächst für den Anschluß an Armenien und dann, im Dezember 1991, für die totale Unabhängigkeit aus.
Den zweifelnden Fragen, ob denn ein so kleines Ländchen von 4.400 Quadratkilometern mit etwa 180.000 Einwohnern überhaupt lebensfähig ist, kontert Balayan mit dem Hinweis, man möge dies zu beurteilen doch bitte dem Volk von Karabach überlassen. Von allen Politikern, mit denen die Journalistengruppe spricht, wird immer wieder auf die natürlichen Ressourcen verwiesen, durch die sich das Volk selbst ernähren könne. Wichtigste Exportgüter seien Cognac und Wein.
„Schließlich leben andere Kleinstaaten in der Welt ja auch", erklärt mir Premierminister Olek Yessayan, als wir zusammen durch das blühende Land fahren, das mit seinen zerstreut liegenden Dörfern, dem ersten saftigen Grün auf den Wiesen und den schneebedeckten Bergen im Hintergrund sehr an die Innerschweiz erinnert. Nur: Dort sind die Häuser nicht beschädigt. Der Fahrer hat seine Ka-laschnikoff bereits schußbereit neben sich liegen. Allmählich nähern wir uns der Front. Yessayan, er war vor seiner Berufung zum Premier Wirtschaftswissenschafter, betont, von den in aller Welt zerstreuten vier Millionen Armeniern könnten alle, die wollten, wieder „nach Hause" kommen. Wo dieses „Zuhause" ist, bleibt zunächst unklar.
Der Krieg ist grausam: In Mara-ragh, im Norden des Landes, haben Panzer in der Nacht vom 10. zum 11. April nicht nur 70 Häuser zerstört und anschließend in Brand gesteckt, sondern die anstürmenden Aseris haben 45 Zivilisten, meistens Frauen und Kinder, auf das grausamste hingerichtet. „Denen wurden die Köpfe geradezu abgetrennnt", so die uns begleitenden Ärzte, die einige der zum Teil stark verkohlten Leichen am 12. April exhumieren ließen und untersuchten. Mehr als 100 Menschen, Alte, Frauen und Kinder, wurden von den Aseris als Geiseln genommen. Bis zur Stunde ist ihr Schicksal ungewiß.
Ist nicht auch Geiselnahme nach dem Völkerrecht verboten? Denn auch die Armenier nehmen Geiseln. Bala-yan dazu: „Ich bin Christ und ich weiß, daß es schrecklich ist, aber wir haben keinen anderen Ausweg." Er weiß, daß Geiselnahme kein Ruhmesblatt für die „Feday", die Freiheitskämpfer von Karabach, ist. .Auch wenn wir selbst kein Brot mehr haben, teilen wir das, was uns bleibt, mit den Aserbeidschanem", sagt Bälayan - und dann sehr bitter: „Aber die westliche Welt glaubt ja nur, was sie im Fernsehen sieht." Er gestattet mir und einem Kollegen, mit aserbei-dschanischen Geiseln, die sich in den Händen von Armeniern befinden, zu sprechen, was dank eines Dolmetschers möglich wird.
Die Unterredung findet am 13. April am Rande der Hauptstadt Stepanakert statt, direkt unter den Augen der feindlichen Aseris, die zwei Kilometer von uns entfernt auf den Bergen von Schu-scha sitzen. Sie hätten in uns, die wir vor ihnen im hellen Sonnenschein stehen, ein bequemes Ziel. Die Geiseln, eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und ein alter Mann mit seiner Tochter, werden aus einem Keller gebrächt. Was man ihnen gesagt hat, weiß ich nicht. Furchtsam setzen sie sich auf eine Holzbank. Mit großen ängstlichen Augen starren uns die Kinder an, eng an die Mutter gedrängt. Die junge Dorflehrerin, Seventh Ki-basha, hat zwei Tage vorher, als ihr Dorf in der Gegend von Mardaget von den „Feday" eingenommen wurde, ihren Mann verloren. Ihren Kindern hatte sie gesagt, daß sie nun keinen Vater mehr haben.
In dem Bergdorf wohnten insgesamt 650 Menschen. Bei der Einnahme des Ortes durch die „Feday" gab es einen Toten und 23 Verwundete. Was aus den anderen Dorfbewohnern geworden ist, können wir nicht in Erfahrung bringen. Zwei Brüder der jungen Frau sind bereits tot. Sie hat jedoch noch drei Schwestern, die in der Gegend von Agdam, also schon in Aserbeidschan, wohnen. Dorthin will sie gehen, sobald sie ausgetauscht wird, erzählt sie leise. Mit ihrem fein geschnittenen Gesicht, ihren großen graugrünen Augen, ihren dunklen leicht gewellten Harren, durch ein Kopftuch nur halbverdeckt, wirkt sie rührend schön und erinnert fast an ein altes Madonnenbild. Der Austausch soll so bald wie möglich vonstatten gehen. Man wolle es morgen versuchen, erzählen die „Bewacher", eine Familie mit vier Kindern. Die Jungen haben uns zuvor voller Stolz eine saubere Einschußstelle eines Maschinengewehres in einen alten Laster gezeigt, den sie als „Schutz" vor ihre Haustür gestellt haben. Die anderen Geiseln, der alte Bauer Sawet Nehe-rian, 70 Jahre alt, lebte mit seiner 17jährigen Tochter allein. Seine Söhne sind ebenfalls im Krieg, es sind Aseris. Sein ganzes Leben habe er in seinem Dorf verbracht, erzählt er: „Wir alle bildeten zusammen mit den Armeniern eine große Familie." In der Art, wie er das sagt, klingt es nicht auswendig gelernt, sondern überzeugend. Ich will wissen, ob sie gläubige Moslems seien. „Nein, wir essen auch Schweinefleisch", und jetzt lächelt er sogar ein bißchen.
Die größten politischen Sorgen bereitet den Politikern aus Karabach die Türkei. Zu groß ist das Mißtrauen gegen die Angehörigen jenes Volkes, das 1915 in einem unvorstellbaren Völkermorden 1,5 Millionen Armenier vernichtet hat. Offiziell schwankt die Türkei zwischen Drohen und Nachgeben. So erklärte Präsident Turgut Özal kürzlich, eine friedliche Lösung im südlichen Kaukasus müßte auf kleineren territorialen Veränderungen basieren. Er gesteht Karabach einen direkten Zugang nach Armenien zu. Aber als Gegenleistung müsse dann die aserbeidschanische Enklave Nachitschewan - zwischen der Türkei, dem Iran und Armenien liegend - durch einen Korridor mit Aserbeidschan verbunden werden.
Über dieses „vernünftige Tauschgeschäft" - wenigstens für die Westeuropäer-, will niemand in Karabach auch nur sprechen. Zu tief scheint die , Angst vor der Türkei - und den alten, wieder neu aufgeflammten Ideen eines Transturkistans, das sich über den Kaukasus erstrecken könnte. Hilfreich könnte in dieser verwickelten Geschichte nach Auffassung der Armenier der Iran sein, in dessen Interesse ein Erstarken der Türkei nicht unbedingt liegen kann. Immerhin gibt es eine Art Zweckbündnis zwischen Armeniern und dem Iran, in dessen Grenzen seit 400 Jahren eine armenische Minderheit lebt. Im Laufe der Geschichte nach Norden orientiert, wissen die Politiker von Karabach, daß sie gegenwärtig von Moskau nichts zu erwarten haben.
Als Vorbedingung für Verhandlungen über die anstehenden Probleme hat die Regierung eine ganze Reihe von Punkten ausgearbeitet: zunächst die Forderung, bei Verhandlungen als gleichberechtigter Partner teilnehmen zu dürfen. Ferner die Aufhebung der Blockade, also die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und den entsprechenden Kommunikationsmitteln wie Telefon, Fernsehen. Der Flugverkehr zwischen Armenien und Karabach muß störungsfrei verlaufen, alle armenischen Gefangenen müssen freigegeben und die Todesstrafe für fünf Armenier aufgehoben werden. Dafür verpflichten sich die „Feday", alle Gefangenen zurückzugeben. Dies sei kein Ultimatum, aber eine Vorbedingung für einen Waffenstillstand, werde ich von Premierminister Yessayan belehrt.
Der allerwichtigste Punkt, ohne den Karabach unter keinen Umständen lebensfähig sein kann, ist die Schaffung eines Korridors, der das Land mit Armenien verbindet und den freien Personen- und Güteraustausch ermöglicht. Nach Vorstellung der Politiker von Karabach solle dieser -aus Sicherheitsgründen - etwa sechs Kilometer breit sein. Mit 70 Kilometern Länge würde er in die armenische Stadt Goris führen. Dazu Balayan während eines Meetings mit dem Premierminister: „Es kann doch nicht angehen, daß wir uns gewaltsam einen Weg bahnen müssen, und die Welt damit einen globalen Krieg riskiert." Dieses Wort, geäußert am 13. April in einer Stadt, die seit Monaten belagert ist, wo Menschen hungern und frieren, Kinder ihre Tage in dunklen Unterständen zubringen und es jeden Tag neue Verwundete und Tote gibt, erhalten auf diesem Hintergrund einen seltsam ernsten Unterton. Mir wird es etwas ungemütlich. Der Premierminister greift ein und bittet die Schweiz als Sitz internationaler humanitärerOrganisationen, dafür zu sorgen, daß die Wege für humanitäre Hilfe offen bleiben.
Zum Abschluß unseres Besuchs in Karabach findet eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten statt. Artur Mkrtchian schildert den Ernst der militärischen Lage, erwähnt, daß die Aserbeidschaner jetzt nicht nur ein Kampfflugzeug beschafft, sondern auch ihre Angriffstechnik geändert haben: sie konzentrieren neuerdings alle militärischen Kräfte auf einen Punkt. Der sympathische junge Mann, gerade 34 Jahre alt, wirkt hinter seinen runden Brillengläsern sehr ruhig. Der studierte Kunstgeschichtler war Kustos im Museum von Stepanakert, bis er im Dezember zum Präsidenten gewählt wurde. Als er davon spricht, daß trotz der verzweifelten Notwendigkeit, einen Zugang zu Armenien zu haben, dieser humanitäre Korridor nicht durch Gewalt, sondern mit Verhandlungen erreicht werden soll, glaube ich ihm sofort. Auch, daß Karabach Frieden will.
Am 13. April wurde Mkrtchian in Stepanakert getötet.