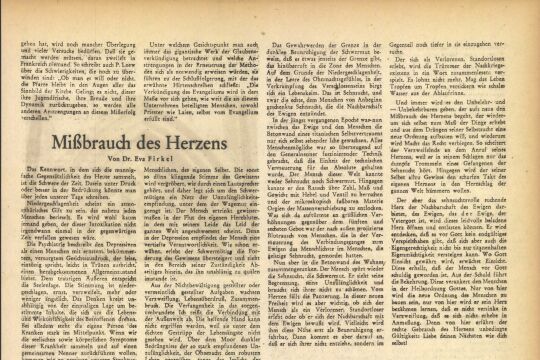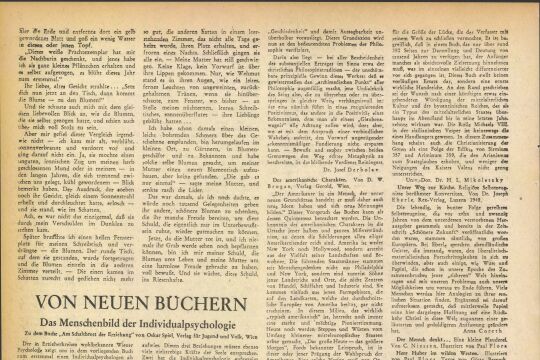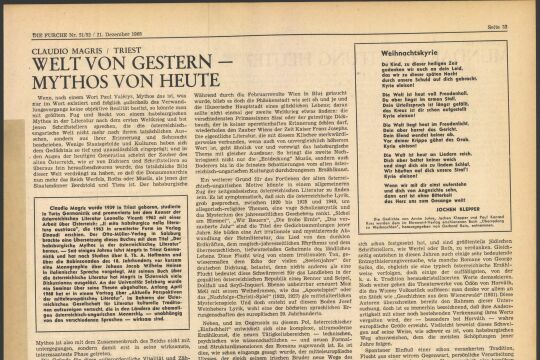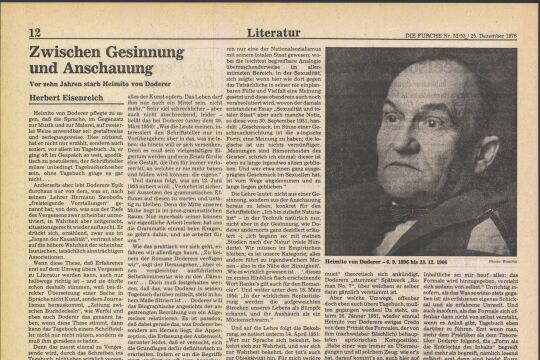Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die artikulierten Affekte
George Saiko (1892 bis 1962) war ein schwieriger Mensch; und mehr noch als den andern hat er sich's selber schwer gemacht — zu schwer sogar.
Um es kurz vorweg zu nehmen: Ein begnadeter Erzähler von Kraft und Saft und Substanz wollte partout nicht an diese seine Fähigkeit glauben; wollte nicht glauben, daß eine in voller Anschaulichkeit vor uns hingestellte Sache schon nicht mehr bloß nur diese Sache ist, sondern über sich hinaus weist auf ein Allgemeines; daß also im konkreten Liebespaar die Liebe selbst gemeint. Ist, im konkreten Sterben dieses einen da der Tod überhaupt sich bekundet. Das also wollte — oder kannte? nein, doch eher: wollte — George Saiko partout nicht glauben, und deshalb zerkommentierte er den mächtigen, prächtigen Fluß seiner Erzählung dermaßen, daß dieser Fluß in zahllose Rinnsale sich zerteilte und fast spurlos versickerte.
In dieser unseligen Methode hat man zu Recht eine Fortsetzung gewisser Tendenzen von Robert Musil, als dessen Schüler der etwas jüngere
Saiko sich verstand, und Hermann Brochs, der ihm freundschaftlich zugetan war, erkannt.
Trotzdem steht Saiko, in seinen Qualitäten wie in seinen Verirrun-gen, durchaus auf eigenen Beinen: er spricht ohne den winzigsten angelernten Zungenschlag seine höchst persönliche Sprache, traktiert seine durch und durch eigenen Themen — so auch in dem jetzt in drittem Anlauf bei Benziger erschienenen Roman, seinem ersten: „Auf dem Floß.“ Im allerweitesten Sinne handelt zwar auch Saiko von dem Generalthema seiner Generation: dem Untergang der gesellschaftlichen Ordnung Altösterreichs; aber das Personal und das Inventar seines Untergangsdramas steht unverwechselbar neben dem eines Musil, eines Doderer, eines Gütersloh, eines Roth.
Geographisch ist der Roman angesiedelt in dem zwielichtigen Korridor, wo deutsch-österreichische, ungarische und südslawische Kultur ineinander verzahnt sind, einander vielfältig überlappen; und zwar auf einem (finanziell noch intakten) fürstlichen Gut, wo die feudale Ordnung wie eine Insel im demokratisch-republikanischen Aufbruchsge-woge scheinbar unversehrt in sich ruht, obwohl von außer her das Neue wenn auch erst wie probeweise, giftig hereinzüngelt.
Das, was man gemeinhin als Handlung bezeichnet, ist leicht zu überblicken: ein Sommer auf dem Gut des Fürsten Alexander, mit getarnt sich spinnenden erotischen, freundschaftlichen und feindseligen Verflechtungen auf der gesellschaftlichen Ebene des Fürsten, und, in geheimnisvoller Parallelität dazu, mit rüden, von Sexus und Tod bestimmten Aktionen in den sozialen Niederungen. Geist und Natur, oder: Sensibilität und Kraft, kurz: Leben und Vegetieren sind sichtbarlich auseinandergebrochen, auch wenn sie immer noch von einander abhängen und auf einander angewiesen sind, wie der in Hemmungen erschlaffte Fürst und sein mit physischer Ur-kraft ausgestatteter Diener Joschko.
Saiko beschreibt nun dieses Leben mit der Absicht, „in jeder Kleinigkeit eine über das Faktische hinausweisende Bedeutung“ sichtbar zu machen; den „Ritus als Träger eines überweltlichen Sinnes in allem Tun und Geschehen“ neu zu installieren — „etwas, das es heute gar nicht gibt, das wir uns nur umständlich intellektuell rekonstruieren können“, wie der Autor den Fürsten in einem Schlüsselsatz resignieren läßt. Womit wir wieder bei Saikos Methode angelangt wären. Denn in eben diesem Schlüsselsatz nimmt Saiko nicht nur dem Fürsten, sondern sein eigenes Scheitern vorweg und begründet es, durchaus glaubhaft, mit der Notwendigkeit einer umständlichen intellektuellen Rekonstruktion.
Und hier ergreift den Leser ein echter Schmerz: Denn dort, wo Saiko erzählt und nur erzählt — wie in den Szenen aus der russischen Revolution, wie von Marischkas und Imres Fluchtwanderung, wie bei Gise im Internat und bei ihrem Italiener, wie oft und oft im kleinen und kleinsten Detail —, dort also spürt er, der Leser, sich hingerissen in das jeweilige Milieu, in das jeweilige Geschehen, in die jeweils handelnden oder duldenden Personen selbst. Wie sonst vielleicht nur Faulkner, zwingt Saiko mit solchen Passagen seinen Leser mitten hinein in das dann plötzlich nicht mehr fiktive Schicksal des Kunstwerks, das dann also, wie jedes große, im Grunde von demjenigen handelt, der es aufnehmend reproduziert — woraus sich, nebenbei bemerkt, die buchstäblich bis zur letzten Seite anhaltende Spannung erklärt. Das Erzählte wird schon ohne weiteres Zutun des Autors zum Gleichnis: zum Gleichnis individuellen wie kollektiven Lebens. Die gegenseitige Abhängigkeit von oberer und unterer Welt, der Dualismus von Bewußtem und Unbewußtem, von Hirn und Bauch im Individuum wiederholt sich in der Gesellschaft selbst, die ihrerseits dadurch als ein einziger, von diesem Dualismus freilich gespaltener Organismus sich darstellt. Doch anstatt nun dieses Bild vom Menschen in seiner letztlichen Unerklärbarkeit, also in sich selber, beruhen zu lassen, auf daß es seine Wirkung, welche auch immer, tue, kritzelt Saiko nun mit feinst gespitztem Werkzeug seine psychologischen Exkurse, Paraphrasen und Interpretationen in dieses Bild hinein, was aber keineswegs dessen Deutbarkeit fördert und damit dessen Bedeutung erhöht, sondern, im Gegenteil, gewissermaßen die Wirkung eines Radiergummis erzielt: dem Bild die Schärfe, die Genauigkeit, die Eindeutigkeit, letzten Endes die Unwiderlegbarkeit nimmt. Der Leser fühlt sich betrogen.
Und das ist jammerschade. Denn was Saiko aus dem affektiven Untergrund menschlichen Lebens ins Licht der bewußtmachenden Sprache hebt: vor allem die über ihrer banal nackten Erscheinungsform erst wirklich, nämlich schicksalhaft, wirkende Sexualität: das sind echte Funde, die aber wieder verlorengehen in des Finders tief erschreckter Angst, sie möchten als solche nicht haltbar sein ohne seine, des Finders, geradezu entschuldigende Kommentierung. Goethes Forderung an den Künstler, nicht zu reden, sondern zu bilden, hat Saiko nicht auf sich bezogen. Mit immensem Fleiß und nicht ohne ästhetische Rabulistik hat er die nicht bloß alte, sondern auch bislang nicht wiederlegte Erfahrung verdrängt, daß die Anschauung immer viel stärker wirkt als die Erklärung, weil jene den Menschen existentiell anspricht und elementarer trifft, diese hingegen ihn nur intellektuell anspricht und nur partiell trifft. Zu mir hat er einmal gesagt: „Nehmen Sie Dostojewski die Psychologie weg, und was bleibt übrig? Nichts!“ In einem Gespräch über Saiko mit Doderer meinte dann dieser dazu: die Psychologie sei für den Schriftsteller nur eine Hilfswissenschaft: „Der Schriftsteller ist wesentlich nicht Psychologe, sondern Fatologe.“
George Saiko war schicksalskundig in höchstem Grade. Und überall dort, wo er vergißt, sich für diese seine künstlerische Potenz intellektuell zu rechtfertigen, verschafft er uns ungeahnte Einsichten in das Schicksal, das wir dadurch zwar gewiß nicht zu meistern, aber vielleicht mit Gelassenheit zu akzeptieren lernen.
AUF DEM FLOSS. Roman. Von George Saiko. 560 Seiten. Benzi-ger-Verlag, Zürich und Köln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!