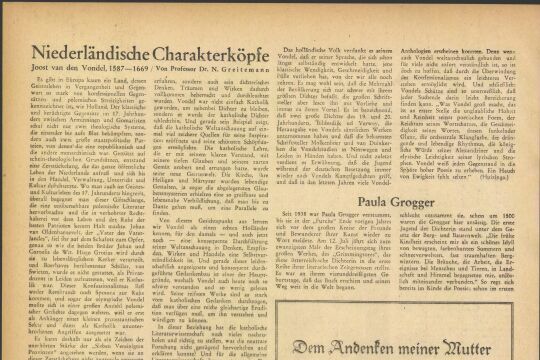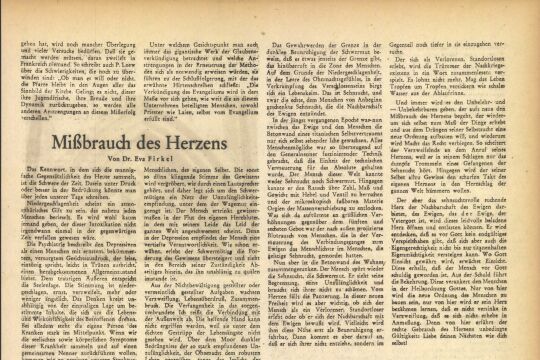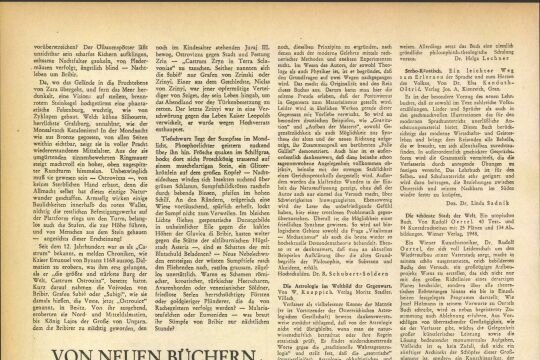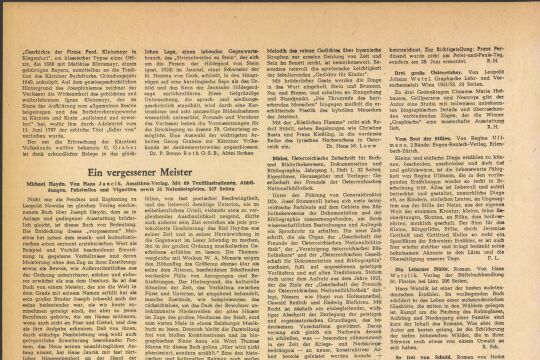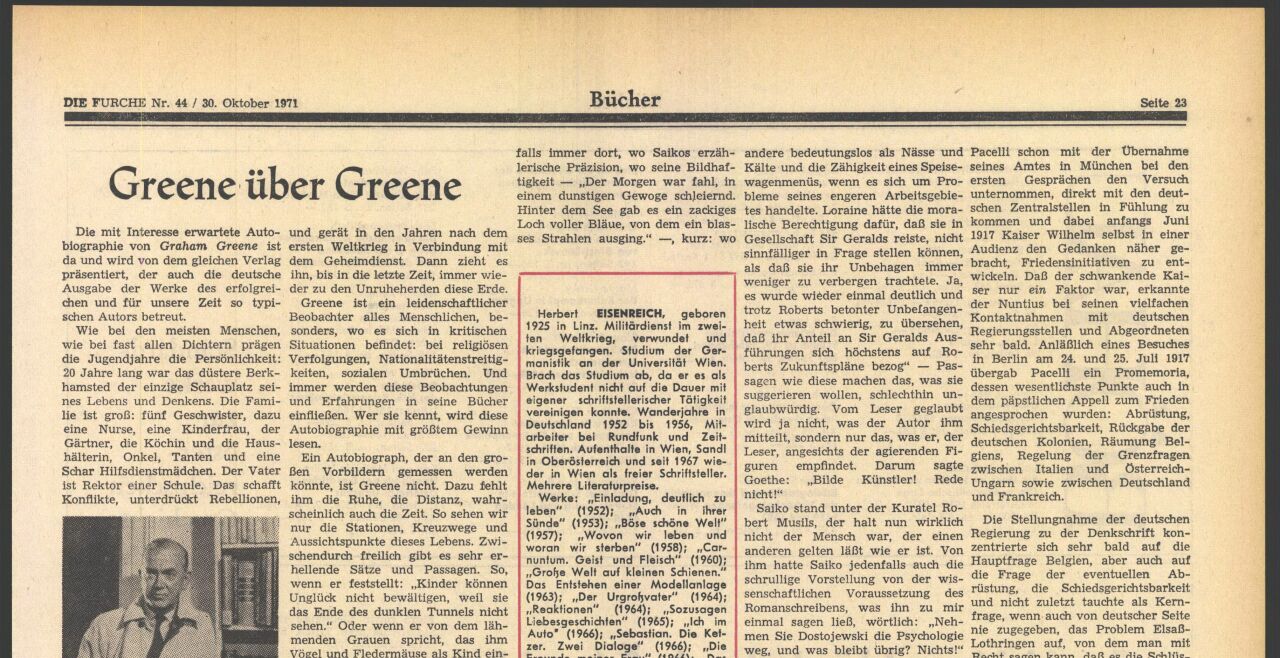
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Underground der Zeitgeschichte
George Saiko schöpft aus dem Fundus abgelebter Vergangenheit: so in seinem ersten Roman — „Auf dem Floß“ — aus der Epoche kurz nach dem Untergang der Donaumonarchie, wo das Feudale zwar noch da war, aber im verengten Raum und bei veränderter politischer und sozialer Struktur doch nur noch sich selbst parodierte — insbesondere der Fürst Alexander, der in seinem ländlichen Umkreis zwar noch souverän gebietet, im Persönlichen aber aus eigener Kraft sein Lebensschiff zu steuern sich nicht mehr imstande fühlt. Deshalb braucht er Joschko bei sich, seinen Diener, einen aufs Körperliche reduzierten Herkules, der ihm nicht weniger bedeutet, als Gott dem bischöflichen Bruder des Fürsten bedeutet: die Quelle der Kraft, des Selbstbewußtseins, der Sicherheit.
In seinem jetzt ebenfalls neu edierten anderen Roman — „Der Mann im Schilf“ — schildert Saiko einen symptomatischen Ausschnitt einer auch schon vergangenen Epoche, nämlich das Chaos der Jahre vor dem Anschluß Österreichs, die „Systemzeit“, wo Rot und Braun und Schwarz einander bekriegten und jeder eines jeden heimlicher Feind war, wobei ein jeder freilich versuchte, auf irgendein Unbekannt- Verborgenes sich auszureden, wie hier auf den ominösen „Mann im Schilf“, einen politischen Flüchtling in seinem Versteck am Seeufer, von dem am Ende keiner mehr weiß, ob es ihn überhaupt wirklich gibt. In dieses Geschehen werden vier Menschen hineinverstrickt, die gerade nur miteinander, ja nur mit sich selber beschäftigt sein wollen; doch Abstinenz gelingt sowenig wie Engagement.
Also auch ein Gesellschaftsroman (in des Wortes wahrster Bedeutung): private Schicksale vor politischem Hintergrund, und zugleich auch die Entstehung dessen, was man so vage „die Zeit“ nennt, aus jedem einzelnen der in ihr tätigen, leidenden Menschen. Dabei geht es Saiko weniger um die soziologisch faßbare Oberfläche, sondern vielmehr um das Kräftespiel im affektiven Untergrund. Er bleibt zwar im Strom der naturalistischen Erzähltradition, er erzählt konkret und anschaulich, aber was er da sichtbar macht, sind Menschen, denen gleichsam alles Fleisch der Konvention von den Knochen geschält worden ist: sie sprechen, als ob niemand ihnen zuhörte, und sie handeln, als wären sie völlig unbeobachtet Saikos Romanprosa ist gleichsam ein Röntgenschirm, auf dem das Seelengerüst sichtbar wird.
Die spezielle Leistung dieser Kunst besteht darin, daß sie Tendenzen der Zeit aus der seelischen Tiefenschicht ihrer Menschen heraus darstellt und deutet. Was man gemeinhin für den allerpersönlichsten Bereich hält, wird bei Saiko zum Nährboden allgemeiner Erscheinungen. Im Bauch wird vorbereitet, wofür der Kopf im nachhinein Argumente findet.
In der Bloßlegung und Verkettung von Motiven ist Saiko weitergegangen als irdendein anderer Autor; er lotet in Tiefen, wo wirklich nur noch das Motiv als das Wesentliche erscheint. Das ist eine positive Feststellung, zugleich aber auch der Ansatzpunkt der Kritik, welche hier zu fragen hat, ob die literarische Anwendung einer wesentlich wissenschaftlichen Methode nicht auf Kosten des eigentlich Literarischen geschehe, und ob es Saikos Intentionen als Schriftsteller förderlich war, in einem Material zu arbeiten, das nicht per se das dem Schriftsteller gemäße ist. Es stellt diese Frage sich jeden falls immer dort, wo Saikos erzählerische Präzision, wo seine Bildhaftigkeit — „Der Morgen war fahl, in einem dunstigen Gewoge schleiemd. Hinter dem See gab es ein zackiges Loch voller Bläue, von dem ein blasses Strahlen ausging.“ —, kurz: wo die Anschauung sich verflüchtigt in einen ohne terminologisches Einverständnis nicht mehr auflösbaren Nebel abstrakten Psychologisierens. „Für Sir Gerald war noch manches andere bedeutungslos als Nässe und Kälte und die Zähigkeit eines Speisewagenmenüs, wenn es sich um Probleme seines engeren Arbeitsgebietes handelte. Loraine hätte die moralische Berechtigung dafür, daß sie in Gesellschaft Sir Geralds reiste, nicht sinnfälliger in Frage stellen können, als daß sie ihr Unbehagen immer weniger zu verbergen trachtete. Ja, es wurde wieder einmal deutlich und trotz Roberts betonter Unbefangenheit etwas schwierig, zu übersehen, daß ihr Anteil an Sir Geralds Ausführungen sich höchstens auf Roberts Zukunftspläne bezog“ — Passagen wie diese machen das, was sie suggerieren wollen, schlechthin unglaubwürdig. Vom Leser geglaubt wird ja nicht, was der Autor ihm mitteilt, sondern nur das, was er, der Leser, angesichts der agierenden Figuren empfindet. Darum sagte Goethe: „Bilde Künstler! Rede nicht!“
Saiko stand unter der Kuratel Robert Musils, der halt nun wirklich nicht der Mensch war, der einen anderen gelten läßt wie er ist. Von ihm hatte Saiko jedenfalls auch die schrullige Vorstellung von der wissenschaftlichen Voraussetzung des Romanschreibens, was ihn zu mir einmal sagen ließ, wörtlich: „Nehmen Sie Dostojewski die Psychologie weg, und was bleibt übrig? Nichts!“ Ich antworte heute, rund 15 Jahre später, darauf: „Man nehme George Saiko die Psychologie weg, und was bleibt übrig? Ein mitreißender Erzähler!“
DER MANN IM SCHILF. Roman. Von George Saiko. 316 Seiten. Ben- ziger-Verlag, Zürich und Köln, 1971.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!