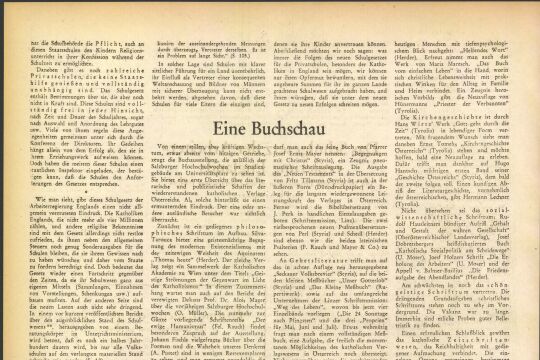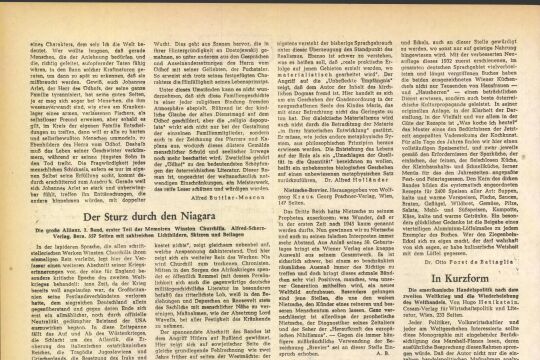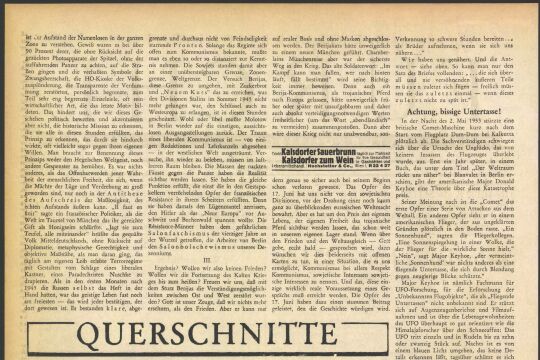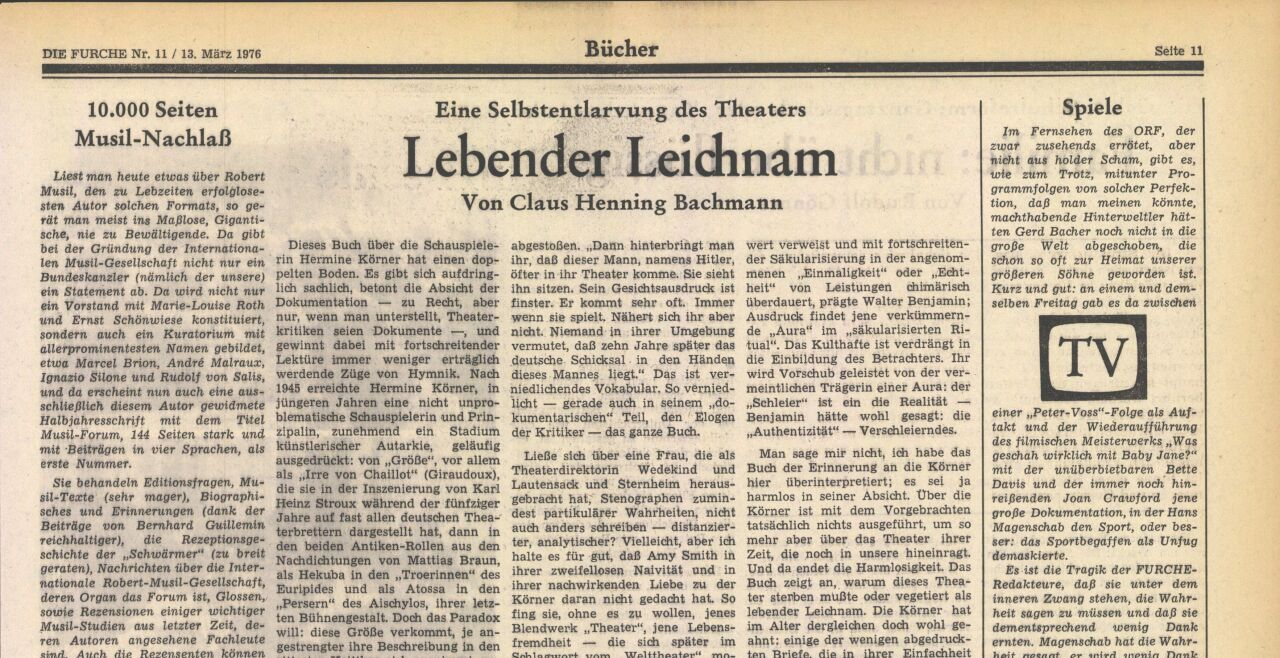
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lebender Leichnam
Dieses Buch über die Schauspielerin Herrnine Körner hat einen doppelten Boden. Es gibt sich aufdringlich sachlich, betont die Absicht der Dokumentation — zu Recht, aber nur, wenn man unterstellt, Theaterkritiken seien Dokumente —, und gewinnt dabei mit fortschreitender Lektüre immer weniger erträglich werdende Züge von Hymnik. Nach 1945 erreichte Hermine Körner, in jüngeren Jahren eine nicht unproblematische Schauspielerin und Prinzipalin, zunehmend ein Stadium künstlerischer Autarkie, geläufig ausgedrückt: von „Größe“, vor allem als „Irre von Chaillot“ (Giraudoux), die sie in der Inszenierung von Karl Heinz Stroux während der fünfziger Jahre auf fast allen deutschen Theaterbrettern dargestellt hat, dann in den beiden Antiken-Rollen aus den Nachdichtungen von Mattias Braun, als Hekuba in den „Troerinnen“ des Euripides und als Atossa in den „Persern“ des Aischylos, ihrer letzten Bühnengestalt. Doch das Paradox will: diese Größe verkommt, je angestrengter ihre Beschreibung in den zitierten Kritiken sich ausnimmt, zur Unanschaulichkeit; das Buch ist am Ende — bevor einige Briefe der Körner folgen — nahezu unlesbar.
Die Herausgeberin und Freundin der Körner, Amy Smith, deren Zurückhaltung über ihre eigene Rolle im Leben der Gefeierten dankbar registriert werden muß, merkt an, daß es für die Zeit von 1945 bis 1960 (dem Todesjahr Hermine Körners) an kritischen Gegenstimmen fehlt. Mag sein, aber bemerkenswert ist noch etwas anderes. Die Hermeneutik der Beschreibungsversuche durchaus seriöser, kenntnisreicher Rezensenten wirkt in der Häufung der zitierten Höhepunkte lächerlich. Das Kritiker-Vokabular der Superlative desavouiert sich selbst. Der „Abglanz hohen pathetischen Theaters“, „ein natürliches Pathos“, „Deutschlands letzte Heroine, die das Pathos vergangener Zeit mit dem zeitgemäßen Understatement bruchlos zu vereinen weiß“, daneben wiederum „ihr zeitloses Pathos“ oder das „Hoheitsvolle fern aller falschen Pathetik“ oder gar „ein großes Pathos, ohne im geringsten pathetisch zu klingen“; Jahrzehnte hindurch ein aufschwingender „Celloklang ... in ihrer Stimme“ oder ein „Celloton in dem geborsten klingenden Organ“, nach ihrem Tode dann rückhörend Instrumentenwechsel, nämlich die „sonore Harmonie von Bratschenstrich und Hornton“ — es ist ganz offensichtlich ein völlig sinnloses Wortgetön, das da massiv gegen den Leser andrängt.
Doch noch einmal: es liegt nicht an den Kritikern, die vielleicht schlechte Poeten sind, es liegt am Gegenstand. Das Theater, das die Körner auf ihrem Wege von Dresden über Reinhardt in Berlin, über Intendanzen in München und abermals Dresden zu Gründgens in Berlin und zum Status der „Königlichen Schauspielerin“ repräsentierte, ist Vergangenheit nicht nur im zeitlichen Sinn. Es ist auch in seinen reinsten Inkarnationen ferner, als der historische Abstand erkennen läßt. Diese Ferne ist erwiesen in seinem offensichtlich unrichtigen Weltverständnis. Hermine Körner sprach 1959 anläßlich des hundertsten Geburtstags der Duse vom „Glanz der Tiefe“ und vom „Weg in die Höhe“: genauso wird das Theater in diesem Buch abgespiegelt als unablässig auf Höhen und Tiefen wandelnd, als das Leben umgreifend. Aber es gibt nichts Lebensfremderes. Begriffen hat dieses Theater der Heroinen, die zu Tränen rühren konnten, überhaupt nichts. Hermine Körner hat sich im sogenannten Dritten Reich untadelig verhalten; sie war „nur“ Schauspielerin.
In dem Buch über sie ist eine Passage abgedruckt, die ihre ersten Wahrnehmungen über Hitler — Mitte der zwanziger Jahre in München — wiedergibt. Sie sei beeindruckt gewesen „von der Dynamik in der Rede des Mannes“, aber „seine Ansichten, sein Fanatismus“ hätten sie
abgestoßen. „Dann hinterbringt man ihr, daß dieser Mann, namens Hitler, öfter in ihr Theater komme. Sie sieht ihn sitzen. Sein Gesichtsausdruck ist finster. Er kommt sehr oft. Immer wenn sie spielt. Nähert sich ihr aber nicht. Niemand in ihrer Umgebung vermutet, daß zehn Jahre später das deutsche Schicksal in den Händen dieses Mannes liegt.“ Das ist verniedlichendes Vokabular. So verniedlicht — gerade auch in seinem „dokumentarischen“ Teil, den Elogen der Kritiker — das ganze Buch.
Ließe sich über eine Frau, die als Theaterdirektorin Wedekind und Lautensack und Sternheim herausgebracht hat, Stenographen zumindest partikulärer Wahrheiten, nicht auch anders schreiben — distanzierter, analytischer? Vielleicht, aber ich halte es für gut, daß Amy Smith in ihrer zweifellosen Naivität und in ihrer nachwirkenden Liebe zu der Körner daran nicht gedacht hat. So fing sie, ohne es zu wollen, jenes Blendwerk „Theater“, jene Lebensfremdheit — die sich später im Schlagwort vom „Welttheater“ modisch gerierte — bestechend ein. Entlarvung findet statt auf fast jeder Seite (die historische Theater-Leistung der Körner bleibt dabei unangetastet). Zuckmayer sagt Hermine Körner nach einer Aufführung der „Perser“ schriftlich Dank; er habe nicht „hinter die Bühne“ gehen können, „so wie man ja auch nach der Messe nicht in die Sakristei geht“: Theater als Gottesdienst, als „säkularisiertes Ritual“. Siegfried Mel-chinger spricht in einem seiner Nachrufe von der „Körner-Aura, die sie wie einen Schleier trug“. Den Begriff der „Aura“ als eine Eigenschaft von Kunstwerken, die auf deren Kult-
wert verweist und mit fortschreitender Säkularisierung in der angenommenen „Einmaligkeit“ oder „Echtheit“ von Leistungen chimärisch überdauert, prägte Walter Benjamin; Ausdruck findet jene verkümmernde „Aura“ im „säkularisierten Ritual“. Das Kulthafte ist verdrängt in die Einbildung des Betrachters. Ihr wird Vorschub geleistet von der vermeintlichen Trägerin einer Aura: der „Schleier“ ist ein die Realität — Benjamin hätte wohl gesagt: die „Authentizität“ — Verschleierndes.
Man sage mir nicht, ich habe das Buch der Erinnerung an die Körner hier überinterpretiert; es sei ja harmlos in seiner Absicht. Über die Körner ist mit dem Vorgebrachten tatsächlich nichts ausgeführt, um so mehr aber über das Theater ihrer Zeit, die noch in unsere hineinragt. Und da endet die Harmlosigkeit. Das Buch zeigt an, warum dieses Theater sterben müßte oder vegetiert als lebender Leichnam. Die Körner hat im Alter dergleichen doch wohl geahnt: einige der wenigen abgedruckten Briefe, die in ihrer Einfachheit und Klarheit lesenswert sind, bezeugen es. „Wie schön es wäre ..., nichts mehr vom Theater zu wissen — o Gott — wie schön! Wie schön!!“: darin gipfelt ihre mit Arbeit immer wieder betäubte Verzweiflung. Aber die Lebenslüge dauerte an und dauert noch immer und hält den Leichnam Theater am Leben.
HERMINE KÖRNER, von Amy Smith, mit Verzeichnissen der Rollen, Inszenierungen und Rezitationen von Hermine Körner nach 1945, 43 Abbildungen. Kranich-Verlag, Berlin, 278 Seiten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!