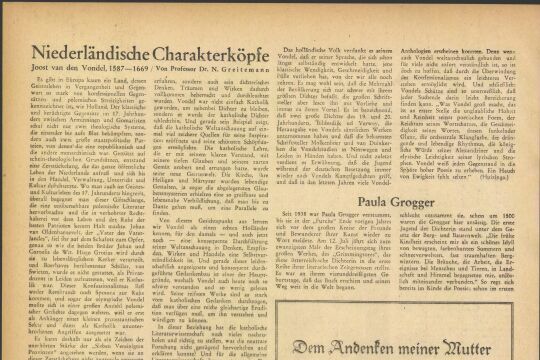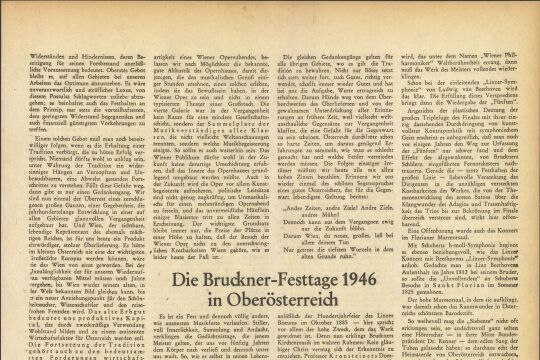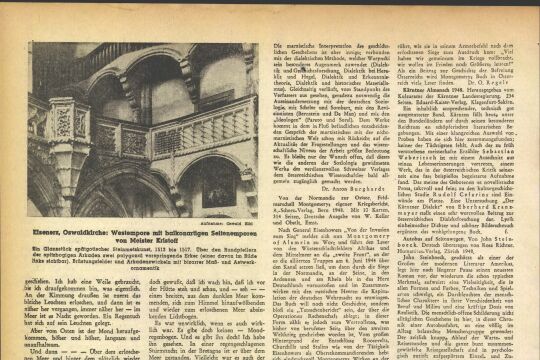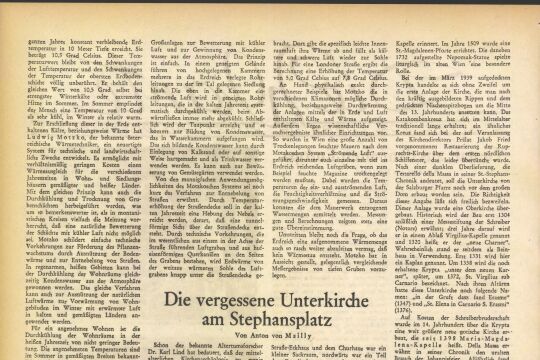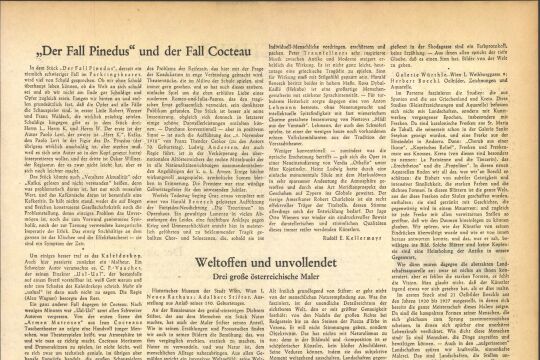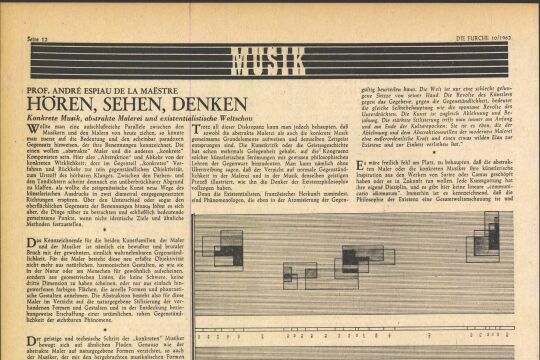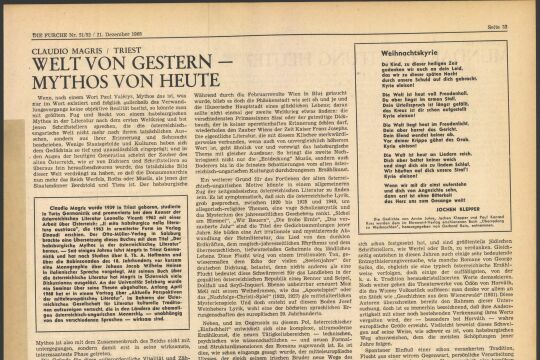Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiederentdeckung der Romantik
Ein schmaler Küstenstreifen, Felsen, dahinter, in einem Nebelschleier verborgen, schemenhaft ein Schiff. „Nebel“ hat Caspar David Friedrich dieses Bild genannt und damit ein Symbol der Romantik geschaffen, die Dialektik zwischen Realität und Traum visualisiert.
Man beginnt sich wieder zu interessieren für eine Epoche, die man lange Zeit kritisch und mit Unbehagen betrachtet hat. Die österreichische Galerie hat - getreu dem Motto der Festwochen — zwei Vertreter dieser Kunstrichtung miteinander konfrontiert. Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich. Leihgaben aus der Hamburger Kunsthalle bilden den Schwerpunkt, aufgebessert aus dem österreichischen Bestand. Die Ausstellung kann sich sehen lassen - auch international.
„Der wahre Inhalt des Romantischen ist die absolute Innerlichkeit, die entsprechende Form ist die geistige Subjektivität als Erfassen ihrer Selbständigkeit und Freiheit. Der Mensch erscheint nicht als Mensch im bloß menschlichen Charakter, sondern als der sich wissende, einzige und allgemeine Gott selber. Die ideale Schönheit ist verschwunden, die romantische Kunst hat das Leben als solches nicht mehr zum Ziel...“, schrieb Friedrich Hegel, über die Romantik und traf damit zwei wesentliche Punkte. Romantik als Abkehr von der Äußerlichkeit, Zurückziehen ins Innere, „Negation des Negativen“.
Die Romantik war ganz gegen ihren häufig falschen Gebrauch in der Sprache niemals versöhnliche Kunst, Romantik schloß das Paradoxon, den unüberwindlichen Gegensatz mit sich ein, den Gegensatz, von dem Adorno sagt, daß es ohne ihn Kunst nicht gäbe. Romantische Kunst war also nie Verniedlichung oder billige Harmonisierung, sie hat die Kluft zwischen Mensch und Natur immer kraß herausgestrichen. Und gleichzeitig spürt man die Sehnsucht nach dem Unendlichen, das man durch das „Unaussprechliche“ erfassen, ertasten will. Wie Caspar David Friedrich es versucht hat, in seinem Nebelbild oder in den Wandererzyklen.
Nicht durch Zufall hat die Psychoanalyse das Interesse an der Romantik wieder erweckt, hat das Paradoxon als psychische Realität begriffen, es als „Anderes“, entfremdetes Ich definiert. Wie auch die Romantiker. „Das Romantische ist das Schöne ohne Begrenzung oder das Schöne Unendliche“, sagte Jean Paul. Oder Novalis, der von der „Identifizierung des niedrigen Selbst mit einem besseren Selbst“ sprach.
Romantik als existentieller Entwurf, als Versuch, in der Immanenz zu trans- “ zendieren, die Realität und das Mate-
riale zu übersteigen, durch die Materialisierung des Nichtmaterialen. So hat man es in der Literatur versucht, so auch in der bildenden Kunst. Vor allem Friedrich hat diese Sehnsucht nach dem „Anderen“, nach dem Dunklen, Mystischen, immer wieder artikuliert, hat versucht, es in seine Landschaften zu integrieren, indem er das Äußerliche mit dem „Nichtdefinierba-ren“ verknüpft. Das Dunkle als durchgängiges Thema, als Leitfaden. Gleichzeitig auch die Relativierung des Ich durch Ironie, wie es in dem Bild „Landschaft mit Grab, Sarggund Eule“ deutlich wird. Hier werden Sehnsucht, die Angst vor der Sehnsucht, das Lächeln über die Sehnsucht in ein Moment integriert und sprengen damit die klassizistische ästhetische Form, brechen die Scheinernsthaftigkeit auf.
Ähnlich, nur mit weniger Erfolg und weniger substantiell, hat auch Philipp Otto Runge das Dunkle thematisieren wollen. Traum und Realität, Sein und Schein sollten integriert, in ihrer Dialektik als Einheit dargestellt werden. Idee und Materialisation einer Idee, wie es besonders im Zyklus „Zeiten“ verdeutlicht werden soll. Nur - Runge hatte nicht das Genie Friedrichs, er blieb in der aufgesetzten Didaktik stecken, konnte sich in der Realisierung seiner Ideen nicht von den gedanklichen Konstruktionen lösen und blieb brav, genrehaft. Ihm fehlte die ästhetische Souveränität eines Friedrich.
Die Konfrontation der beiden ist
gleichzeitig ein Symptom der Romantik. Die Dialektik von Gelingen und Nichtgelingen, von Idee und deren künstlerischer Visualisierung. Friedrich kann über sich lachen, Runge nicht.
Eine Ausstellung, die Anlaß zum Nachdenken über die Aktualität der romantischen Kunstauffassung geben sollte: „Nichts ist romantischer als was man gewöhnlich Welt und Schicksal nennt“ (Novalis).
Der Bergfreund Erzherzog Johann in Landmannstracht. Dahinter ein eisbedeckter Gipfel. Schroffe Felsen im Vordergrund, ein weites Tal mit lieblichem Grün, die Gewehre lässig von den Schultern der Jäger baumelnd. Eines der vielen Repräsentationsbilder des Kammermalers Mathäus Loder, dem zusammen mit Eduard Gurk eine Ausstellung in der Albertina gewidmet ist. Motto: Biedermeier und Vormärz in der bildenden Kunst. Vom kunsthistorischen Standpunkt aus eine wichtige Schau.
Die Selbstdarstellung der Adeligen, Kirchenfürsten und später der emanzipierten Bürger hat es immer schon gegeben. Politische und ökonomische Macht spiegelten sich stets in der Kunst. Jeder Potentat hielt sich einen Hofmaler. So auch im Biedermeier, als Bürger und Adel das „harmonische Porträt“ für sich entdeckten, im Zeichen des Kunstmäzenatentums.
Mathäus Loder (1781-1828) war der Kammermaler des Erzherzogs Johann. Begonnen hat er als Karikaturist und Modezeichner, geendet als getreuer Porträtist seines Herrn. Die Welt der Berge, Alpenharmoriie, Natur und Macht, friedliche Gemsjagden waren die Lieblingsthemen des jodelnden Erzherzogs. Und Loder führte die Aufträge mit beachtlichem handwerklichem Können, mit malerischer Akri-
bie und Liebe zum Detail getreulich aus. Sogar Industrieanlagen wie am steirischen Erzberg scheinen hier naturwüchsig. Nichts darf des Bürgers Traum von der Lieblichkeit der Landschaft stören. Lieblichkeit als Zwang.
Ähnlich war Loders Kollege, Eduard Gurk (1801-1841), der Hofmaler des Kaisers Ferdinand. Gurk wagt sich etwas weiter hinaus, streift die Anfänge des Realismus, in Spuren zumindest. Er setzt manchmal soziale Akzente, stellt Industrie als Industrie hin, nicht als Scheinnatur, seine Veduten haben nicht ganz den ausschließlich harmonisierenden Charakter. Gurk im Weichbild der Kritik. Doch in der Mehrzahl finden sich auch bei ihm Untertanenbilder, Verherrlichungen des Kaisers. Zeremonienbilder. Wie etwa die fast 40 Aquarelle, die die Wallfahrt des Kaisers nach Mariazell festhalten. Hier schwelgt Gurk in Lobpreisungen, auch wenn ihm manchmal Anspielungen „durchgehen“, Freud'sche Fehlleistungen geradezu, die ein Symptom der puritanisch autoritären Zeit sind. Symbole einer Rigidität, die sich hinter Harmonie und vollständigem Bürgerglück verbergen. Versöhnlichkeit steht als Maxime über den Bildern, der Traum von einem stabilen Glück. Der Adel und das Großbürgertum als Wonnespender.
Die Auftragsarbeiten der beiden Kammermaler waren natürlich immer in privaten Händen, die öffentlichkeit kannte Loder und Gurk kaum. So verstaubten die Werke der beiden in Archiven. Die Festwochen waren der gegebene Anlaß, sie auszugraben. Die Albertina-Retrospektive drückt aber auch etwas ganz anderes aus: Die Sehnsucht nach Harmonie und lieblicher Konflikt!osigkeit ist ja heute stärker denn je. Der Bürger muß seinen Anspruch auf Individualität, personelle Einzigartigkeit, verteidigen. Die Zeit der Kammermaler könnte wieder kommen, in modifizierter Form.
Es ist ein Verdienst der Albertina, Vergessene wieder einmal ans Licht zu holen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!