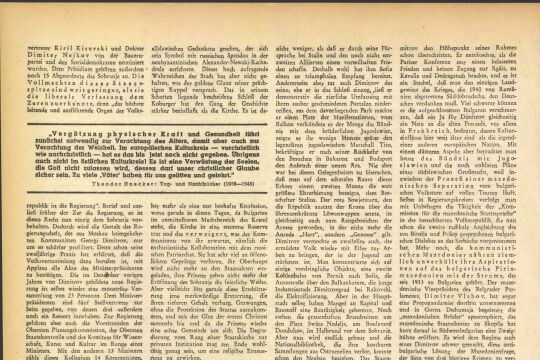Der Schwarze Donnerstag
Vor 90 Jahren, am 24. Oktober 1929, brach in den USA der Börsenhandel zusammen. Die Ereignisse führten auch zu einer theologischen Wiederentdeckung – der Erbsündenlehre.
Vor 90 Jahren, am 24. Oktober 1929, brach in den USA der Börsenhandel zusammen. Die Ereignisse führten auch zu einer theologischen Wiederentdeckung – der Erbsündenlehre.
Mit dem 24. Oktober 1929 verbindet sich eine Krisenerfahrung, wie sie in politisch friedlichen Zeiten der USA bis dahin einmalig war. Der Aktienindex, der „Dow-Jones“, brach schlagartig ein. Ob ärmliche Arbeiter, die jeden verdienten Cent in die Spekulationen an der Börse gesetzt hatten, oder Berufsanleger, die erst mit Hilfe der Anlagen zu Gewinn gekommen waren – sie alle befanden sich am Rande des Ruins. Viele verloren innerhalb von Stunden, ja Minuten, alles. Eingebrannt in das Gedächtnis der letzten Zeitzeugen bleiben die zu Boden fallenden Körper jener Anleger, die in diesen Tagen keinen anderen Ausweg wussten als den Suizid.
Angesichts der Weltwirtschaftskrise von 1929 sahen sich die Vertreter der zerbrochenen Ordnungen vor die Aufgabe gestellt, mit der Krisenerfahrung fertig zu werden. Die Geschehnisse an der Börse konfrontierten die Menschen am Boden ihrer Existenz auf radikal eindringlichste Weise mit Fragen von Schuld, Unheil, Zerstörung und Armut.
Ende des unhinterfragten Optimismus
Das ganze Land war im Modus der Krisenbewältigung. Das Ereignis des „Black Thursday“ bestimmte das kollektive Bewusstsein einer ganzen Nation. Zahlreiche wohltätige Organisationen entstanden, um den betroffenen Menschen unter die Arme zu greifen; US-Präsident Herbert Hoover versuchte krampfhaft, mit höchst umstrittenen Gegenmaßnahmen die Folgen für das Land möglichst gering zu halten.
Aber die Folgen des „Schwarzen Donnerstags“ reichten weiter: Sie forderten auch viele US-Theologen der damaligen Zeit heraus. Besonders jene protestantischen Kreise,
die lange einen schier unhinterfragten Optimismus menschlicher Gesellschaft gepredigt hatten, fanden sich an einem Nullpunkt ihres Glaubens wieder. Nicht, dass man Scheitern und Unheil nicht schon vorher zum Thema gemacht hätte, aber man suchte sie eher in den Verfehlungen einzelner Menschen. Was aber angesichts des Ersten Weltkrieges und besonders in der Wirtschaftskrise immer stärker ins Bewusstsein trat, war größer: Das war nicht die Schuld einzelner Menschen. Dies ließ sich nicht auf Fehler einer Person zurückführen, sondern hier stürzten ganze Gesellschaften samt unschuldiger Beteiligter in unfassbare Katastrophen. Es waren strukturelle Desaster, ja eine Verstrickung in Schicksale, die weit über individuelle Schuldfähigkeit hinausgingen. Wie konnte Gott das zulassen?
Das Werk „Moral Man and Immoral Society“ (1932) des protestantischen US-Theologen Reinhold Niebuhr war eine der ersten und zugleich bekanntesten Aufarbeitungen der damaligen Geschehnisse. Das Unheil, so die Antwort Niebuhrs, dem Millionen von Menschen ausgesetzt waren, konnte nicht mit den negativen Folgen einer schlechten Handlung erklärt werden. Niebuhr konnte und wollte die Verantwortung dieser Katastrophe nicht einfach auf die betroffenen Menschen abwälzen. Viele von ihnen konnten nichts dafür. Sie bezahlten für etwas, das außerhalb ihrer Einflussmöglichkeiten lag.
Niebuhrs Ansatz ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen stellt er den theologischen Versuch dar, eine authentische Antwort auf das konkrete Unheil der Menschen von 1929 zu geben, ohne zugleich in kollektive Schuldzuweisung zu verfallen. Zugleich greift der US-Denker darin auf ein theologisch eigentlich unliebsames Lehrstück zurück, das im US-Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts bis dahin weitestgehend ausgeblendet wurde, nämlich die Erbsündentheologie.
Niebuhr wollte den Menschen eine Antwort liefern, warum sie sich plötzlich ohne persönliches Zutun in einer lebensgefährlichen Situation befanden. Genau dafür bot sich dieses althergebrachte Lehrstück christlicher Theologie (wenngleich auch in modifizierter Form) an. Möglicherweise, so Niebuhr, war es die Blindheit vorangegangener Generationen, vielleicht auch die Gier einzelner Mitbürger – hineingezogen wurden aber schlichtweg alle: Unterschiedslos rasten die Börsenkurse in den Keller – für die
Reichen wie für die Armen. Sie alle befanden sich im Strudel einer Schuldgeschichte, die sie nicht alle in derselben Weise verantwortet hatten. Ganze Familien wurden im Irrglauben des erfolgsverwöhnten Börsengangs bestraft, obwohl keines der Mitglieder ein Verbrechen begangen oder böswillige Ziele verfolgt hatte. Sie wurden in ein Unglück gestürzt, für das sie persönlich nicht beschuldigt werden konnten. Hier kommt für Niebuhr die Erbsünde ins Spiel, die für ihn eine theologische Anschlussstelle für das erfahrene Schicksal darstellte.
Dieses Szenario war beispielhaft, die Erfahrungen der Geschichte prägten die Theologie zunehmend: Die Krisen des 20. Jahrhunderts ließen den theologischen Blick verstärkt auf menschliches Versagen, gleichzeitig aber auch auf die gesellschaftlichen Schuldformen fallen. Niebuhr war ein Vorreiter dafür, die Erbsündenlehre auf geschichtliche Erfahrungen kollektiven Scheiterns anzuwenden, die über eine rein sexuelle Interpretation hinausgingen. Was in zahlreichen katholischen und orthodoxen Strömungen als ausschließlich sexuell weitergegebene Verstrickung in menschliche Hinfälligkeit angesehen wurde, wurde vermehrt in gesellschaftspolitischer Hinsicht gedeutet. Erbsünde dürfe nicht einfach nur mit Sexualität in Verbindung gebracht werden, sondern sie sei vielmehr in den Strukturen des Zusammenlebens zu finden.
Zustand des „dauernden Scheiterns“
Der Mensch ist, so Niebuhrs Tenor, in einem Zustand des „dauernden Scheiterns“, einer schmerzhaften „Ironie“, die nicht einfach abgeschüttelt werden könne – und das beschränke sich nicht auf Sexualität. Selbst wenn sich die Menschen noch so sehr bemühten, gut und tugendhaft zu handeln, würde das Damoklesschwert von Scheitern und Unheil niemals vollständig über ihren Köpfen verschwinden. Der Ansatz, als „christlicher Realismus“ bekannt geworden, ist jedoch keine Absage an die Menschheit: Bei allem Zweifel und Kritik menschlicher Macht und ihres Missbrauchs traut Niebuhr den Gesellschaften durchaus positive Entwicklungen zu. Wogegen er sich aber vehement verwehrte, war ein unkritischer Blick auf die Fortschrittsgläubigkeit, die den Menschen ebenso gut in das stürzen konnte, was die Menschen in den USA am 24. Oktober 1929 am eigenen Leib erfuhren. Andererseits nahm der US-Theologe aber auch die Kirchen in die Pflicht, sich niemals unabhängig von diesen Schuldzusammenhängen sicher zu wähnen. Ihre Fehler seien auch Anzeichen für diese Hinfälligkeit. Sie seien ständig zu einem Aufbruch aufgerufen, der die Menschen, ihre Geschichte und kon-
kreten Erfahrungen ernst nehmen müsse.
Es dauerte mehr als 30 Jahre, ehe Papst Johannes XXIII. die Geschichte katholischerseits als „Lehrmeisterin des Lebens“ („mater et magistra“) bezeichnen sollte. Doch man konnte sich dieser Perspektive nicht mehr verschließen. Zu viel war im 20. Jahrhundert passiert, als dass sich eine Religiosität abseits ihrer geschichtlichen Herausforderungen sicher wähnen konnte. Bereits damals hatte sich kollektives Unheil als der schmerzhafte Boden erwiesen, an dem sich die theologischen Menschen- und Weltbilder neu justieren mussten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!