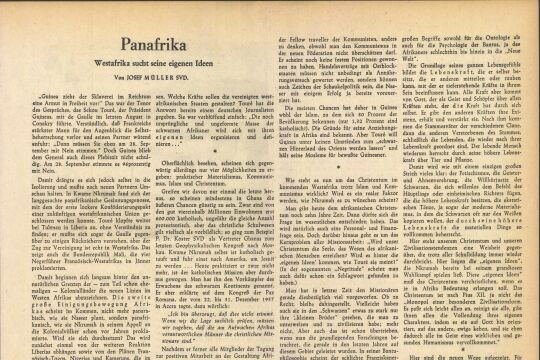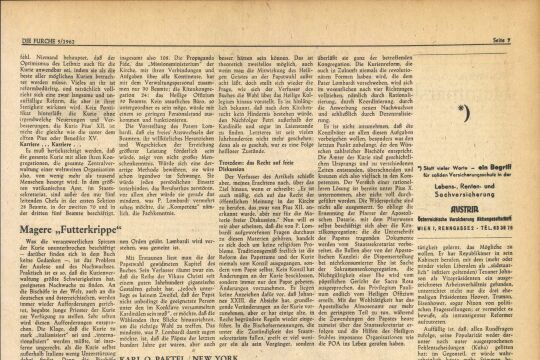Der größte Sohn Afrikas kehrt heim – aber nur für einen Tag. Eine Enttäuschung für den Kontinent, der sich mehr als andere über Obamas Präsidentschaft freut, mehr als andere davon erwartet.
Der Reisekalender von Barack Obama lässt sich auch als Messlatte für die internationale Bedeutung und amerikanische Wertschätzung dieser und jener Weltregion bzw. Organisation lesen. Und da bleibt nach Moskau und G8-Gipfel eben nur eine eintägige Zwischenlandung in Afrika übrig. Enttäuschend. Der größte Sohn Afrikas kehrt heim – und muss gleich wieder weg. Auch im Weißen Haus ist man damit nicht zufrieden.
Das Obama-Büro hätte gern eine große Afrika-Reise organisiert, schreibt die New York Times, in der Art von Obamas Heimkehr-Tour als US-Senator 2006. Doch der volle Terminkalender lässt bloß eine Stippvisite zu. „Wir haben nur begrenzte Zeit“, sagt einer von Obamas Senior Officials, „und wir haben versucht, aus dieser begrenzten Zeit das meiste herauszuholen.“ Deswegen landet die Air Force One auch in Ghana, und nicht in Kenia, das als Herkunftsland von Obamas Vater mit dieser Ehre gerechnet hat. Doch das Weiße Haus rechnet anders: Nach der vermurksten Wahl und den schweren Unruhen im letzten Jahr ist Kenia als Afrika-Destination ausgeschieden.
Ghana als demokratisches Vorzeigemodell
Obama will mit seinem ersten Besuch als US-Präsident in Afrika (sein Auftritt in Kairo wird nicht dazugezählt) ein Zeichen setzen. Seine ersten Schritte auf dem schwarzen Kontinent sollen zeigen, in welche Richtung er Afrika voranschreiten sehen will. Und da bietet sich das demokratische Vorzeigemodell Ghana am besten an. Oder wie es der Senior Official ausdrückt: „Ghana bietet uns die Möglichkeit, diese wichtigen Werte von Demokratie und guter Regierungsführung besser zu bewerben.“
Bei seiner Angelobung hat Obama die korrupten Politiker kritisiert, die auf der „falschen Seite der Geschichte“ stehen. In Afrika fand das viel Beifall. Auch in Ghana, wo Obamas Appell für Bescheidenheit, Arbeit und Pflichtbewusstsein auf offene Ohren stieß. So empörten sich viele darüber, dass Ex-Präsident John Kufuor der Abschied aus dem Amt mit zwei Häusern, sechs Wagen samt Chauffeur und einem großzügigen steuerfreien Reiseetat versüßt wurde. In den meisten Staaten Afrikas ist Obama eine Lichtgestalt im Vergleich zu den eigenen Politikern, die ihre Völker unterdrücken und mit Verschwendung, Vetternwirtschaft und Korruption ihren Ländern den Weg in eine bessere Zukunft versperren.
Mit seinem Versprechen an die armen Nationen, „die Farmen erblühen und sauberes Wasser fließen zu lassen“, hat er große Hoffnungen auf eine effektivere US-Entwicklungspolitik geweckt. Und für das kollektive Selbstbewusstsein der Afrikaner, die ihren Kontinent nicht immer als Quelle für Krisennachrichten sehen wollen, ist Obama ebenfalls inspirierend. „Die schwarze Rasse, Afroamerikaner oder Afrikaner, werden nie wieder als Sklavenrasse angesehen“, jubelt die Uganderin Evely Babnao in einem Internetforum. „Der Sohn Afrikas hat die Welt für immer verändert.“
Die kenianische Journalistin Priscah Edith Awino von der Zeitung Daily Nation widerspricht. Anstatt in Obama die Lösung aller Probleme zu sehen, sollten die Afrikaner lieber ihre eigenen Obamas finden, fordert sie: Seine Wahl „sollte uns inspirieren, die Institutionen aufzubauen, die Führungspersönlichkeiten hervorzubringen, die Obamas größte Stärken aufweisen – seine würdevolle Haltung, sein Wissen und seinen Tiefgang“.
Im halben Jahr seiner Amtszeit hat Obama seine Haltung zu Afrika bereits skizziert – und dabei deutet sich keine Revolution an. Eine Mischung aus Finanzhilfen, Aids-Bekämpfung, Förderung des Unternehmertums und Hilfe zur Selbsthilfe will der US-Präsident bieten. Bis zum Ende seiner ersten Amtszeit möchte er die Entwicklungshilfe von 25 auf 50 Milliarden Dollar erhöhen. Welche Länder und Kontinente davon profitieren, ist noch unklar. Afrika wird angesichts der Probleme im Nahen Osten, im Irak, in Pakistan, Afghanistan … kämpfen müssen, um eine vordere Stelle auf der Tagesordnung des Präsidenten einzunehmen – siehe die Reihung im Reisekalender.
Obamas größter Vorteil in Afrika ist aber, dass er dort anders als seine Vorgänger auftreten kann. Seine Äußerungen und Handlungen gegenüber Afrika erhalten mehr Aufmerksamkeit und Gewicht, denn niemand kann ihn als weißen arroganten Vertreter des Westens zurückweisen. Auch ein Obama wird keine Diktatoren zum Rückzug bewegen können, aber sein Vorbild und seine Fürsprache könnten den Demokratie-Aktivisten auf dem Kontinent Rückenwind verleihen. „Vielleicht kann mein Bruder nicht direkt die Entwicklung jedes Dorfes beeinflussen“, sagt Obamas Halbbruder Abongo Malik Obama im kenianischen Kogelo. „Aber es gibt Dinge, für die er steht. Und es werden die Leute sein, die an diese Dinge glauben, die Schritte unternehmen werden, um die Lebensbedingungen zu verbessern.“
Wiedersehen bei der Fußball-WM 2010?
Das Image der USA ist in Afrika laut Umfragen auffallend gut. Amerika gilt als demokratisch, großzügig und offen für Einwanderer. Auf einem Kontinent, wo Wahlniederlagen oft in Kriegen enden, wurde auch die Haltung John McCains bewundert, seine Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl sofort anzuerkennen. „Wenn Amtsinhaber in Afrika eine Niederlage akzeptierten und so würdevoll auf die Macht verzichteten, dann wäre das ein anderer Kontinent“, sagt der simbabwische Oppositionspolitiker Tendai Biti. „Die amerikanischen Werte machen Amerika aus“, meint wiederum Wafula Okumu vom südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien. „Wenn die Amerikaner Afrika diese Werte beibringen, dann kann das dem Kontinent viel mehr Gutes tun, als einfach Geld zu überweisen.“
Obama wird das eine tun und das andere nicht lassen dürfen. Und spätestens in einem Jahr will er wiederkommen. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, hat FIFA-Präsident Joseph S. Blatter angekündigt – mit der Einschränkung: „Wenn es sein Terminkalender erlaubt.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!