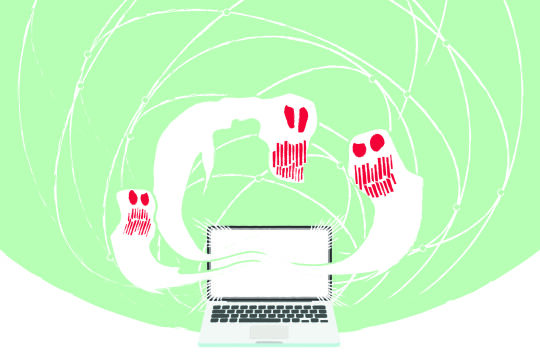Wo liegen die Wurzeln der RADIKALISIERUNG?
Public-Health-Experten präsentieren eine provokante These: Demnach könnten die Anti-Terror-Maßnahmen der USA das Risiko für weitere Terrorattacken eher gesteigert als verringert haben.
Public-Health-Experten präsentieren eine provokante These: Demnach könnten die Anti-Terror-Maßnahmen der USA das Risiko für weitere Terrorattacken eher gesteigert als verringert haben.
Terrorismus ist wie eine mörderische Saat: Aus ihr sollen Angst und Panik, nagende Unsicherheit und ein Gefühl ständiger Verletzlichkeit erwachsen -nicht zuletzt die unheilvolle Frucht der Zwietracht. Man könnte den Terror auch mit einem pathologischen Geschehen vergleichen, wie wenn eine Gesellschaft mit einer bösartigen Krankheit zu kämpfen hat. Denn Terroranschläge und schwerwiegende Erkrankungen führen nüchtern besehen zu einer ähnlichen Bilanz, geprägt durch vorzeitige Todesfälle, Stress und psychische Folgen, darunter Depressionen, Angst- oder posttraumatische Störungen. Wie eine Krankheit beeinträchtigt der Terror die Lebensqualität und zieht wirtschaftliche Verluste nach sich. Der Blick der Medizin beschränkt sich heute meist nur darauf, auf die desaströsen Folgen von Terrorattentaten zu reagieren. Eine präventive Sichtweise fehlt bislang. Aber ist es überhaupt möglich, Terroranschlägen vorzubeugen -so wie bestimmte Krankheiten durch Impfungen oder einen gesunden Lebensstil verhindert werden können?
Faktoren der Terroranfälligkeit
Héctor Alcalá und seine Kollegen dämpfen die Erwartungen: Ein ärztlich verordnetes Maßnahmenpaket zur "Terrorismus-Prävention" wird es leider nicht geben, schreiben die US-Gesundheitsforscher gleich zu Beginn einer aktuellen Studie im Fachjournal Health Equity. Terrorattacken sind letztlich unvorhersehbar. Doch es sei höchst an der Zeit, nach potenziellen Risikofaktoren für terroristische Aktivitäten Ausschau zu halten -so wie aus Sicht der öffentlichen Gesundheit (Public Health) Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen identifiziert werden können. Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses; insbesondere dann, wenn mehrere dieser Faktoren zusammenwirken. Ein großer Bauchumfang und geringe körperliche Betätigung etwa begünstigen die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes. Was aber begünstigt die Anfälligkeit für extremistische Ideologien und gewaltbereite Radikalisierung, aus denen der islamistische Terror erwächst?
In der Medizin hat sich heute ein ganzheitliches Modell durchgesetzt, in dem Risikofaktoren auf drei Ebenen beschrieben werden - in einer biologischen, psychologischen und gesellschaftlichen Dimension. "Bio-psycho-sozial" lautet so ein umfassendes Verständnis im Fachjargon. Analog dazu hat auch die Neigung zu terroristischen Aktivitäten diese drei Dimensionen: So sind es vorwiegend junge Männer, die anfällig für riskante Verhaltensweisen und religiös überhöhte Gewalttaten sind (Biologie). Oft handelt es sich um Menschen mit Problemen bei der Identitätsfindung, instabilen Persönlichkeitsstrukturen, einer zerrütteten Gefühlswelt und mangelnden Empathiefähigkeit (Psychologie). Gut möglich, dass sie familiäre Konflikte und Trennungen durchlitten, dass sie Jobverlust oder der Tod eines geliebten Menschen schwer getroffen haben.
Und meist sind es Personen, die einer sozial benachteiligten Schicht oder Gruppe entstammen (Gesellschaft). Sie fühlen sich oft ohnmächtig, gekränkt und hoffnungslos. Deshalb neigen sie dazu, dem Heroismus und Größenwahn einer gewaltverherrlichenden Ideologie auf den Leim zu gehen.
Die Public-Health-Experten um Héctor Alcala widmen sich vor allem der gesellschaftlichen Dimension und beleuchten die wissenschaftliche Literatur zum Thema, um auf Risikofaktoren der Radikalisierung schließen zu können. Der Fokus liegt auf der amerikanischen Situation nach den Terroranschlägen von 9/11 (2001): Seitdem seien Hassreden gegen Muslime in den USA viel stärker verbreitet; Hassverbrechen gegen diese Bevölkerungsgruppe traten fünfmal häufiger auf als zuvor, so Alcalá und Mitarbeiter.
Analogie zu Bandenkriminalität
Zudem werden muslimische Bürger vonseiten der US-Regierung überwacht, und gerade die aktuelle Einwanderungspolitik unter Präsident Donald Trump sorge dafür, dass Immigranten aus dem Nahen Osten primär als potenzielle Terrorbedrohung wahrgenommen werden. Viele dieser Einwanderer erfahren dann mangelnden Zugang zu essenziellen Dienstleistungen. All das seien Gründe für die Diskriminierung von amerikanischen Muslimen und eingewanderten Arabern, so die Studienautoren.
Dass Diskriminierung nicht gesund ist, geht aus einer Fülle an Studien hervor: Sie erhöht das Stressniveau und damit auch das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen. Ebenso führt Diskriminierung zur Vernachlässigung der Gesundheitsvorsorge und begünstigt schädliche Verhaltensweisen, zum Beispiel Drogenmissbrauch. Chronischer Stress kann den sozialen Zusammenhalt unterminieren, der wiederum als wichtig für die Gesundheit und die Gewaltprävention angesehen wird. Je besser der soziale Zusammenhalt, je größer die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Gruppen einer Gesellschaft, desto geringer ist das Risiko für Herzkreislauf-,Krebsund sogar Infektionskrankheiten in der Allgemeinbevölkerung. Umgekehrt sind Suizid und kriminelle Handlungen in vielen Studien mit einem geringen sozialen Zusammenhalt assoziiert. Insofern könnte auch das Risiko suizidaler Terrorattacken mit einem geringen Ausmaß an sozialer Kohäsion in Zusammenhang stehen, folgern die Studienautoren.
Die Gesundheitsforscher zitieren Erkenntnisse zur Bandenkriminalität, da dieses Phänomen in vielerlei Hinsicht mit dem Terrorismus vergleichbar ist. Wie auch Terrororganisationen adressieren gewaltbereite Gangs eine Zielgruppe aus vorwiegend jungen Männern, die nur geringe sozioökonomische Möglichkeiten haben. Der Anschluss an diese Gruppen wird von marginalisierten Männern als Mittel gesehen, um Macht und Einfluss zu gewinnen.
Prävention von Bandenkriminalität, die vorwiegend auf polizeilichen Maßnahmen basiert, hat sich laut Studienergebnissen nicht bewährt. Hingegen scheinen lokale Ansätze mit Jugendarbeit und Gemeinschaftsprogrammen viel versprechend zu sein. Analog dazu könnten die Anti-Terrormaßnahmen in den USA das Risiko für weitere Terrorattacken eher gesteigert als verringert haben, argumentieren die Autoren. Denn die Anti-Terror-Politik der USA führe im großen Maßstab zur Diskriminierung von Muslimen, was wiederum negativ auf den sozialen Zusammenhalt in muslimischen Gruppen zurückwirkt. Manche Muslime werden dabei marginalisiert, eine kleine Minderheit könnte dadurch anfälliger für eine ideologische Radikalisierung werden. Und einige wenige davon könnten vielleicht tatsächlich zu Terroranschlägen motiviert werden. "Die US-Regierung reagiert auf Terrorattacken mit einer Anti-Terror-Politik, die Diskriminierung begünstigt und somit den Teufelskreis fortführt", meinen Héctor Alcalá und seine Kollegen. Was aber wäre dann ihr Rezept gegen diese Bedrohung?
Bridging und Bonding
Anti-Terror-Ansätze müssten primär Exklusion und Marginalisierung bekämpfen, so die Autoren, am besten durch Förderung von sozialen Netzwerken. Bindungen zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Gruppen sollten unterstützt werden ("Bridging"), ebenso wie Bindungen zwischen den Muslimen ("Bonding"). Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, sollten Menschen mit unterschiedlichem religiösen und politischen Hintergrund eingebunden werden. Das soll verhindern, dass Individuen in den gefährlichen Sog extremistischer Gruppierungen geraten.
Die Botschaft des Studienreviews ist im Endeffekt simpel: Besser als rein symptomatische Therapien sind Ansätze, die danach trachten, der giftigen Saat des Terrors den Nährboden zu entziehen.