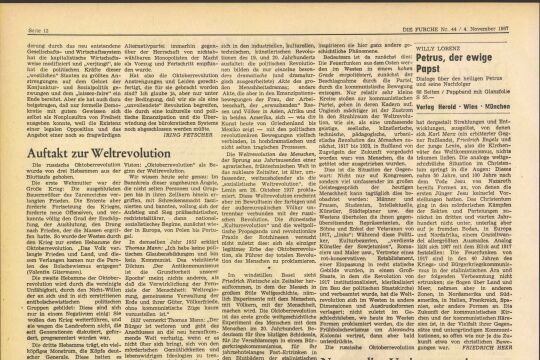Sommer 1989
Was ist eine Generation später aus den Erwartungen und Hoffnungen von damals geworden?
"Europa steht vor einer Phase beschleunigten, tiefgreifenden und umfassenden institutionellen Wandels, der sich rückblickend, ähnlich wie 1989, als historische Zäsur erweisen könnte."
Sommer '89" heißt ein aktuelles Lied der deutschen Rockband "Kettcar", das in den vergangenen Wochen öfters im Radio zu hören war. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der im August 1989 in seinem "alten himmelblauen Ford Granada" von Hamburg ins Burgenland fährt und mit einem Bolzenschneider Löcher in den Grenzzaun nach Ungarn schneidet, um drei Familien aus der DDR zur Flucht zu verhelfen.
Nach der Rückkehr an seinen Hamburger WG-Küchentisch muss der Fluchthelfer sich die Kritik seiner Freunde anhören, die wie er offenbar politisch links stehen. Sie werfen ihm vor, seine "Aktion" sei zwar "menschlich verständlich, aber trotzdem falsch" gewesen, denn sie trage zur Destabilisierung des Ostblocks bei und damit womöglich zur deutschen Wiedervereinigung. Das jedoch wäre "ein großer Fehler". Nach langer Diskussion nimmt der junge Mann wütend seine Jacke, setzt sich in seinen alten Ford "und ward nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte."
Der Rocksong, den man auch als Beitrag zum Migrationsdiskurs verstehen darf, entführt seine Zuhörer in die aufgeheizte Atmosphäre des Sommers vor der Wende von '89, als die große politische Umwälzung bereits in der Luft lag. Er ruft die Hoffnungen und Ängste jener Umbruchszeit in Erinnerung. Was ist eine Generation später aus all den Hoffnungen und Ängsten geworden?
Löcher in die ideologischen Zäune
Der polnische Philosoph Krzysztof Michalski handelte einst ähnlich unbekümmert wie der junge Mann in dem Lied. Er gründete in Wien das Institut für die Wissenschaften vom Menschen, mit dem Ziel, Löcher in die ideologischen Zäune des Kalten Krieges zu schneiden: Der Rest ist Geschichte. Seither arbeitet das Institut, das im November sein 35-jähriges Bestehen feierte, auf der politischen Dauergroßbaustelle eines geeinten und freien Europa mit, unter anderem durch die Herausgabe der Zeitschrift: Transit, die heuer zum fünfzigsten - und letzten -Mal erschien.
Dass Transit das Erscheinen einstellt, ist an sich schon ein Statement: Es deutet darauf hin -wie auch der von Heinrich Mann geliehene Titel der letzten Ausgabe: "Ein Zeitalter wird besichtigt" -, dass Europa nach fast 30 Jahren wieder einmal vor einer Schwelle steht. Vor einer Phase beschleunigten, tiefgreifenden und umfassenden institutionellen Wandels, der sich rückblickend, ähnlich wie 1989, als historische Zäsur erweisen könnte.
Die Vision einer liberalen politischen Ordnung, die Marktwirtschaft mit Demokratie verbindet und die in den Neunzigerjahren derart alternativlos schien, dass manche das "Ende der Geschichte" proklamierten, hat viel von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Sie ist an vielen Fronten in die Defensive geraten, gerade auch in den osteuropäischen Staaten, die nach dem Umbruch von 1989 ihr Heil in dieser Vision gesucht hatten. Wo einst die Parole lautete: "Rückkehr nach Europa!", wenden sich die Menschen heute scharenweise von der EU ab.
Europa kein Leitstern mehr
Daher überrascht es nicht, dass die Autoren der letzten Nummer von Transit eine eher düstere Bilanz ziehen. Der Journalist Maxim Trudolyubov stellt fest, "dass Europa -vielleicht zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten -aufgehört hat, für die russische Gesellschaft ein Leitstern zu sein, wie fern auch immer". Aus der Sicht des ungarischen Ökonomen János Mátyas Kovács hat die Regierung seiner Heimat 2010 "die rechtsstaatliche Option über Bord" geworfen. "Sie wurde ersetzt durch einen staatlichen Kollektivismus, verpackt in einen nationalistischen und rassistischen Diskurs, gefärbt durch antikolonialistisches Selbstmitleid." "Östlichkeit" wurde zur neuen Tugend. Dass auch Tschechiens "verfassungsmäßige Ordnung untergraben wird", fürchtet der Jurist Jir í Pr ibán , falls - nach dem Wahlerfolg von Andrej Babis - Milos Zeman als Sieger aus den nächsten Präsidentenwahlen hervorgeht.
Interessanterweise haben die Herausgeber keine polnische Stimme gefunden, die die Verhältnisse in Polen ähnlich schonungslos beim Namen nennt. Der einzige polnische Autor des Hefts, der Ökonom Pjotr Kory´s, erzählt die kapitalistische Transformation in Polen als alternativlose Erfolgsgeschichte und hofft tapfer, dass sein Land in einer Generation zum Westen aufgeschlossen haben wird. Mit diesem Optimismus steht er allein auf weiter Flur, sieht es doch eher danach aus, als würde nun der Osten dem Westen voranmarschieren. Putin und Orbán sind Vorreiter einer kollektiven Rückwendung zur Nation als kämpfender Schicksalsgemeinschaft, die auch in Westeuropa immer mehr lautstarke Anhänger findet. So sehen denn auch manche Alteuropäer schwarz: Der Historiker Timothy Garton Ash beobachtet einen "atemberaubenden Wechsel vom Licht zur Finsternis", während sein Kollege Karl Schlögl die Melancholie als Antrieb der Geschichtsschreibung entdeckt.
Nimmt man die im letzten Transit-Heft versammelten Aufsätze als Indikator, dann sind die Illusionen und Befürchtungen von 1989 verblichen, um neuen Ängsten Platz zu machen. Während sich die Protagonisten und Kinder der Wende ernste Sorgen um die Zukunft der liberalen Gesellschaft machen, greift in Europa "demographische Panik" um sich. So nennt der bulgarische Politologe Ivan Krastev die Furcht vor dem "ethnischen Verschwinden" in einer Welt, "in der Migration nach Europa die neue Form der Revolution ist". Diese Furcht lasse den zentralen Bezugspunkt der Demokratie in Osteuropa -die Erinnerung an den Kommunismus -verblassen und andere, exklusive Identitäten in den Vordergrund treten: Die Demokratie, weit entfernt davon, nur ein "Mechanismus der Inklusion" zu sein, wird "konterrevolutionär".
Nun ist Panik ein starkes Gefühl, das in Extremsituationen seinen biologischen Sinn haben mag, das aber kaum zur Beschreibung kollektiver Stimmungen taugt, die über Monate oder gar Jahre anhalten. Man sollte eher von einem Angstsyndrom sprechen, das ebenso reale Anlässe hat, wie es von interessierter Seite geschürt wird. Dieser Angst auf den Grund zu gehen, ist alles andere als leicht. Noch weniger leicht scheint es, ihr auf politischer Ebene wirksam entgegenzutreten.
Ernsthafte Kritik des Liberalismus
Wem die offene Gesellschaft am Herzen liegt, der oder die wird um eine ernsthafte Kritik des Liberalismus nicht herumkommen, wie sie etwa der Politikwissenschaftler Pavel Barsa versuchsweise anhand der Ikone Václav Havel unternimmt. Dessen Werdegang verkörpere "die Transformation von einer emanzipatorischen Menschenrechtsutopie zu einer reaktionären Verteidigung des (neo-)liberalen Kapitalismus und des amerikanischen globalen Imperiums". In ein ähnliches Horn scheint Jacques Rupnik zu stoßen, wenn er fragt, "ob die liberalen Ex-Dissidenten die 'nützlichen Idioten' des Übergangs zum Kapitalismus waren". Was ist von einem Liberalismus zu halten, der militärische Interventionen unter dem Deckmantel der Humanität gutheißt, aber die soziale Frage für obsolet erklärt? Mit anderen Worten: Auch der Liberalismus neigt dazu, einmal an der Macht, seine demokratischen Ideale zu verraten, heute nicht anders als im 19. Jahrhundert. Damit bietet er antiliberalen Angriffen eine offene Flanke. Der Rest ist Geschichte.
All das ist jedoch kein Grund, in Fatalismus zu verfallen. "Leben und Geschichte fliegen nicht ohne unser Zutun dahin wie ein Karussell, das man besteigen und nach einer Weile wieder verlassen kann", zitiert Marci Shore, in Yale lehrender Historiker, Krzysztof Michalski und erinnert uns an die Macht jedes Einzelnen und die Verantwortung, die sich daraus ergibt: die Geschichte durch unser Tun mitzugestalten. Denn wie sagte der 2013 verstorbene Michalski: "Geschichte ist nur als unsere Geschichte real, sie geschieht nur in unserem Tun." Manchmal ist nur ein Bolzenschneider nötig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!