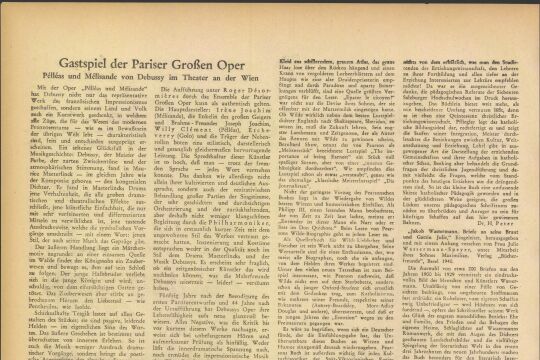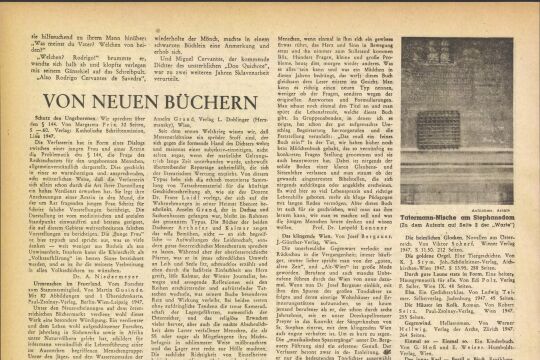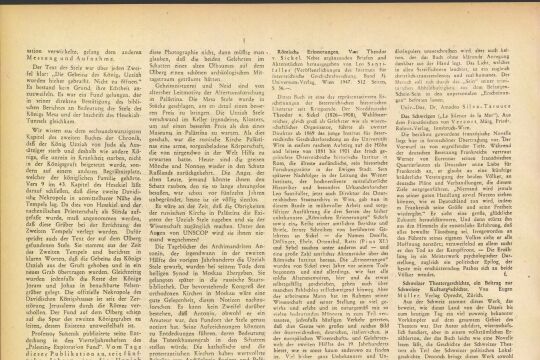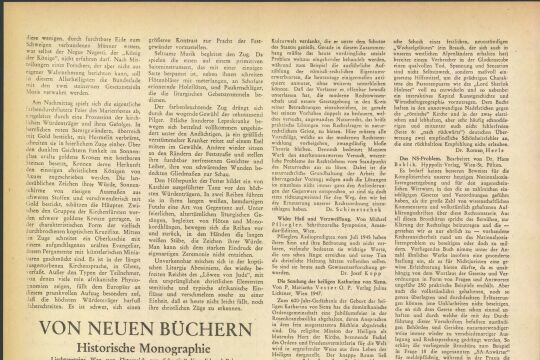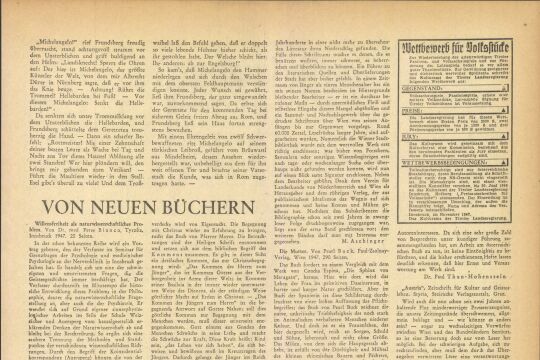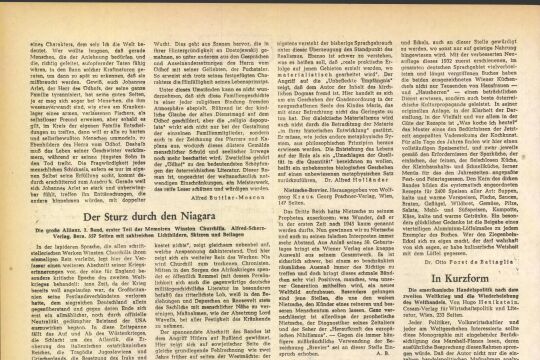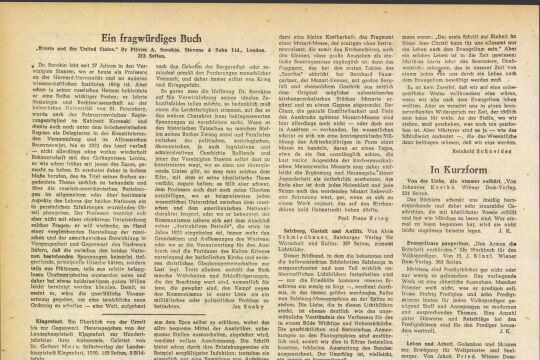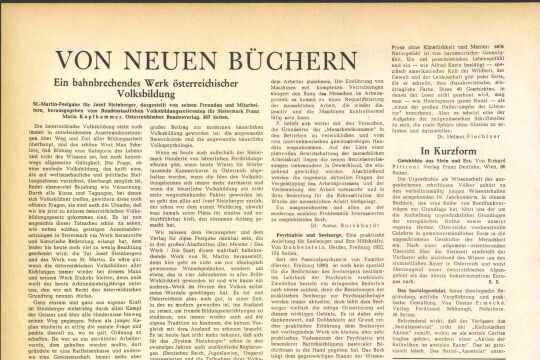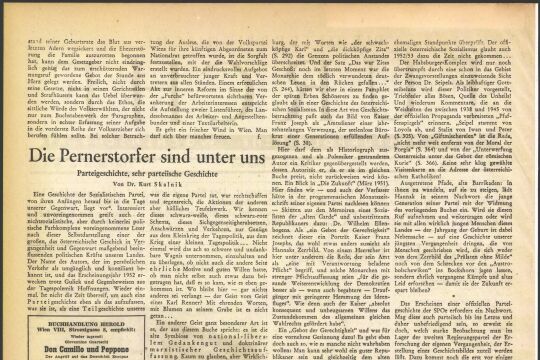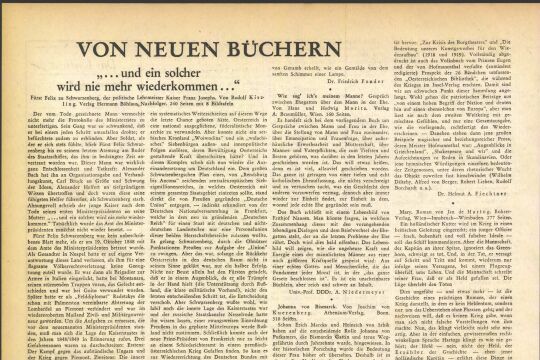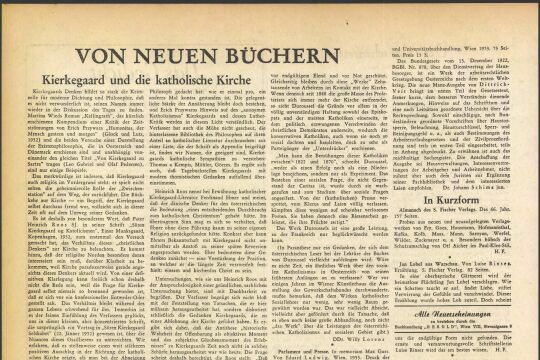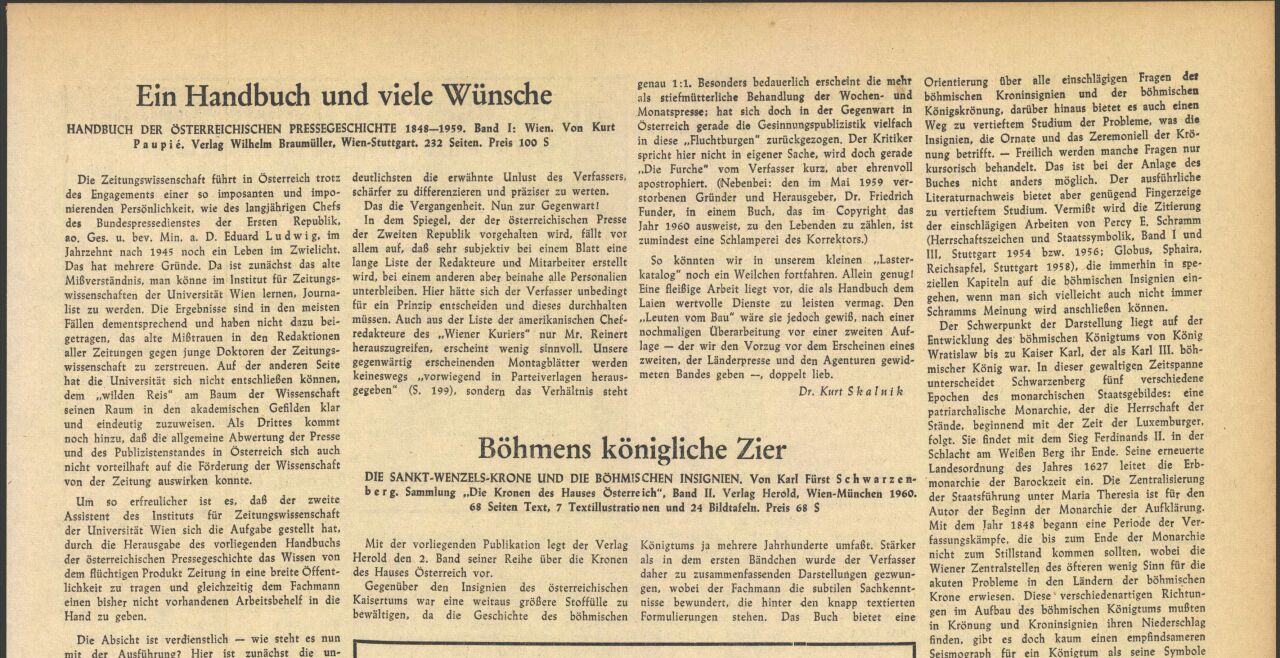
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Handbuch und viele Wünsche
Die Zeitungswissenschaft führt in Österreich trotz des Engagements einer so imposanten und imponierenden Persönlichkeit, wie des langjährigen Chefs de Bundespressedienstes der Ersten Republik, ao. Ges. u. bev. Min. a. D. Eduard Ludwig, im Jahrzehnt nach 1945 noch ein Leben im Zwielicht. Das hat mehrere Gründe. Da ist zunächst das alte Mißverständnis, man könne im Institut für Zeitungswissenschaften der Universität Wien lernen, Journalist zu werden. Die Ergebnisse sind in den meisten Fällen dementsprechend und haben nicht dazu beigetragen, das alte Mißtrauen in den Redaktionen aller Zeitungen gegen junge Doktoren der Zeitungswissenschaft zu zerstreuen. Auf der anderen Seite hat die Universität sich nicht entschließen können, dem „wilden Reis“ am Baum der Wissenschaft seinen Raum in den akademischen Gefilden klar und eindeutig zuzuweisen. Als Drittes kommt noch hinzu, daß die allgemeine Abwertung der Presse und des Publizistenstandes in Österreich sich auch nicht vorteilhaft auf die Förderung der Wissenschaft von der Zeitung auswirken konnte.
Um so erfreulicher ist es, daß der zweite Assistent des Instituts für Zeitungswissenschaft der Universität Wien sich die Aufgabe gestellt hat, durch die Herausgabe des vorliegenden Handbuchs der österreichischen Pressegeschichte das Wissen von dem flüchtigen Produkt Zeitung in eine breite Öffentlichkeit zu tragen und gleichzeitig dem Fachmann einen bisher nicht vorhandenen Arbeitsbehelf in die Hand zu geben.
Die Absicht ist verdienstlich — wie steht es nun mit der Ausführung? Hier ist zunächst die ungeheure Schwierigkeit festzuhalten, die einem Vorhaben, das auf 232 Seiten angelegt ist und Auskunft über ein Jahrhundert Pressegeschichte in der österreichischen Metropole geben will, entgegenstehen. Da ist außerdem die Frage der Methode. Wie lege ich Schneisen durch den Dschungel von Papier, Papier, Papier ... Kurt Paupie wählt nach einem recht umfangreichen Überblick über die politische und presserechtliche Entwicklung die Einteilung nach dem „klassischen“ Schema: Offizielle Presse, Großpresse, Politische Presse, Boulevardpresse usw. Die Gefahr, daß wir auf diesem Weg einer publizistischen Eintagsfliege von Anno Tobak neben einer einflußreichen Zeitung unserer Tage begegnen, ja daß die Presse der Gegenwart dadurch, zumindest optisch, ins Hintertreffen gerät, ist groß. Der Rezensent hätte, der Übersichtlichkeit zuliebe, einer historischen Gliederung, die durch die Großräume Monarchie, Erste Republik (das Sterben der österreichischen Presse im Dritten Reich mit eingeschlossen) und Zweite Republik gegeben erscheint, den Vorzug eingeräumt.
Aber nicht nur das allein: Bei voller Würdigung der Leistungen Paupies bei der „Erschließung“ eines ' „unterentwickelten Gebietes“ der Wissenschaft und bei vollem Wissen um die Schwierigkeiten, die dieser Arbeit von Anfang an entgegenstanden, gebietet es jedoch das Gesetz der Wissenschaft und die dem durch manche gemeinsame Arbeit verbundenen Kollegen geschuldete Freimütigkeit, einen kleinen Katalog von Wünschen aufzustellen, da und dort einige Fehlurteile zurechtzurücken und an anderer Stelle Kurzschlüsse zu beheben.
Wunsch Nr. 1 gilt einer strafferen Selbstdisziplin des Schreibers Paupie. Seine Darstellung erleidet vielfach unnötigerweise durch stilistische Verschwommenheiten und mangelnde Präzision des Ausdrucks Einbußen. Ein kleines sprachliches Monstrum wie jenes, dem wir auf Seite 22 begegnen: „War es auch deprimierend, daß sich die Situation in Wien in dieser Weise ergab...“, ist leider kein konkurrenzloses Unikat. Von der zuwenig in die Zucht genommenen Sprache zu unklaren politischen Definitionen ist es aber nicht weit. So treffen wir in der überflüssig ausgedehnten Nacherzählung der politischen Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart manche Schiefheiten, die nicht zuletzt auf die schon oben erwähnte mangelnde Präzision des Ausdrucks gehen. Nur einige wenige Beispiele; Der Satz: „Wenige Jahre später führt er die Opposition der Demokraten, bald aber rief er, als er die Zugkraft des von Georg von Schönerer aufgestellten, Linzer Programms sah, eine neue antisemitische Partei ins Leben, die Christlichsoziale Partei“ (Seite 21), wird wohl dem Leben und Wirken Luegers kaum gerecht. Vom Parteileben der Ersten Republik aber zu sagen, es „beschränkte sich im Grunde auf drei Parteien (S. 34), ist wohl genau so unpräzise, wie die Auslöschung Österreichs von der Landkarte als „Märzereignisse des Jahres 1938“ (S. 100) zu umschreiben. In der Klarheit liegt die Wahrheit I
Mit den „Katholika“ hat der Verfasser, trotzdem er keineswegs unfreundlich gesinnt ist, einige liebe Not. Das Wort „klerikal“, dem wir sehr oft für sehr verschiedene Begriffe in dem vorliegenden Buch begegnen (S. 7, 10, 21, 34, 35, 83, 84), dürfte, genau genommen, in eine ernste wissenschaftliche Publikation des Jahres 1960 überhaupt nicht Eingang finden. Auch hätten wir bei Paupies Kenntnis von der geistespolitischen Entwicklung der letzten 50 Jahre in Österreich ein Kapitel unter dem Titel „Die katholische, christlichsoziale und ÖVP-Presse“ (S. 94) nicht erwartet. Am Beispiel der Geschichte des „Kleinen Volksblattes“, das Paupie von seiner Gründung bis zur Gegenwart, selbst mit Einschluß der NS-Zeit, als ein Blatt (S. 103 f.) behandelt, statt es als drei Blätter, die kaum mehr als den Titel gemeinsam haben, aufzufassen, zeigt sich vielleicht am deutlichsten die erwähnte Unlust des Verfassers, schärfer zu differenzieren und präziser zu werten.
Das die Vergangenheit. Nun zur Gegenwart!
In dem Spiegel, der der österreichischen Presse der Zweiten Republik vorgehalten wird, fällt vor allem auf, daß sehr subjektiv bei einem Blatt eine lange Liste der Redakteure und Mitarbeiter erstellt wird, bei einem anderen aber beinahe alle Personalien unterbleiben. Hier hätte sich der Verfasser unbedingt für ein Prinzip entscheiden und dieses durchhalten müssen. Auch aus der Liste der amerikanischen Chefredakteure des „Wiener Kuriers“ nur Mr. Reinert herauszugreifen, erscheint wenig sinnvoll. Unsere gegenwärtig erscheinenden Montagblätter werden keineswegs „vorwiegend in Parteiverlagen herausgegeben“ (S. 199), sondern das Verhältnis steht genau 1:1. Besonders bedauerlich erscheint die mehr als stiefmütterliche Behandlung der Wochen- und Monatspress; hat sich doch in der Gegenwart in Österreich gerade die Gesinnungspublizistik vielfach in diese „Fluchtburgen“ zurückgezogen. Der Kritiker spricht hier nicht in eigener Sache, wird doch gerade „Die Furche“ vom Verfasser kurz, aber ehrenvoll apostrophiert. (Nebenbei: den im Mai 1959 verstorbenen Gründer und Herausgeber, Dr. Friedrich Funder, in einem Buch, das im Copyright das Jahr 1960 ausweist, zu den Lebenden zu zählen, ist zumindest eine Schlamperei des Korrektors.)
So könnten wir in unserem kleinen „Lasterkatalog“ noch ein Weilchen fortfahren. Allein genug I Eine fleißige Arbeit liegt vor, die als Handbuch dem Laien wertvolle Dienste zu leisten vermag. Den „Leuten vom Bau“ wäre sie jedoch gewiß, nach einer nochmaligen Überarbeitung vor einer zweiten Auflage — der wir den Vorzug vor dem Erscheinen eines zweiten, der Länderpresse und den Agenturen gewidmeten Bandes geben —, doppelt lieb.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!