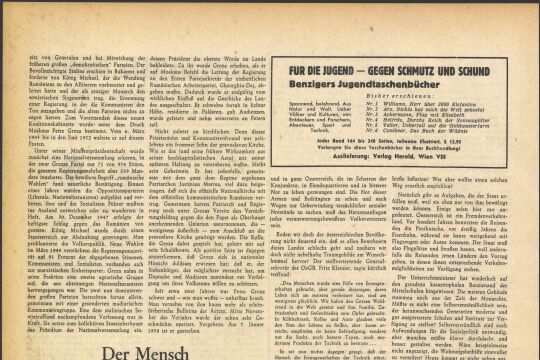Achtung, Kulturdarwinismus!
Gegen die grassierende Privatisierung von Kunst und Kultur zieht der amerikanische Kulturpolitikexperte Kevin V. Mulcahy zu Felde. Er weiß, wovon er spricht.
Gegen die grassierende Privatisierung von Kunst und Kultur zieht der amerikanische Kulturpolitikexperte Kevin V. Mulcahy zu Felde. Er weiß, wovon er spricht.
Die Furche: In Österreich und anderen europäischen Ländern ist man auf der Suche nach neuen Möglichkeiten der Förderung von Kunst und Kultur. "Weniger Staat - mehr Privat" lautet die Devise. Können die USA hier Vorbild sein?
Kevin V. Mulcahy: Im Moment herrscht bei vielen Europäern die Ansicht, dass der amerikanische Weg die Lösung ihrer Probleme sei. Ich kann die Europäer nur vor der Privatisierung warnen. Die Privatisierung des Kunstsektors führt notwendigerweise zur Kommerzialisierung und sie überprivilegiert die großen Institutionen in den Hauptstädten. Und die Entscheidungsgewalt geht aus den Händen der Regierung in die Hände von Privatpersonen und kommerziellen Unternehmen über.
Die Furche: Wie sieht denn das amerikanische System aus?
Mulcahy: Erstens: Nur zehn Prozent der Gelder für Kultur kommen von der öffentlichen Hand. Die finanziellen Hauptquellen sind Wohltätigkeit, also Unterstützung durch Stiftungen oder Einzelpersonen, und Einkünfte durch Eintritt oder Souvenir-Shops. Zweitens: Auf nationaler Ebene macht Kultur nur 0,01 Prozent des Budgets aus - wenn man alles mitrechnet, also zum Beispiel Geld für den öffentlichen Rundfunk oder für Geisteswissenschaften. Das Budget der NEA (National Endowment for the Arts), die für Kunst im engeren Sinn zuständige Bundesbehörde, macht nur 0,001 Prozent des Budgets aus. Es sind die lokalen Behörden, vor allem die Städte, die Millionen Dollar für Kultur ausgeben.
Die Furche: Habe ich richtig gehört? Ein Tausendstel eines Prozents?
Mulcahy: 1995 betrug das NEA-Budget 162 Millionen Dollar. Heute sind es nur noch 98 Millionen Dollar. Die Republikaner, die die Mehrheit im Kongress haben, wollten die NEA ganz abschaffen, nur durch diese radikale Kürzung konnte die Clinton-Regierung sie überhaupt retten. Das zweite Zugeständnis, das die regierenden Demokraten an die Republikaner machen mussten, war die Abschaffung von Subventionen für einzelne Künstler. "Diese verdammten Künstler, die uns immer nur Scherereien machen, sollen kein Geld mehr bekommen", meinten die Republikaner - und nun bekommt kein Künstler mehr finanzielle Unterstützung vom Bund.
Die Furche: Das wäre hierzulande unvorstellbar ...
Mulcahy: Die amerikanische Haltung lautet: Wenn Du Kunst machst, dann verkauf' sie. Und wenn Du sie nicht verkaufen kannst, dann ist sie nichts wert. In den USA wird Kultur als Unterhaltung betrachtet. Ob man sich einen Hollywoodfilm im Kino ansieht oder in eine Oper von Richard Wagner geht - für den Durchschnittsamerikaner ist das dasselbe. Hochkultur gilt als Unterhaltung für Reiche.
Die Furche: Welche Auswirkungen hat diese Mentalität und die daraus folgende Politik auf die amerikanische Kulturlandschaft?
Mulcahy: Ich verwende gerne den provokanten Begriff "Kulturdarwinismus"; ich meine damit eine Art Vulgärdarwinismus, denn mit Darwin hat das wenig zu tun. Es herrscht ein Krieg von allen gegen alle um private Gelder. Dadurch verkommt Kultur zur Ware - sie wird populär, zugänglich, liebenswert - kurz: kommerziell.
Die Museen schlagen sich sehr gut in diesem Kampf ums Dasein mit ihren Blockbuster-Ausstellungen, das heißt mit Ausstellungen, die so angelegt sind, dass sie viel Geld bringen. Die sind eine sichere Bank - und fast immer impressionistisch. Die Amerikaner lieben Monet, Renoir; Picasso und Matisse gehen auch immer gut. Eine Schiele- oder Klimt-Ausstellung würden sie sich nicht ansehen, weil sie diese Künstler nicht kennen. Und weil sie sie nicht kennen, mögen sie sie nicht.
Institutionen, die danach streben, viel einzunehmen, können immer überleben. Sie werden von Touristen gestürmt und die Souvenir-Shops laufen gut. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel die Neue Galerie der Stadt Linz auf diese Weise überleben könnte.
Die grundlegende Entscheidung lautet: Vertraut man dem Markt oder dem Staat? In anderen Worten: Vertraut man das kulturelle Wohlergehen der Bürger Privatpersonen oder der öffentlichen Hand an?
Die Furche: Wie lautet Ihr kulturpolitisches Credo?
Mulcahy: Der Staat sollte helfen, den Markt zu ergänzen. Erstens: Leuten, die aufgrund ihres Wohnortes oder ihrer sozialen Herkunft keine Möglichkeit dazu haben, soll der Zugang zu Kunst erleichtert werden. Die zweite Aufgabe ist es, Vielfältigkeit zu fördern, besonders in einer so heterogenen Nation wie der amerikanischen. Die Kunst von Afroamerikanern oder Indianern kann nie kommerziell erfolgreich sein. Drittens sollte die kulturelle Infrastruktur des Landes gefördert werden. Und viertens: Kunst und Musik müßten im Schulsystem verankert werden. Schulen werden in den USA von den Gemeinden finanziert. In Beverly Hills haben sie natürlich alles, was man sich nur vorstellen kann, in einem Reservat in North Dakota gibt es fast nichts. Aber in den USA muß ich ständig argumentieren, warum es überhaupt öffentliche Subventionen geben soll.
Die Furche: Welches halten Sie für das richtige Verhältnis von Staat und Privat?
Mulcahy: Das richtige Verhältnis liegt meiner Meinung nach bei einem Viertel von der Regierung, der Hälfte durch Wohltätigkeit und einem Viertel aus Einkünften. Ich bin also für ein gemischtes System, in den USA nähern wir uns aber immer mehr einem System, das nur noch aus Wohltätigkeit und Einkünften besteht. Von wohltätigen Spendern bekommt man wunderbare Gebäude und große, prestigereiche Institutionen - etwas, womit dann für gewöhnlich ihr Name verbunden ist ... In den USA wird auch viel Aufhebens gemacht um das Prestige, das mit der Mitgliedschaft im Ausschuss von großen Kulturinstitutionen verbunden ist. Um in den Ausschuss der Metropolitain Opera zu kommen, muß man gleich einmal mindestens eine Million Dollar spenden.
Die Furche: Die New Yorker Met ist auch ein gutes Beispiel für die Gefahr, die mit der Abhängigkeit von Sponsoren verbunden ist: Nach der amerikanischen Erstaufführung der "Salome" von Richard Strauss 1907 erwirkte einer der wichtigsten Förderer des Opernhauses die Absetzung des Meisterwerkes, weil sich seine Tochter über die angebliche Amoralität des Stückes empört hatte. Es dauerte 27 Jahre, bis "Salome" dort wieder gezeigt werden konnte.
Mulcahy: Tja, Sponsoren bezahlen was ihnen gefällt ... Heute ist das Problem anderer Art: Die großen Wohltäter des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts - Familien wie die Guggenheims oder die Rockefellers - entstammten einer entsprechenden Tradition. Leute wie Bill Gates - die so genannte Babyboomer-Generation - teilen deren Interessen nicht. Die unterstützen Umwelt- oder Menschenrechtsorganisationen - lauter wichtige Dinge! - aber mit Kultur haben sie wenig am Hut. Ich glaube nicht, dass Kultur von der derzeitigen Umschichtung von Reichtum auf diese Generation profitiert.
1998 wurden in den USA 270 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Das ist phänomenal! Aber mit 45 Prozent geht das meiste der Spenden an Kirchen. Dasselbe Land, dass Hollywood, MTV und Konsumismus hervorgebracht hat, ist besessen von Religion. Dann erst kommen Spitäler, Universitäten und soziale Einrichtungen. Als letztes kommt die Kultur - und letztes Jahr haben sich diese Spenden um ein Prozent verringert. Da ist eine Schockwelle durch die Kulturinstitutionen gelaufen.
Die Furche: Ist diese "Besessenheit" auch der Grund dafür, dass es im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" immer wieder zu Kunstskandalen kommt?
Mulcahy: Immer wenn auch nur eine kleine Menge öffentlichen Geldes im Spiel ist, entsteht schnell ein Riesenaufruhr. Bei der so genannten Mapplethorpe-Affäre vor zehn Jahren wurde behauptet, dass die NEA eine Ausstellung des Fotografen Robert Mapplethorpe mitfinanziert hätte, die pornografisch sei. Von der alsbald einberufenen Untersuchungskommission wurde ich vorgeladen, um über die Rolle der staatlichen Kunstbehörden auszusagen. Die NEA hatte übrigens keinen Groschen für die umstrittenen Bilder hergegeben.
Die Furche: Das aktuellste Beispiel für den Zusammenstoß zwischen Kunst und amerikanischer Mentalität ist die Ausstellung "Sensation" im Brooklyn Museum in New York. Haben Sie diesen Skandal verfolgt?
Mulcahy: Das Brooklyn Museum ist privat, aber es liegt auf Gemeindeboden und ist mehr als die meisten anderen auf Subventionen der Stadt angewiesen, weil es nicht in Manhattan liegt, das heißt, es liegt außerhalb der Kulturbezirkes. Die einzige Möglichkeit, um die Massen aus Manhattan anzuziehen, ist eine provokante Blockbuster-Ausstellung und - keine Frage - "Sensation" wurde als solche beworben.
Stein des Anstoßes war ein Gemälde von einem nigerianisch-britischen Künstler namens Chris Ofili, einem praktizierenden Katholiken. Es hieß, Ofili hätte ein Bildnis der Jungfrau Maria mit Elefantendung besudelt. In Wirklichkeit ist in der afrikanischen Malerei mit Farbe vermischter Dung ein Symbol für Fruchtbarkeit und gilt als Ehrerbietung und nicht als Beleidigung.
Rudolph Giuliani, New Yorks Bürgermeister, befindet sich im Wahlkampf gegen Hillary Clinton, der Frau des Präsidenten - eine sehr ungewöhnliche Situation. Prompt kündigte Giuliani an, dem Museum sämtliche finanziellen Unterstützungen zu entziehen - dieses Vorhaben ist mittlerweile von einem Gericht vereitelt worden. Der Fairness halber muß man sagen, dass er sich möglicherweise in seinen religiösen Gefühlen verletzt gefühlt hatte, weil er das Werk nur vom Hörensagen kannte, aber in meinen Augen sah er das als Möglichkeit, Stimmen zu gewinnen.
Die Furche: Sind Sie angesichts eines solchen Klimas nicht gerne hier in Europa?
Mulcahy: Warum ich es so liebe, nach Europa zu kommen - und ich komme oft hierher - ist, dass man hier anspruchsvollere Diskussionen führen kann, wie es mit all dem weitergehen soll. In Amerika verbringe ich die meiste Zeit damit zu argumentieren, warum es überhaupt irgendeine Unterstützung für Kultur geben soll.
Aber auch in Europa gehen Veränderungen vor sich: Als ich in meiner Studienzeit das Schloß Schönbrunn besuchte, musste man froh sein, eine Postkarte zu bekommen. Als ich das letzte mal dort war, musste man sich den Weg nach draußen durch vier Räume voller Souvenirs kämpfen.
Das Gespräch führte Michael Kraßnitzer ZUM THEMA Soll der Staat die Kultur finanzieren?
Ob in Österreich oder Deutschland - Regierungen jeder Couleur überlegen, wie sie ihre Ausgaben für Kunst und Kultur verringern können. Viele schielen auf die USA, wo Kunst hauptsächlich von privater Hand gefördert wird. Kevin V. Mulcahy ist Professor für Politikwissenschaft an der Louisiana State University in Baton Rouge und vertritt eine für einen Amerikaner ungewöhnliche Position: Der Staat hat wichtige kulturpolitische Aufgaben wahrzunehmen.
In den USA hat die öffentliche Förderung von Kultur einen schlechten Stand: Es gibt kein Kulturministerium und Kulturpolitik spielte bisher in noch keinem Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle, die Republikaner lehnen Kunstförderung prinzipiell ab. Zum Vergleich: Das Budget des österreichischen Kunststaatssekretariats beträgt 1,1 Milliarden Schilling, die zuständige amerikanische Bundesbehörde NEA ist mit umgerechnet nicht einmal 1,5 Milliarden Schilling dotiert. MK