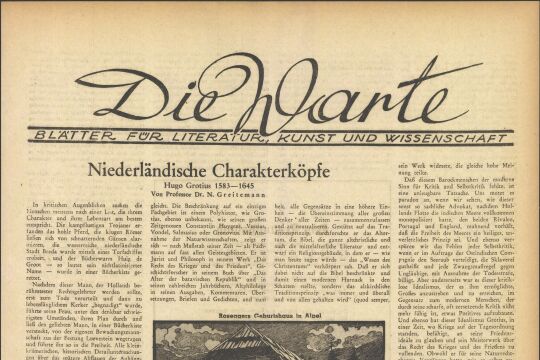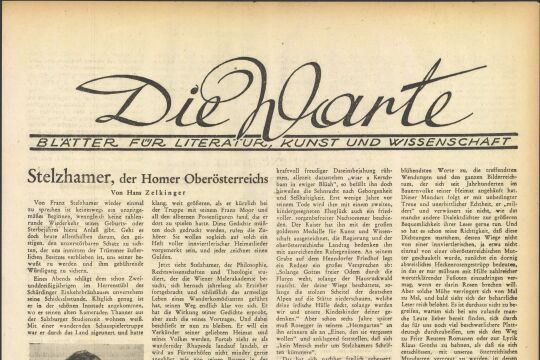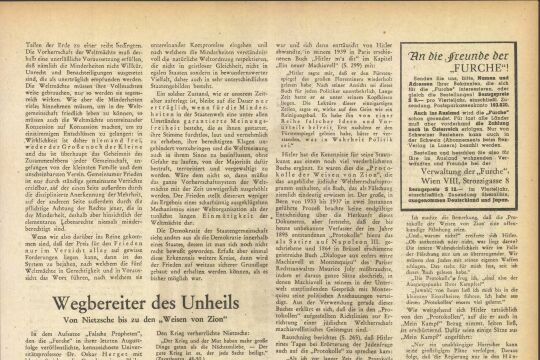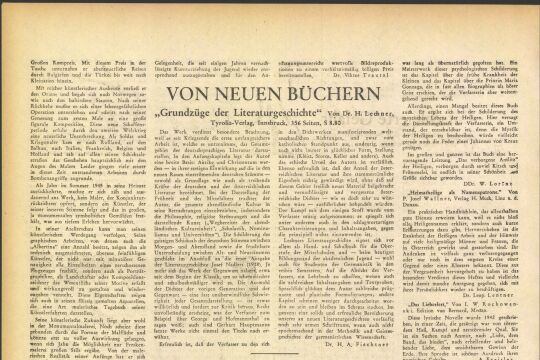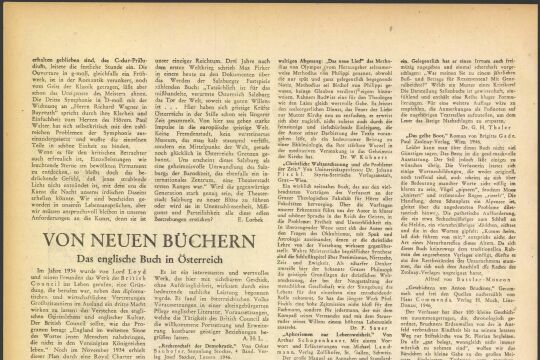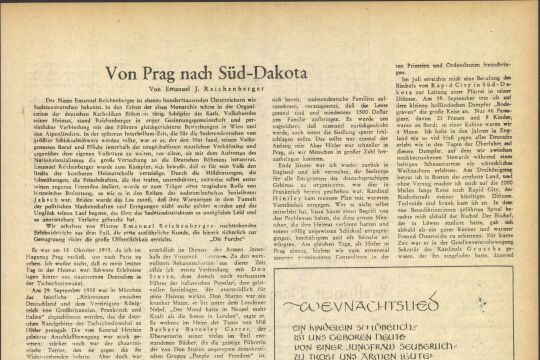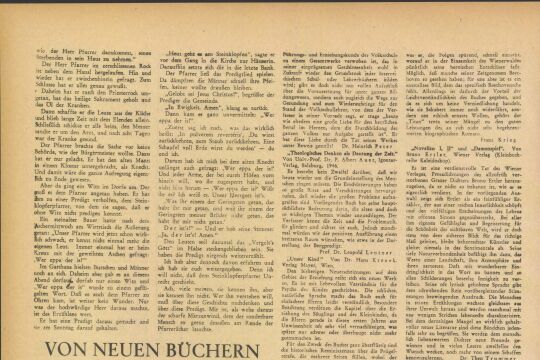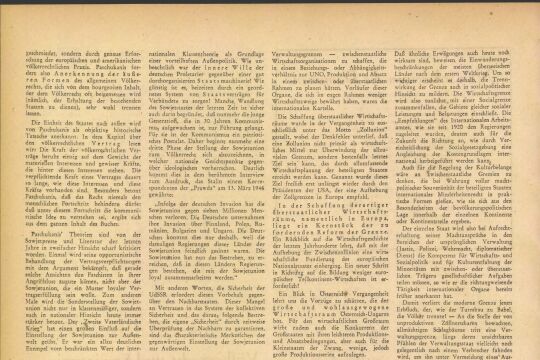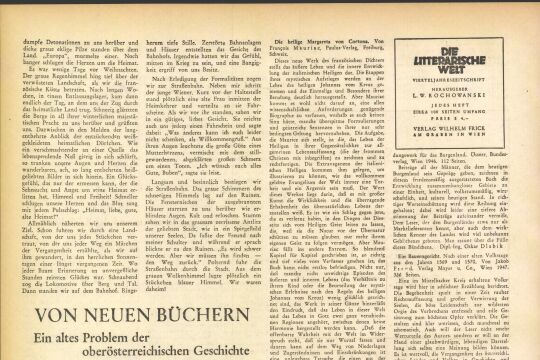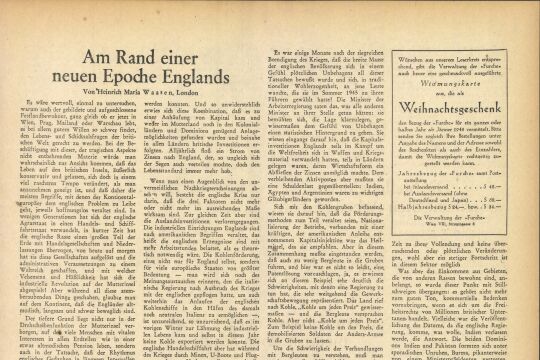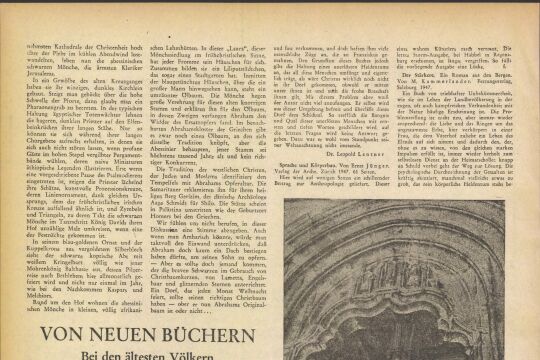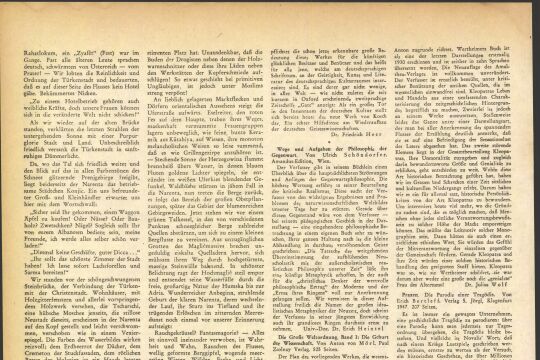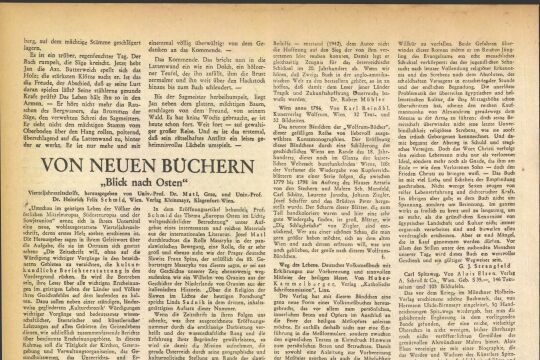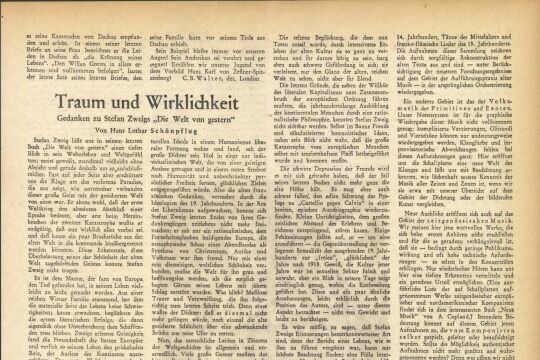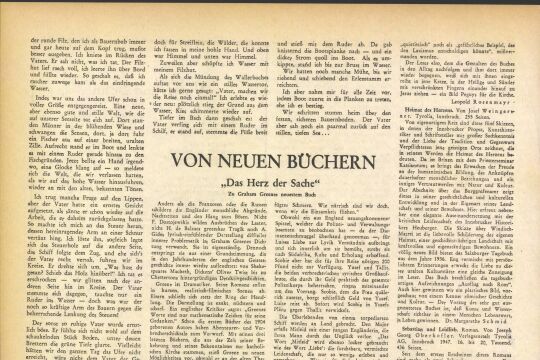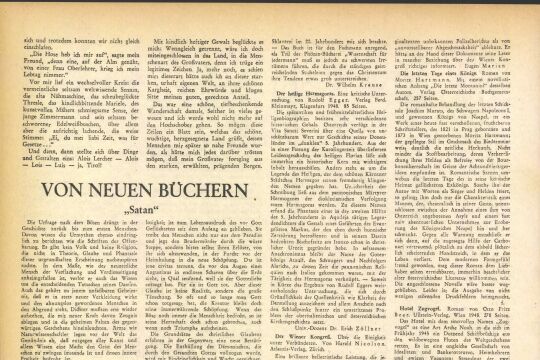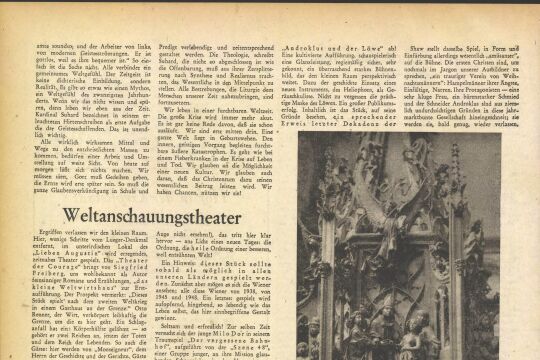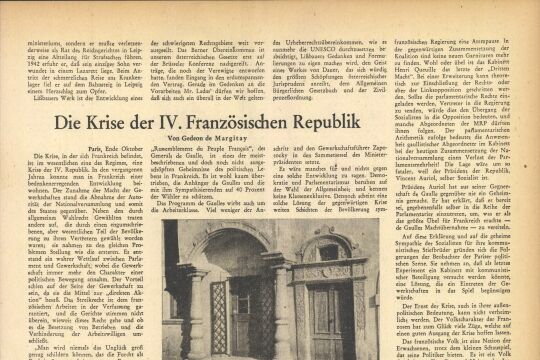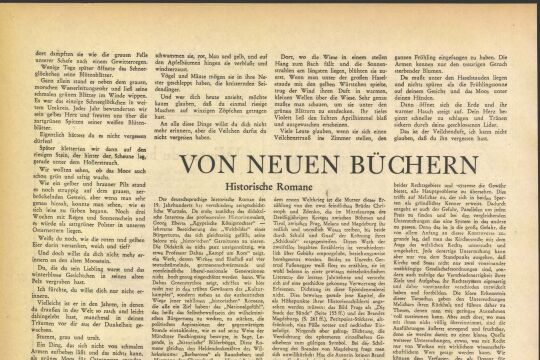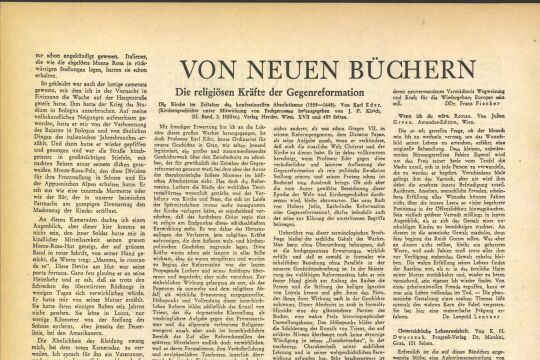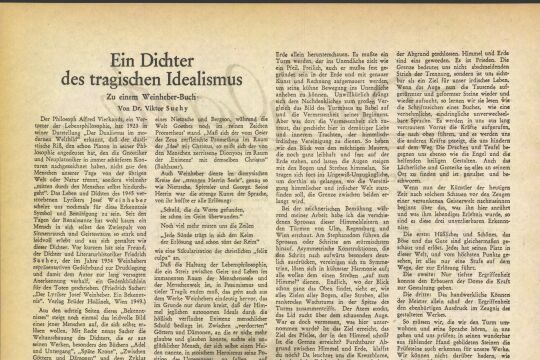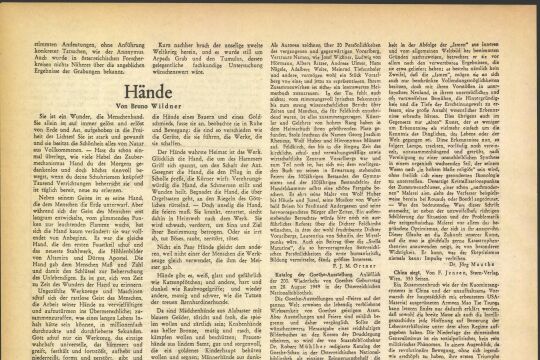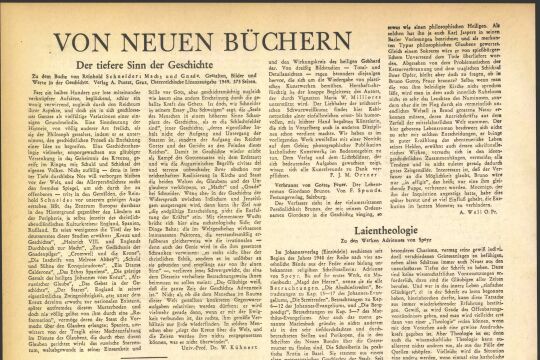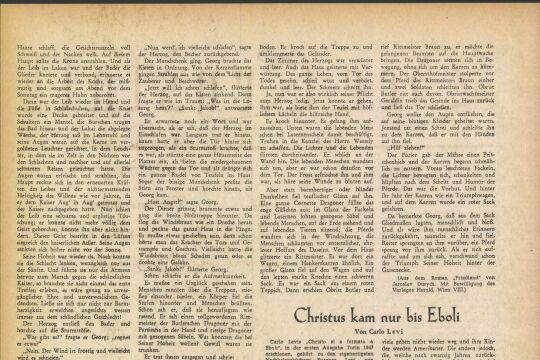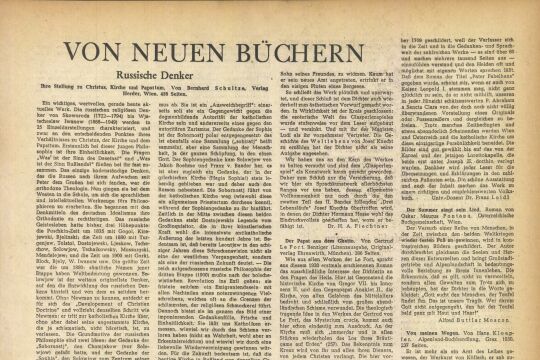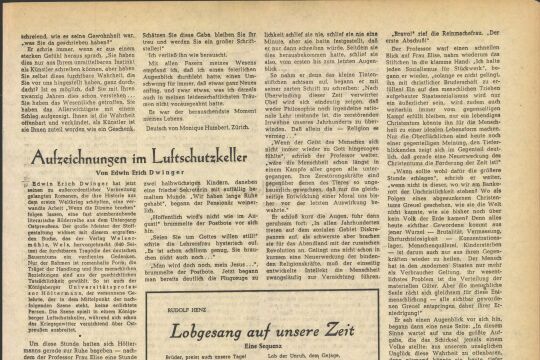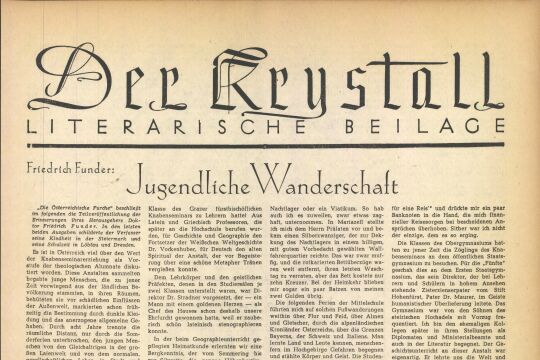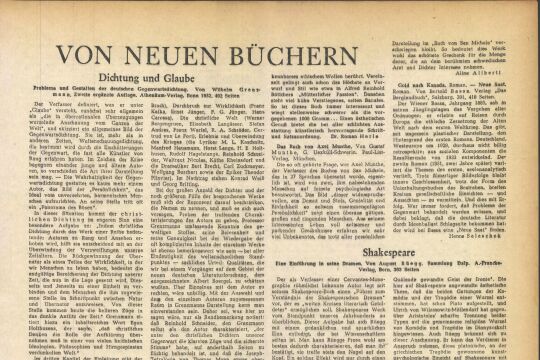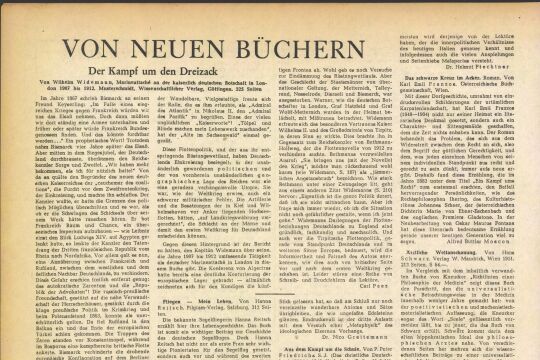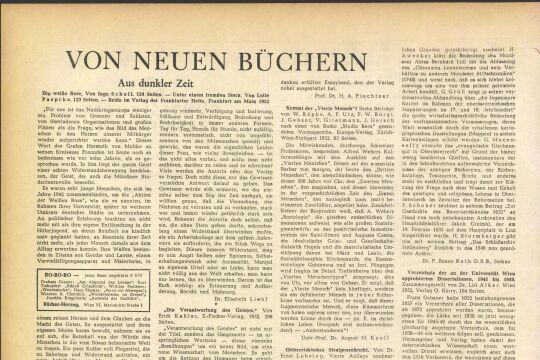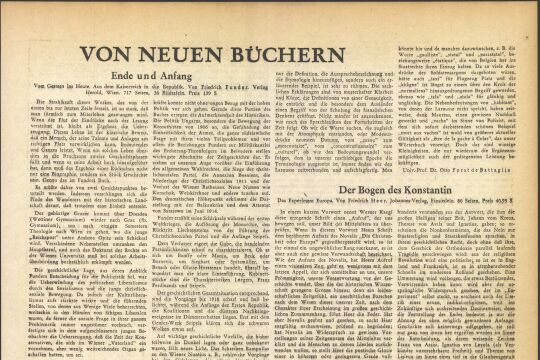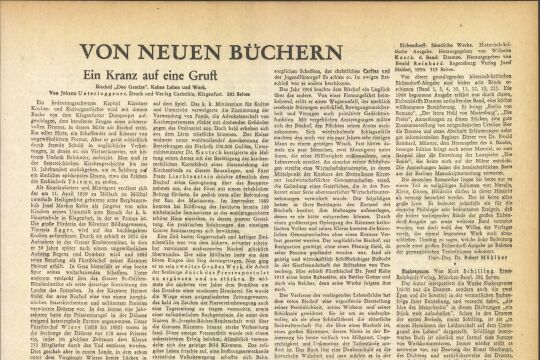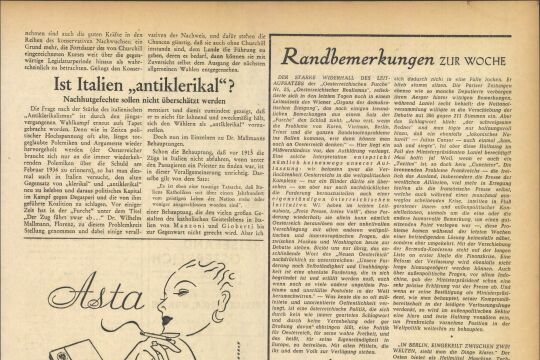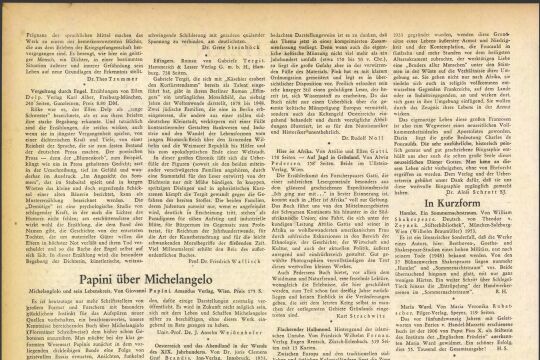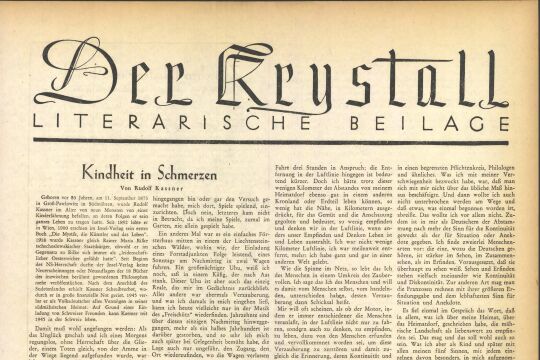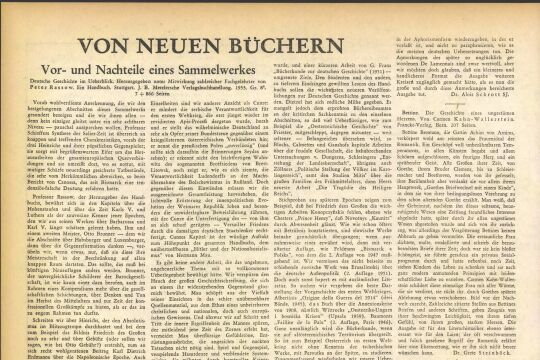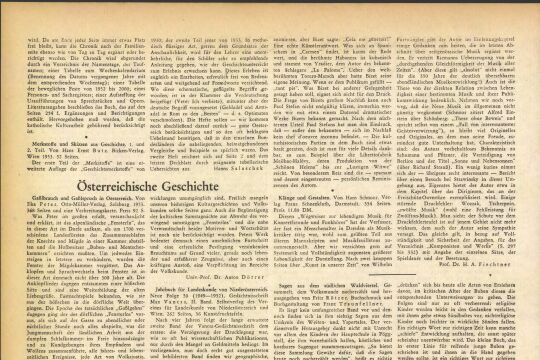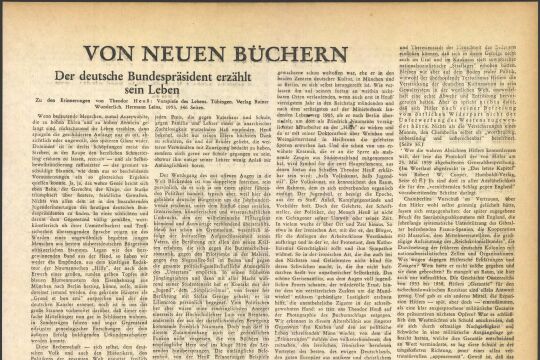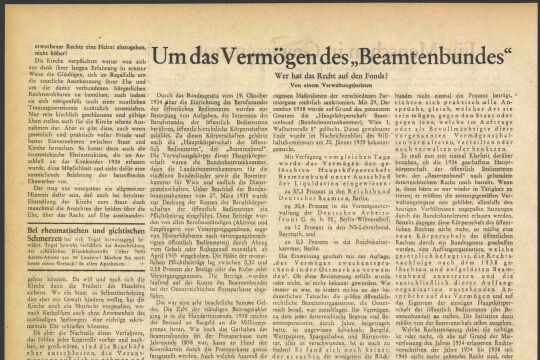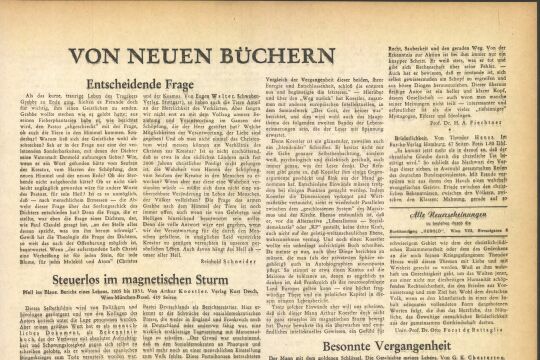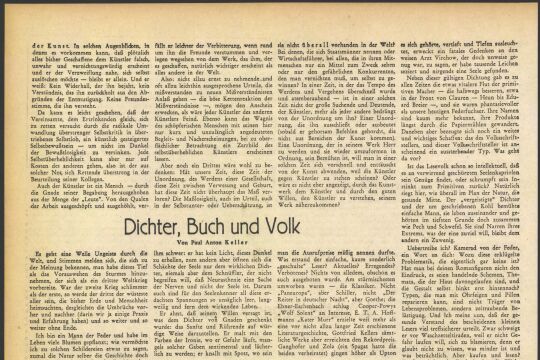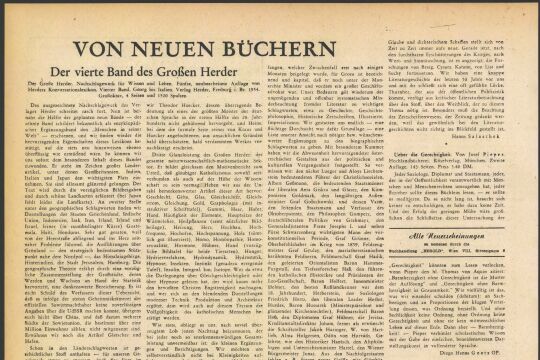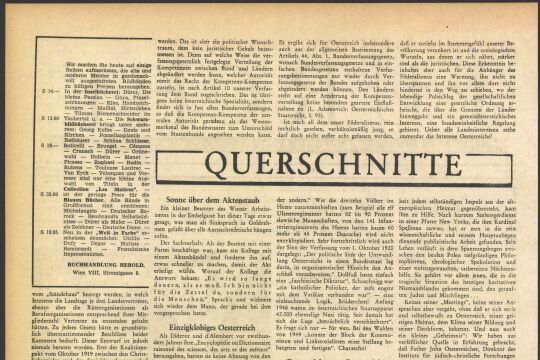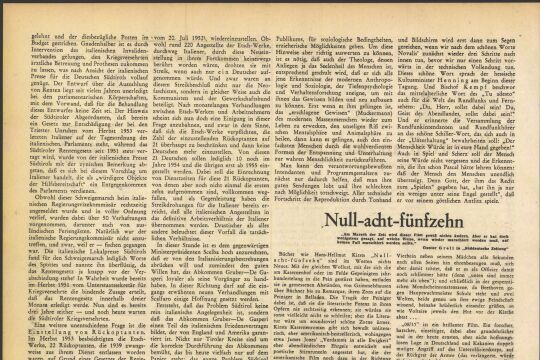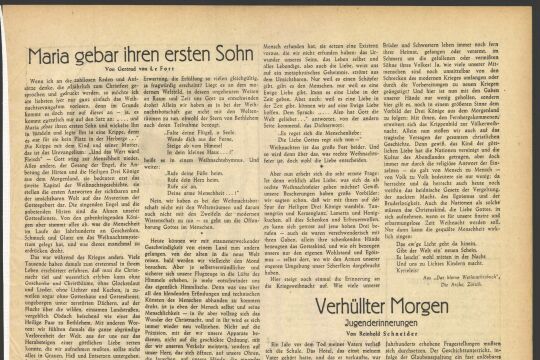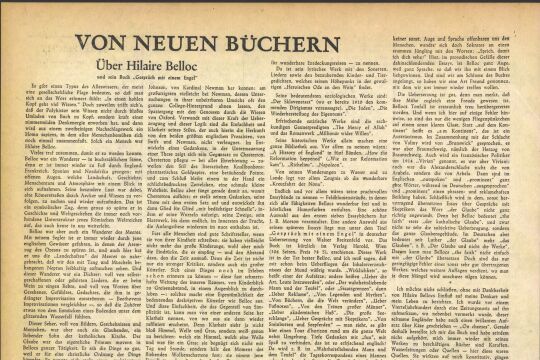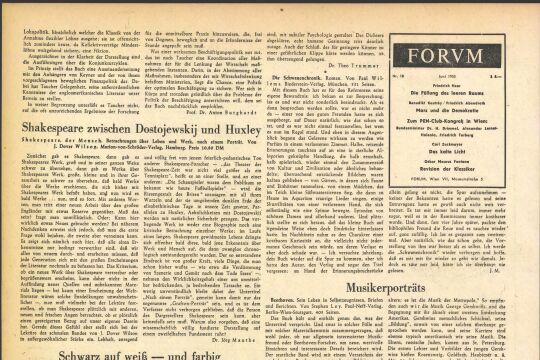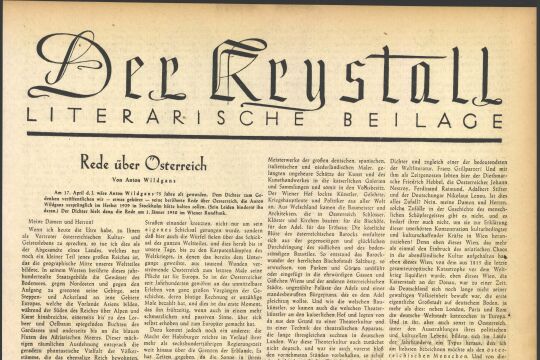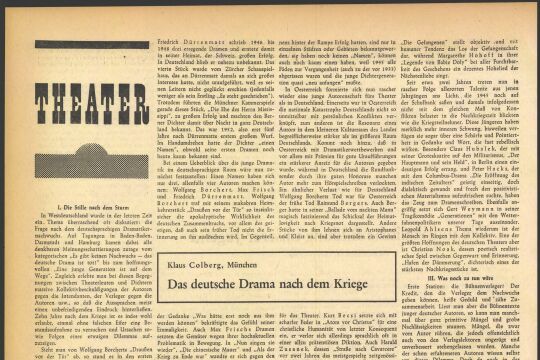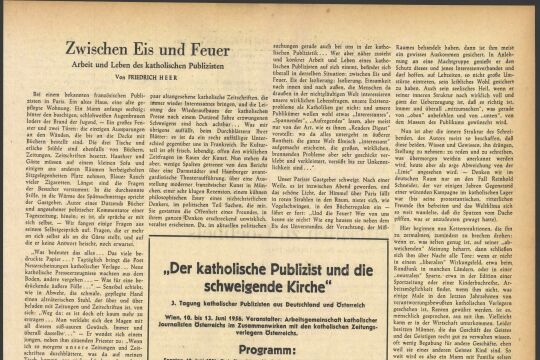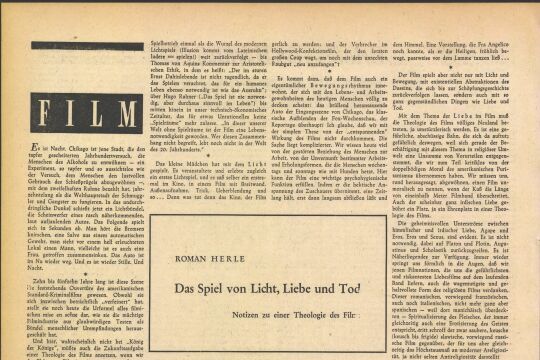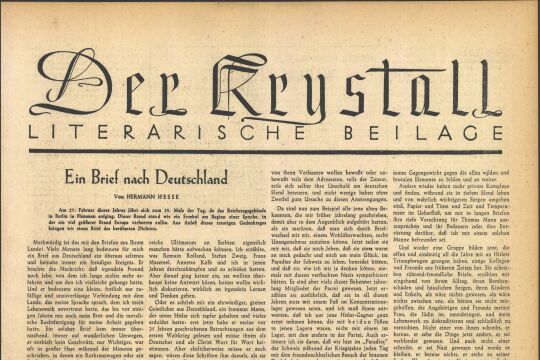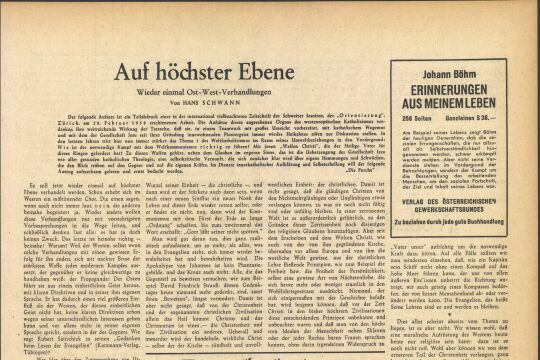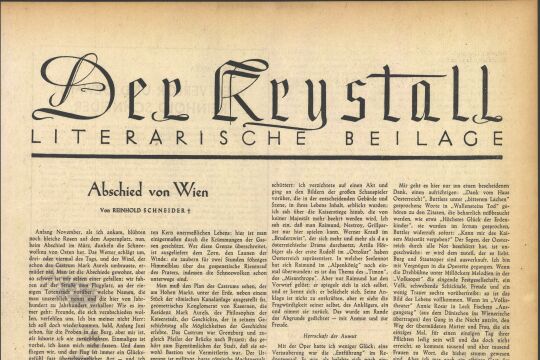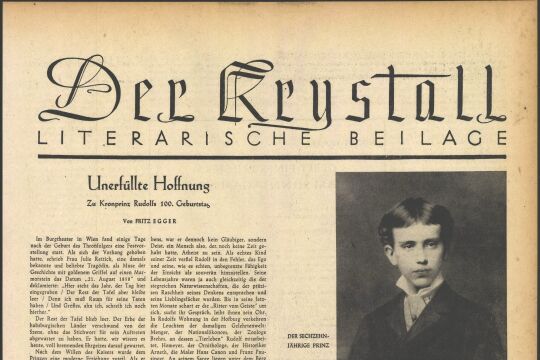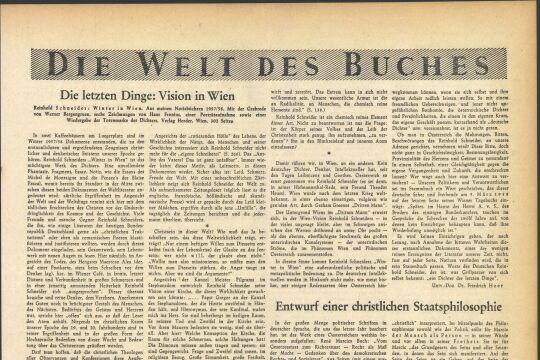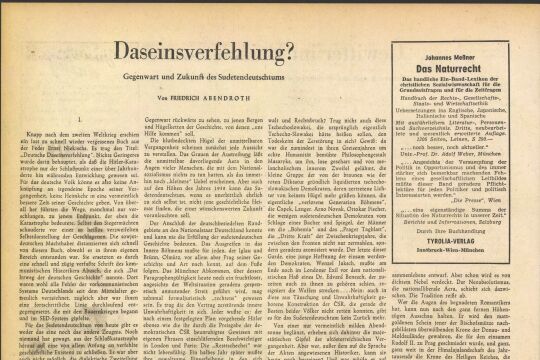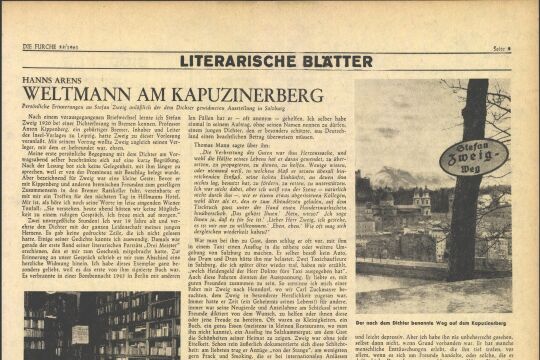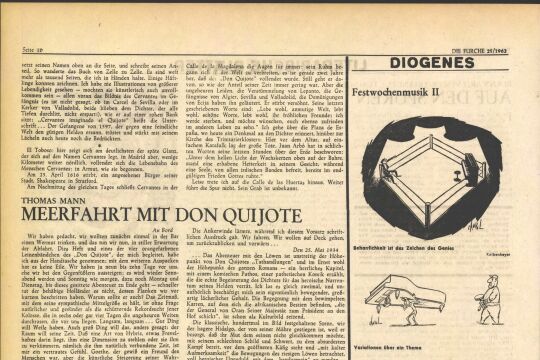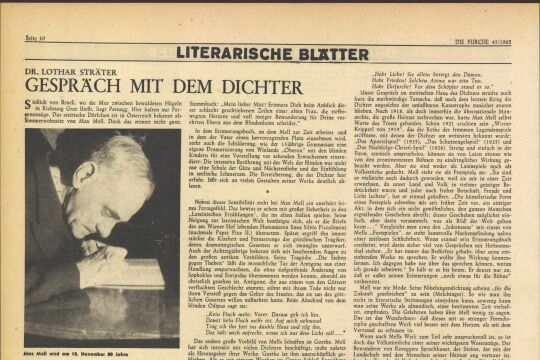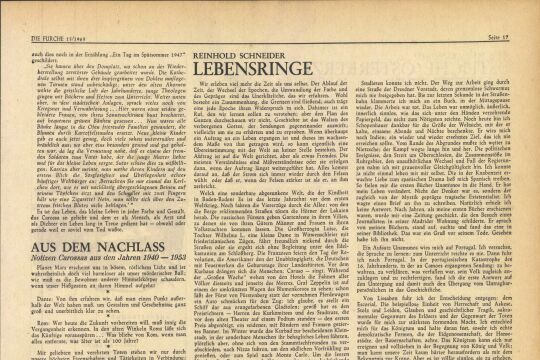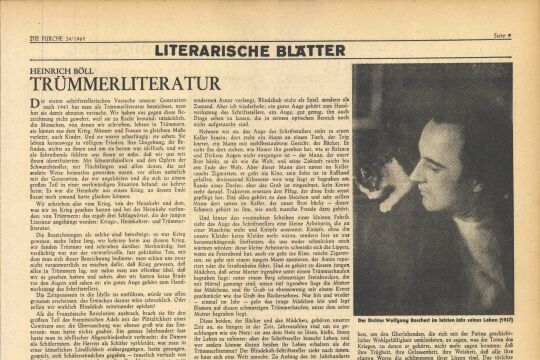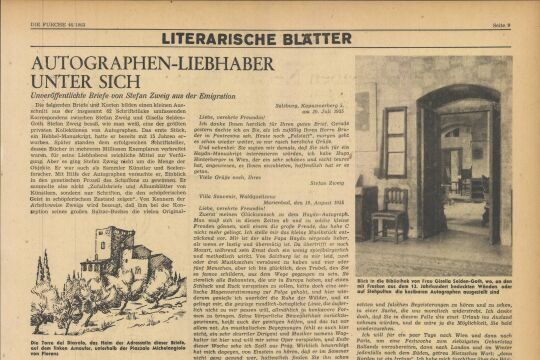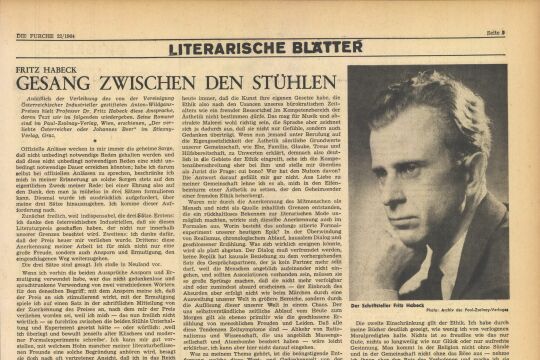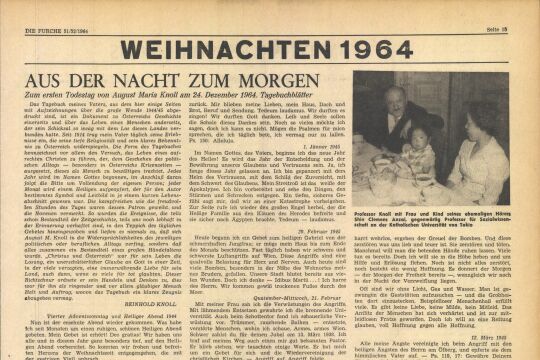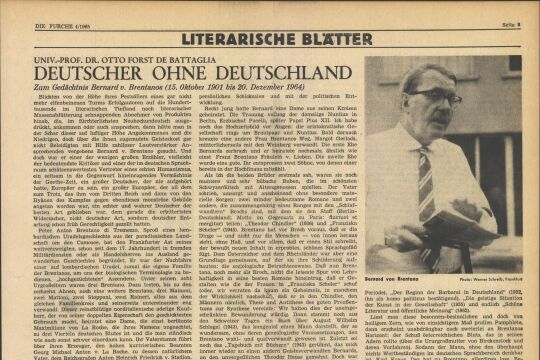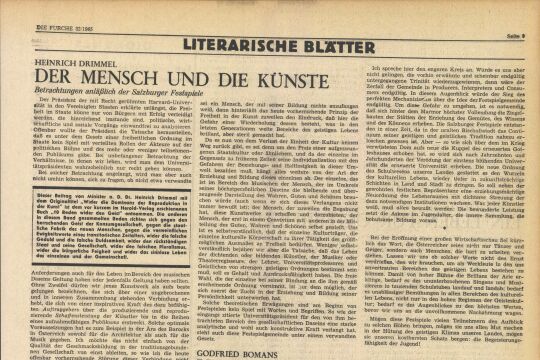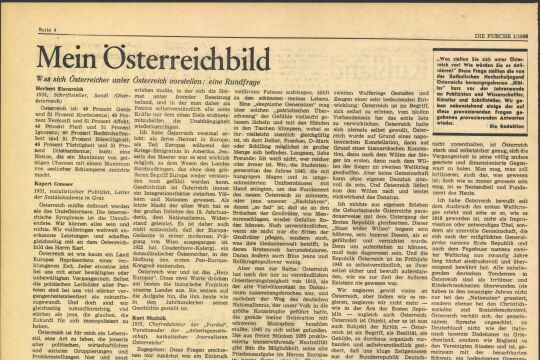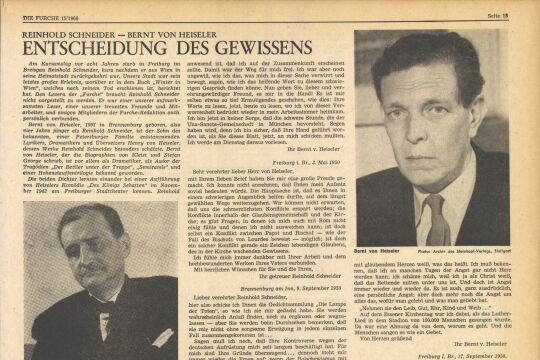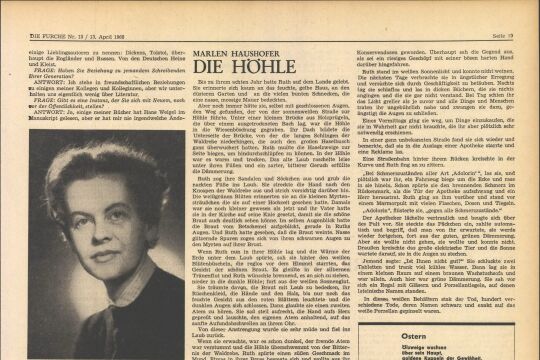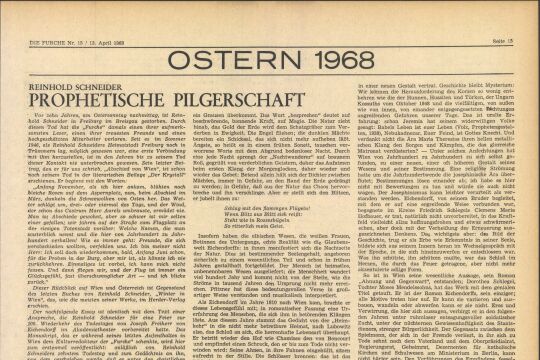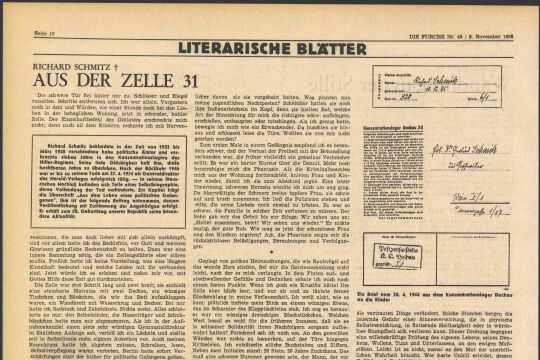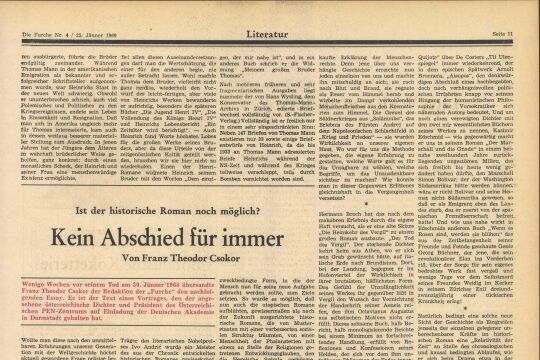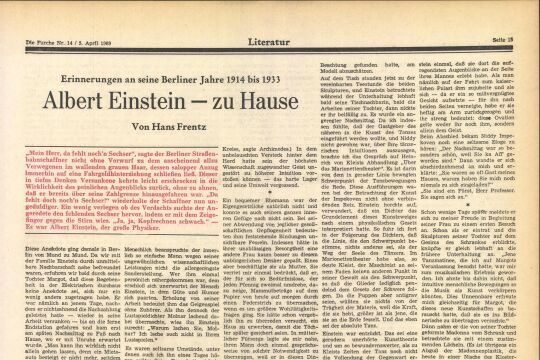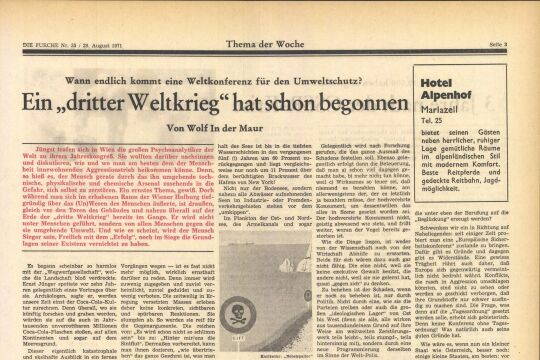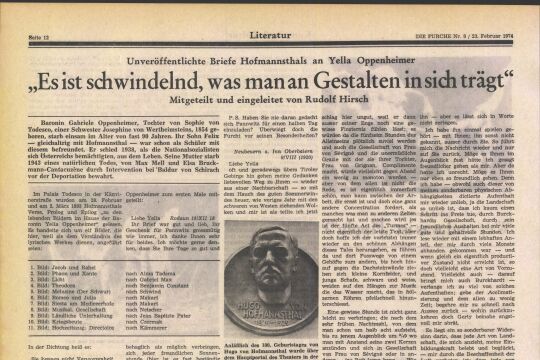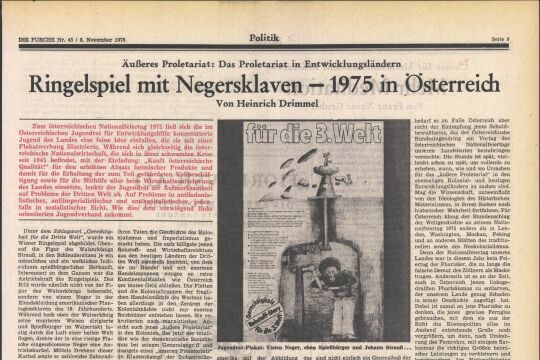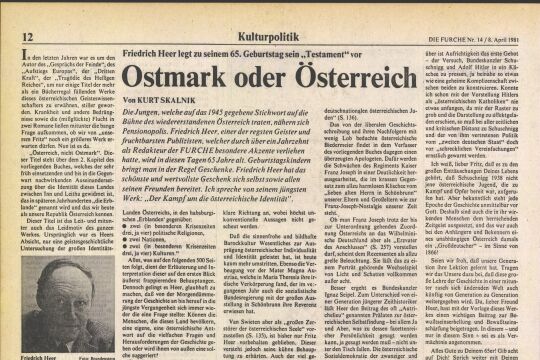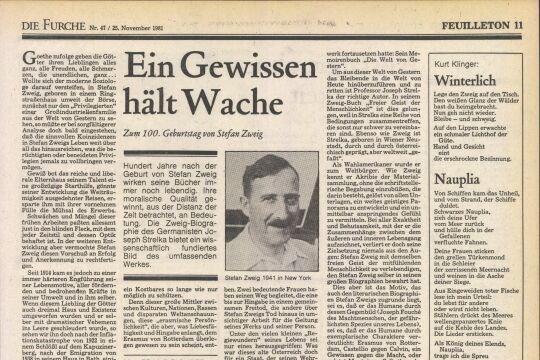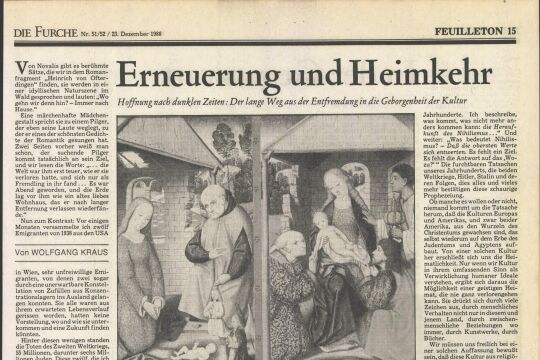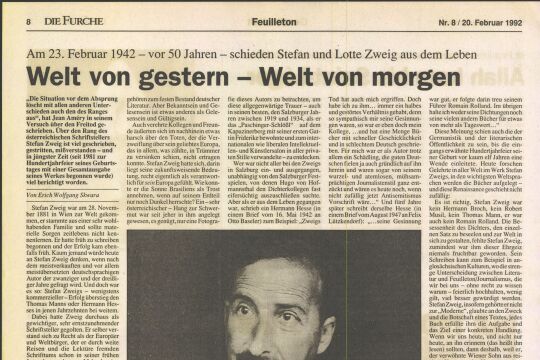Die fehlenden Strophen des Weltgedichts
Stefan Zweigs historische Miniaturen haben noch immer Einfluss auf das Bild „unserer“ vermeintlich heroischen Vergangenheit. Wie das Beispiel Ferdinand Magellan zeigt, beschränkte sich der Autor aber nicht auf bloße Tatsachen-Berichte.
Stefan Zweigs historische Miniaturen haben noch immer Einfluss auf das Bild „unserer“ vermeintlich heroischen Vergangenheit. Wie das Beispiel Ferdinand Magellan zeigt, beschränkte sich der Autor aber nicht auf bloße Tatsachen-Berichte.
Was Stefan Zweig von Schriftstellern vergleichbaren Nachruhms unterscheidet, ist, dass er auch heute noch von vielen tatsächlich gelesen wird. Man denke etwa an Lion Feuchtwanger oder Jakob Wassermann, die in der Zwischenkriegszeit ebenfalls als „meistgelesene“ Autoren galten, deren Werke aber nur mehr einem überschaubaren Publikum näher bekannt sein dürften. Vor allem Zweigs historisches Œuvre erfreut sich anhaltender Beliebtheit, an erster Stelle seine Erinnerungen an „Die Welt von Gestern“, aber auch die Biografien, die er Maria Stuart, Marie Antoinette und anderen geschichtlichen Figuren widmete. So formt Stefan Zweig, der aus Europa schmählich Vertriebene, im brasilianischen Exil unglücklich Dahingeschiedene, auch bald 80 Jahre nach seinem Tod das Bild, das sich Menschen von der Vergangenheit machen.
Exzellenter Historiker
Offenkundig besaß Zweig die doppelte Gabe, sich für seine Themen zu begeistern und seine Begeisterung in eine elanvolle, überschwängliche Sprache zu gießen, sodass sie in jeder Zeile spürbar ist. Ebenso unübersehbar sind seine exzellenten Geschichtskenntnisse. Zweigs Biografien und historische Miniaturen sind durchwegs – wie man heute sagt – sehr gut recherchiert, aber als literarische Texte begnügen sie sich nicht mit der Darstellung dürrer Fakten.
In einem 1939 geschriebenen Vortragsmanuskript hat der Dichter die Geschichte selbst eine Dichterin genannt, allerdings eine Dichterin, die ihren Stoff nur bruchstückhaft der Nachwelt überliefert und die auch nicht imstande ist, pausenlos Meisterwerke zu schaffen. Die fehlenden Strophen in diesem Weltgedicht zu ergänzen, sei der Künstler berufen, der freilich „auf jedes Fabulieren“ zu verzichten und „dem überlegenen Geist der Historie“, das heißt dem „Weltgeist“, zu dienen habe. Um dessen Logik zu verstehen, müsse der Künstler „Psychologe sein, er muss eine besondere Art des Lauschens, des sich Tief-in-das-Geschehnis-Hineinhorchens besitzen“. Das Seelenleben seiner Heldinnen und Helden hat Zweig immer sehr farbig ausgemalt. Auch dies dürfte zur andauernden Popularität seiner historischen Werke beitragen, glaubt man doch bei der Lektüre die handelnden Personen lebendig vor Augen zu haben. So auch jenen Seefahrer, den Zweig 1938 in „Magellan. Der Mann und seine Tat“ porträtierte.
Mit Magellans Namen ist die Geschichte der ersten Umsegelung der Erde verbunden. Im September war es fünfhundert Jahre her, dass der Portugiese mit fünf Schiffen und rund 240 Mann Besatzung von Spanien aus in See stach. Vor allem in Spanien und Portugal ist das Jubiläum mit Pomp gefeiert worden, aber auch hierzulande hat es beachtliches Medienecho hervorgerufen. Dabei trat zutage, wie sehr Zweigs „Magellan“ die Wahrnehmung dieses Ereignisses bis heute prägt: Er wurde vielfach zitiert, im Radio vorgelesen und diente unverkennbar mehreren feuilletonistischen Nacherzählungen als Blaupause.
Zweigs Magellan ist ein einsamer Held, ein „Genius“, der sich in den Kopf gesetzt hat, „das bisher unmöglich Geglaubte zu vollführen [...], nämlich die Erde auf einer einzigen Fahrt zu umrunden“. Diese Idee hat der Mann „einzig mit sich allein durchgedacht“ und sie schließlich „in wahrhaft heroischer Selbstaufopferung“ in die Tat umgesetzt. Indem Magellan auf seiner Fahrt – „die herrlichste Odyssee in der Geschichte der Menschheit vielleicht“ – den gesamten Erdumfang ausmaß, habe er der ganzen Menschheit „ihre eigene Größe bewusst“ gemacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!