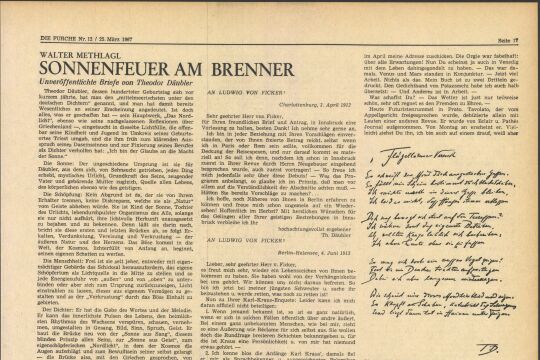Der 28. November 2001 ist Stefan Zweigs 120. Geburtstag. Bald, am 22. Februar 2002, jährt sich auch sein selbst gewählter Todestag zum 60. Mal: Mit seiner Frau Lotte wusste der Dichter keinen anderen Weg, Ruhe zu finden.
Stefan Zweig, so urteilte sein feinsinniger Zeit- und Leidensgenosse Franz Werfel im Frühjahr 1942, erkannte die "ganze eisige, unlösbare Tragik des Menschen auf Erden, die eine metaphysische Tragik ist und daher jedes ausgeklügelten Heilmittels spottet. Es war in ihm zuletzt nur mehr schwarze Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Schwäche und ein bisschen ohnmächtige Liebe". Werfel kannte die Feinfühligkeit und Hilflosigkeit selbst, an der Stefan Zweig schließlich in der Ferne zerbrach.
Anders sah es Karl Kraus, die literarische Salzsäure Wiens; er nannte Stefan Zweig einfach einen "Schmuser". In seinem Bannkreis stand der kleine Mann Elias Canetti; mit wenig Geschmack erinnerte er sich im Jahr 1985 des Angebots von Zweig aus dem Frühjahr 1935, ihm die Flucht zu finanzieren. Canetti schrieb dazu: "Ich bedauerte nicht im geringsten, dass ich den Vorschlag so entschieden zurückgewiesen hatte. Ich hatte meinen Stolz bewahrt."
Von solcher Selbstdarstellung war Stefan Zweig nicht angekränkelt, er, der am 28. November 1881 in Wien I., Schottenring 14, als Kind jüdischer Eltern geboren wurde und religiös assimiliert aufwuchs. Aufgeklärt und weltgewandt, trieb es den jungen Stefan Zweig zu den Künsten und zur Philosophie. In beiden suchte er den Menschen, seine Gründe und seine Abgründe. Das sollte auch sein Weg bleiben bis zum Ende. Auf diesem Weg wurde er mit Menschen bekannt, die unterschiedlicher kaum sein konnten, wie etwa Theodor Herzl, August Rodin oder Richard Strauß. Im Ersten Weltkrieg lernte Zweig, ein Weltbürger, überall und nirgends zu Hause, die erste patriotische Erhebung in seinem Leben kennen, die ihm unverständlich blieb. Denn welchen Sinn soll es haben - das Böse, das ein einziges Vaterland über alles stellt? Ihm hielt er die Idee Europa entgegen, vier Jahrzehnte bevor sie eine zaghafte politische Realität wurde.
Als der Nationalsozialismus das Grauen des Patriotismus zum zweiten Mal aufbrachte, furchtbarer als es je zu erwarten war, fand sich Zweig auf abschüssiger Bahn. Überall sah er Schwäche und Tod lauern wie finstere Gespenster, in denen sich die Häme aller Jahrhunderte zu sammeln schien. Zudem nagten an ihm die Lebensjahre und mit ihnen eine aufwachsende Hilflosigkeit. Politisch wurde er degradiert, indem man ihm einbrannte, dass er Jude war - und das hieß damals: kein Mensch mit Lebensrecht, sondern ein Unwesen, das ausgeschunden und verjagt werden durfte, ein Unwesen, an dem primitivste Ungeister ihren gewalttätigen Spaß finden konnten und das man in den Konzentrationslagern bald systematisch in Rauch verwandelte.
Bittere Ahnung
Das alles ahnte Stefan Zweig an seinem 50. Geburtstag im Jahr 1931, als er ins Tagebuch den bitteren Satz schrieb: Der einzige Trostgedanke, dass man jeden Augenblick Schluss machen kann. Denn auch wenn die Dämonie einmal vorüber sein sollte - wohin könnten sich Juden deutscher Sprache noch bewegen? Was die wenigen Überlebenden der Schoa nach dem Niedergang des Nationalsozialismus erfuhren, da man sie als so genannte displaced persons wieder durch Lager schob und sie jahrelang ohne Zugehörigkeit dahin vegetieren mussten, das sah Zweig in den dreißiger Jahren mit dem klaren Blick, der aus der Schwäche stammte.
Diese Schwäche wurde bei Stefan Zweig langsam zur Verzweiflung. Wenn sein Freund Joseph Roth in Verzweiflung geriet, weil auf seinem unfreiwilligen Weg von Galizien nach Westen der Gottglaube mit der unmenschlichen Welterfahrung kollidierte, so zerbrach Zweig vielleicht daran, dass ihm kein Gottglaube in den dunklen Jahren ein widerständiges "Nein!" eingeben konnte. Was er am Glauben entdeckte, war vor allem seine Unmöglichkeit, seine Unzugänglichkeit.
Bot die Literatur Ersatz? In seiner Erzählung Buchmendel von 1929 erzählt Zweig noch anmutig, dass Buchmendel den harten Eingott Jehovah verlassen (hat), um sich der funkelnden und tausendfältigen Vielgötterei der Bücher zu ergeben. Doch rasch erlosch ihm das Spiel des Schönen, überblendet wurde es von den Fackeln, mit denen in Deutschland Bücher jüdischer Autoren angezündet wurden. Noch einmal, im Mai 1941, rief Stefan Zweig in New York der PEN-Club-Versammlung zu: Es ist an uns heute, an uns, denen das Wort gegeben ist, inmitten einer verstörten und halb schon vernichteten Welt den Glauben an die moralische Kraft, das Vertrauen in die Unbesiegbarkeit des Geistes trotz allem und allem unerschütterlich aufrecht zu erhalten.
Doch das war schon ein Ruf aus dem Untergang. Zerbrochen war sein Vertrauen in die moralische Kraft, zerrissen sein Glaube an die Macht des Buches, zerfallen die letzte Hoffnung, dass er in dieser Schreckenszeit vielleicht ein wenig vom Glauben seiner Vorfahren auffinden könnte. Die hohen Tage, da man Gott noch überall vernahm, lagen weit zurück. Das erkannte Zweig jedesmal, wenn Kriege tobten.
Deshalb beschwor er im Ersten Weltkrieg in seinem Bühnenstück Jeremias den traurigsten aller Propheten und ließ ihn das dunkle Wort künden: Gott ist weg. Nirgends ist er! Nirgends! Wer hat ihn gesehn von den Lebendigen, wer gehört seine Stimme? Nirgends ist er! Nirgends! Ins Leere starren, die ihn suchen, und die ihn bezeugten, sind Lügner geworden vor der Menschheit Gesicht. Nirgends ist Gott, in den Himmeln nicht und auf der Erde und in den Seelen der Menschen nicht! Nirgends, nirgends ist er! Und in seiner autobiographischen Schrift von 1942, Die Welt von Gestern, beschwört er die andere Klagegestalt der biblischen Überlieferung: Hiob.
"Warum wir alle?"
In ihm deutet er die Juden seiner Tage, und er deutet sie mit schweren Fragen und düsteren Ahnungen: Aber warum dieses Schicksal ihnen (den Juden) und immer wieder ihnen? ... Warum du? ... Warum wir alle? Und keiner wusste Antwort ... Aber vielleicht ist es gerade des Judentums letzter Sinn, durch seine rätselhaft überdauernde Existenz Hiobs ewige Frage an Gott immer wieder zu wiederholen, damit sie nicht völlig vergessen werde auf Erden. Zwischen Gott und den Seinen ist etwas Unheimliches offen geblieben, eine Frage, die kaum richtig gestellt werden kann und wohl auf Wege jenseits der Nacht hinzielt.
Diese stieg dann auch durch Zweigs Fenster ein, nachdem er schließlich in Petropolis/Brasilien mit seiner zweiten Gattin Lotte Zuflucht gefunden hatte. Schon mehr als ein Jahrzehnt zuvor hat er in seinem Nachlassroman Rausch der Verwandlung nicht nur seinen Freitod vorweggenommen, sondern auch die Weise, wie er schließlich geschehen ist. Eine Nacht will sich die Protagonistin des Romans noch mit ihrem Geliebten gönnen, eine ganze Nacht ... vielleicht hat man sich noch manches zu sagen ... so dieses Letzte, das man sich sonst im Leben nie sagt ... Und dann ... ich möchte einmal mit dir sein, ganz mit dir sein eine Nacht ... Am Morgen sollen sie uns dann finden.
Am Morgen des 22. Feber 1942 fand man Stefan und Lotte Zweig in ihrem Bett, mit gelösten Gesichtszügen, er auf dem Rücken liegend, sie in seinem linken Arm. Mit Hiobs ewiger Frage verließen beide eine Welt, die ihnen anders keine Ruhe mehr gönnte.
Der Autor ist Professor für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien, wo er das Forschungsprojekt "Theologie und Literatur" leitet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!