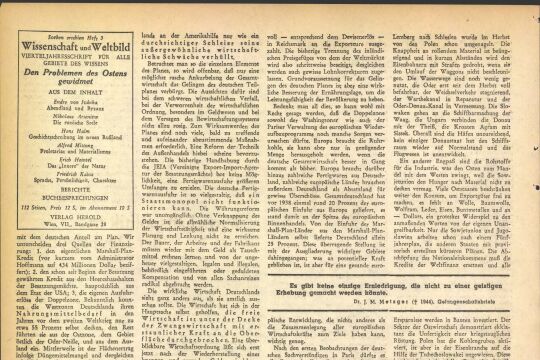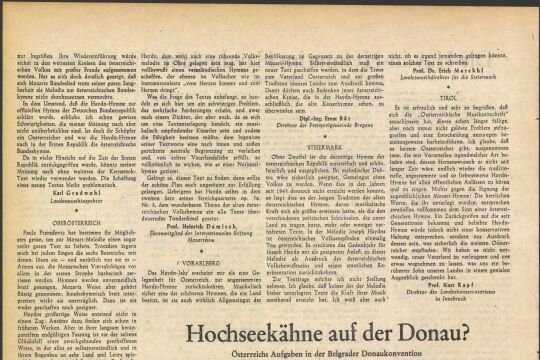Harte Zeiten für die Donau-Länder
Der Kosovo-Krieg ist zu Ende, doch die ökonomischen Folgen sind für die Nachbarländer Jugoslawiens bereits unübersehbar: Ein Lokalaugenschein in Ungarn, Rumänien und Bulgarien.
Der Kosovo-Krieg ist zu Ende, doch die ökonomischen Folgen sind für die Nachbarländer Jugoslawiens bereits unübersehbar: Ein Lokalaugenschein in Ungarn, Rumänien und Bulgarien.
Von Wien aus brechen wir auf, um uns vor Ort zu überzeugen, welche Folgen der Kosovo-Krieg für die Nachbarstaaten hat. Wir fahren die Donau entlang. Dieser zweitlängste Fluß Europas, und die wichtigste Transportader zwischen dem Balkan und Westeuropa, ist derzeit blockiert. In vielen Häfen wie zum Beispiel in dem ungarischen Dunaujvaros herrscht Stille. Vor dem Krieg wurden hier am Tag etwa 60 Schiffe ent- und beladen. Sie brachten Eisenerz und Kohle aus der Ukraine für die größten Stahlwerke Ungarns Dunaferr. Auch fertige Produkte, wie zum Beispiel verschiedene Blecharten, die unter anderem für Italien bestimmt waren, wurden hier verladen.
Der Leiter des Hafens, Imre Varga, erzählt: "Vor dem Krieg haben wir hier jährlich etwa 120.000 Tonnen Papier, 600.000 Tonnen Lebensmittel und an einem Tag etwa 5.500 Tonnen verschiedener Eisenprodukte verladen. Nach dem Ausbruch des Krieges in Jugoslawien mußten wir schon etwa 150 Millionen Forint Verluste in Kauf nehmen. Heute machen unsere Arbeiter nunmehr Bereitschaftsdienst und verdienen die Hälfte des bisherigen Lohnes."
Leere Häfen Der Umstieg auf die Schiene oder auf die Straße bedeutet für Dunaferr rund 15 Prozent höhere Kosten. Eine große Belastung für das Staatsunternehmen, das sich bislang nur dank Subventionen über Wasser halten konnte. Die EU drängt schon lange, das Mammutunternehmen, in dem etwa 10.000 Menschen beschäftigt sind, zu entflechten und zu privatisieren. "Doch das wird immer schwieriger", meint der Marketingdirektor von Dunaferr, Michaly Schneider. "Die Krise der Stahlindustrie ist kein Geheimnis. Die Stahlpreise sind im Keller. Und durch die zusätzlichen Kosten müssen wir jetzt noch strenger kalkulieren, weil unsere Gewinne immer weiter schrumpfen."
Im Gegensatz zu Dunaujvaros ist der an der ungarisch-serbischen Grenze gelegene Donauhafen Mohacs mit Schiffen überfüllt. Etwa 50 Schubschiffe und Schleppkähne haben hier eine Zwangspause eingelegt. Die meisten von ihnen kommen aus der Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Wegen der zerstörten Brücken in Novi Sad können sie nicht mehr Richtung Schwarzes Meer fahren.
Mitko Bratolev und Stoyan Kirilow sind schon fast zwei Monate in Mohacs. Sie haben Gebrauchtwagen aus Deutschland geladen. Ihr Bestimmungshafen ist Russe in Bulgarien. "Doch unsere Fahrt ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden", erzählen die beiden. "Jeden Tag verlieren wir etwa 2.000 DM. Statt Geld zu verdienen, führen wir kleine Reparatur- und Streicharbeiten an unserem Schiff durch. Jeden Tag hören wir Nachrichten und hoffen, daß das für uns der letzte Tag in Mohacs war."
Unsere nächste Station ist der Grenzort Szeged. Szeged ist eine gepflegte Stadt. Fast alle Häuser wurden sorgfältig restauriert. In den Straßen sieht man Geschäfte mit überfülltem Angebot. Jeden Tag kommen hier viele Frauen und Kinder aus dem benachbarten Serbien, um Grundnahrungsmittel zu kaufen. Männer bis zum 60. Lebensjahr brauchen eine Sonderbewilligung, um Serbien verlassen zu dürfen. Bislang waren es Ungarn, die in das besser entwickelte Jugoslawien fuhren, um westliche Waren zu kaufen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Nur die Geschäftsleute in Szeged beklagen sich darüber, daß seit dem Kosovo-Krieg ihre Umsätze gesunken sind. Die serbischen Frauen, die hierher kommen, müssen alles in Forint oder DM bezahlen und beschränken ihre Einkäufe auf das Nötigste. Der jugoslawische Dinar ist hier nichts wert.
Anders ist die Situation im zweiten Nachbarstaat Jugoslawiens, Rumänien. In Nadlak passieren wir die Grenze. Sie erscheint als ein wahrer Schnittpunkt zwischen dem reichen und armen Teil Europas. Denn Rumänien ist ein verarmtes Land. Ein Durchschnittseinkommen liegt hier bei umgerechnet etwa 1.200 Schilling. Ab Mitte Mai wurden die hier geltenden Preise bei Strom, Heizwärme und verschiedenen Dienstleistungen kräftig angehoben. Das wiederum bedeutet für die Wirtschaft den stärksten Einbruch der vergangenen fünf Jahre. Die Folgen dieser Krise sieht man in Rumänien auf Schritt und Tritt. Kaputte Fabrikanlagen, verrostete Maschinen auf dem Gelände der ehemaligen Kolchosen, unbebaute Felder und heruntergekommene Häuser prägen die Landschaft Rumäniens.
Lohnende Geschäfte Wir fahren Richtung Drobeta Turnu Severin, einer Grenzstadt zu Serbien. Dort ist der Benzinschmuggel nach Serbien Sport Nummer eins. Der Grenzübergang ist das rumänisch-jugoslawische Donaukraftwerk vor den Toren der Stadt. Ein Liter Benzin kostet in Rumänien unter einer Mark, Diesel sogar unter 50 Pfennig. Drüben in Serbien zeigen die NATO-Attacken Wirkung. Benzin ist Mangelware. Rund 40 Liter passen hinein in den Tank eines rumänischen Dacia. Kurz hinter der Grenze zu Serbien kostet der Liter 1,40 DM. Für die Rumänen ein lohnendes Geschäft. In brütender Hitze warten vor allem Arbeitslose, Studenten und Rentner auf ihre Chance. Zwölf Stunden Wartezeit nehmen sie in Kauf. Die Einreise mit einem vollen Autotank nach Serbien ist legal. Die rumänische Grenzpolizei ist machtlos. Durch langsame und schleppende Abfertigung versuchen die Beamten, den Ansturm in Grenzen zu halten. Arbeitslose Rumänen, ausgerüstet mit Schläuchen und Plastikflaschen, lassen sich nicht so leicht verschrecken. Denn pro Tour verdienen sie rund 20 DM.
Viele Schmuggler erzählen an der Grenze: "Was soll ich machen? Ich habe Familie, die muß ich ernähren. In Rumänien habe ich keine Arbeit." Der andere sagt: "Ich muß Geld verdienen, um die Behandlung meiner Zuckerkrankheit zu bezahlen. Doch um in das Geschäft einzusteigen, brauche ich etwas Kapital. Ich muß zuerst einmal investieren in einen Paß, einen Führerschein, eine Autoversicherung und das Benzin bezahlen. Das kostet mindestens 70 DM."
Einige Kilometer weiter liegt die Ortschaft Moldova Noua, die heimliche Schmugglerhauptstadt Rumäniens. Viele sind hier reich geworden durch den Treibstoffschmuggel während des letzten Erdölembargos gegen Jugoslawien in den Jahren 1992 bis 1996. Prächtige Villen und Baustellen prägen das Bild der Ortschaft. Der Treibstoffschmuggel über die Donau kann wieder anlaufen, falls das Kleingeld stimmt. Ein Bewohner von Moldova Noua erzählt: "Ich und mein Sohn haben das noch nicht gemacht. Man braucht Geld, um ein Boot zu kaufen und der Treibstoff muß auch noch bezahlt werden. Erst dann kann man Geschäfte machen."
Die großen Geschäfte laufen mit Booten über die Donau, die kleinen im Autotank. Traditionell haben die Rumänen im Grenzgebiet gute Kontakte zu den serbischen Nachbarn. Auch während des Krieges. Die Anti-NATO-Stimmung wird von Tag zu Tag stärker. An der Grenze in Turnu Severin werden solche Stimmen laut: "Nur unsere Regierung will in die NATO. Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist dagegen. Die NATO ruiniert unsere Wirtschaft. Das sind Superbanditen und Kriminelle. Wir haben keine Arbeit, die Wirtschaft wird zugrunde gehen. Die NATO ist für uns eine Terrorvereinigung."
"Albaner stehlen" Die meisten Rumänen haben kein Verständnis für die Leiden der Kosovo-Albaner. An der letzten Tankstelle vor der Grenze, die übrigens EURO heißt, erzählt die Besitzerin Elena Dima: "Die Serben sind immer zu uns gekommen, haben eingekauft, sich amüsiert und dabei immer korrekt verhalten. Die Kosovo-Albaner dagegen sind Zigeuner, kommen hierher und wollen nur klauen. Meine Schwester ist mit einem Serben verheiratet und wohnt jetzt am anderen Ufer. Als ich sie vor kurzem besucht habe, sagte sie, ich mußte mich bewaffnen, sonst würden mir die Kosovo-Albaner alles stehlen."
Wir verlassen Rumänien, fahren aber nicht nach Serbien, sondern in das benachbarte Bulgarien. Der kürzeste Weg dorthin über den rumänischen Donauhafen Calafat. Wer nach Bulgarien reisen will, muß sich darauf gefaßt machen, mehrmals sogenannte "Transitgebühren" bezahlen zu müssen. In Calafat ist außerdem eine Umwelt- und Reinigungsgebühr für den Hafen zu entrichten. Von hier fahren Fähren zu dem bulgarischen Vidin. Diese Fährverbindung ist seit Beginn des Krieges das Nadelöhr zwischen Westeuropa, dem Balkan und der Türkei. Vier Fähren sind im Einsatz und die Urlaubszeit hat noch nicht einmal begonnen. Alle zwei Stunden fährt der bulgarische Kapitän Nikolaj Nikolow mit seinem Schiff von einem Ufer zum anderen. Vor dem Krieg fuhr er ein- bis zweimal im Monat nach Deutschland, jetzt muß er seinen Dienst hier leisten. "Als der Krieg in Jugoslawien losging, ist auf uns eine Verkehrslawine zugekommen. Wir arbeiten hier rund um die Uhr, 24 Stunden. Täglich transportieren wir über 300 Lkws. Darauf waren wir nicht vorbereitet", erzählt er.
Die Fähre ist die wichtigste Verkehrsverbindung, denn es gibt im Umkreis von Hunderten Kilometern keine Brücke über die Donau. Das Beladen der Fähre ist jedesmal Maßarbeit. Tonnenschwere Busse und Lkws zwängen sich auf das Schiff. Die private Transportfirma ist bemüht, so viele Fahrzeuge, wie es nur geht, an Bord zu bekommen. Rund 60 Prozent der bulgarischen Warenexporte gehen nach Westeuropa und die müssen alle über die Donau. Hohe Straßengebühren in Rumänien und lange Wartezeiten an der ungarischen Grenze machen der bulgarischen Wirtschaft zu schaffen.
Endstation Donau Schon jetzt ist der Handel mit Gemüse nach Westeuropa zusammengebrochen. Der Transport der frischen Ware per Lkw über Rumänien und Ungarn dauert zwei bis drei Tage länger. Zu viel für die verderbliche Ware. In Plovdiv, der reichsten Gegend Bulgariens, wo auch die meisten Lebensmittel- und Konservenfabriken untergebracht sind, bekommt man die Folgen der Donaublockade zu spüren. Der Direktor des Betriebes Sluntchev Plod, Mateja Fratev, beklagt sich: "In unseren Lagerräumen gibt es noch Gläser mit Paprika, Gurken und Paradeisern vom vergangenen Jahr. Wegen der Transportschwierigkeiten konnten wir unsere Reserven bis heute nicht verkaufen. So waren wir gezwungen, viele Verträge mit unseren Lieferanten zu kündigen."
Aber nicht nur Gurken und Paradeiser finden keinen Absatz mehr. Auch die heurige Ernte von Sonnenblumen und Raps ist in Gefahr. Ein Genossenschaftsbauer, Mitko Petkov, hat im Auftrag einer österreichischen Firma fast 4.000 Hektar Raps bestellt. Das so gewonnene Öl soll zum Biodiesel verarbeitet werden. Der Transport der riesigen Mengen rechnet sich nur mit den Frachtschiffen, die jetzt aber auf der Donau festsitzen. "An dem Geschäft", erzählt Petkov, "hängen Hunderte Arbeitsplätze und die Zukunft meines Betriebes."
Viele ausländische Firmen haben aus Furcht um Lieferungstermine ihren bulgarischen Partnern den Rücken gekehrt und ihre Aufträge storniert. Die Notierungen der Agrarfirmen an der Börse in Sofia sinken ins Bodenlose. Internationale Anleger haben auch schlagartig ihr Geld aus dem Markt zurückgezogen. Der Vorsitzende der bulgarischen Industrie- und Handelskammer in Sofia, Bojidar Bojinov, ist über die Wirtschaft Bulgariens besorgt. "Ich glaube nicht, daß unsere wirtschaftliche Krise durch die vielfach versprochenen Kompensationszahlungen der EU oder der Amerikaner gelöst werden könne.
Vielmehr müßte eine Art Marshallplan für die Balkanländer her. Denn nur durch eine starke Wirtschaft können die ethnischen und religiösen Konflikte der Region entschärft werden. Bulgarien hat bislang 500 Millionen DM verloren und täglich werden es mehr."