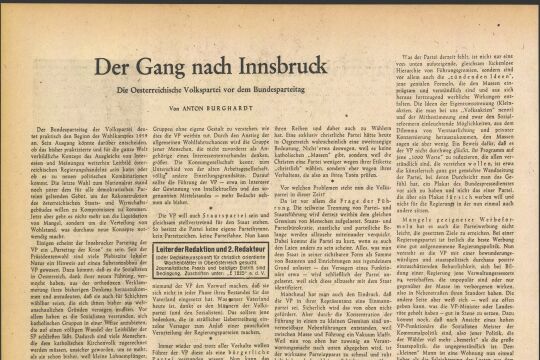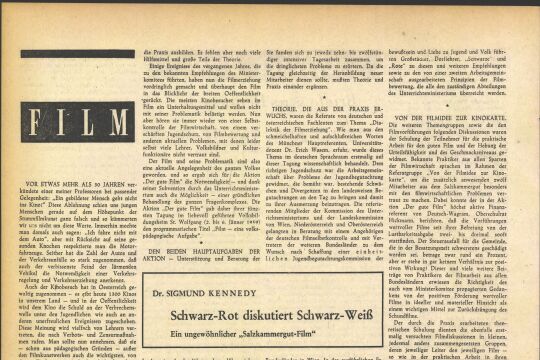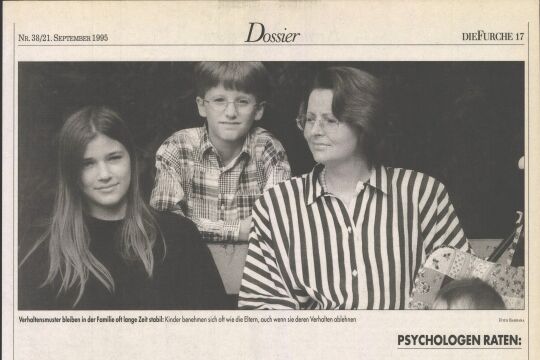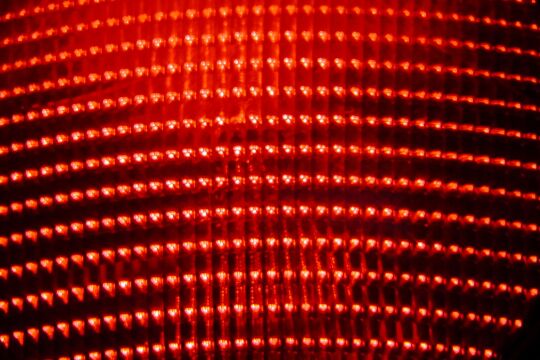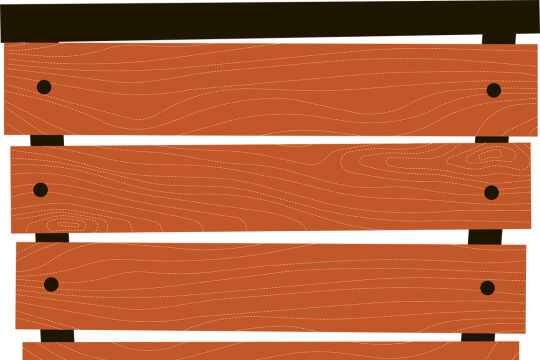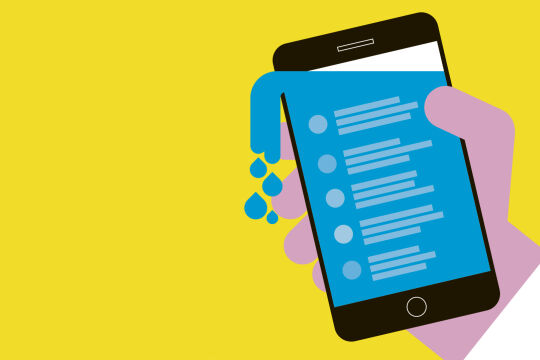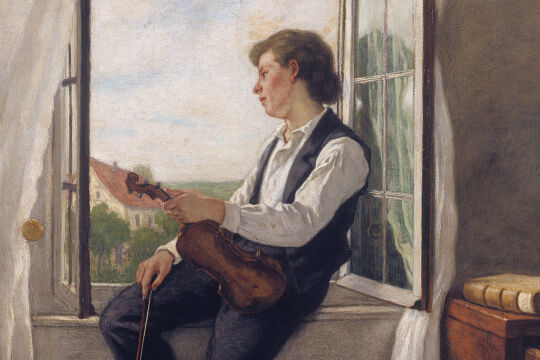"Und irgendwann EXPLODIERT ES"
Fördert Computerspielen die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen? Kulturwissenschafter Harald Koberg sieht hier ganz andere Probleme verborgen.
Fördert Computerspielen die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen? Kulturwissenschafter Harald Koberg sieht hier ganz andere Probleme verborgen.
Ob Videos, bestimmte Computer-Spiele oder Rap-Songs: Die Frage, wie medial vermittelte Gewalt auf Kinder und Jugendliche wirkt, wird kontrovers diskutiert. Anlässlich des Grazer Computerspiel-Festivals "Button 2015"(siehe Kasten) sprach die FURCHE mit dem Spiele-Gutachter Harald Koberg.
DIE FURCHE: Seit über zehn Jahren testen Sie Computerspiele und geben Workshops für besorgte Eltern und Lehrpersonen. Bemerken Sie eine Zunahme der Gewaltbereitschaft bei den spielenden Kindern und Jugendlichen?
Harald Koberg: Nein. Aktuell sind zwar neue Formen der Gewalt wie etwa Cyber-Mobbing feststellbar, aber statistisch gesehen ist Gewalt bei Kindern und Jugendlichen rückläufig. Man darf hier eines nicht vergessen: Bislang hat sich noch jede Generation über das Verhalten der nächstfolgenden beschwert; Schon aus der Antike sind uns Texte überliefert, in denen vor der zunehmenden Verrohung der Jugend gewarnt wird, etwa bei Aristoteles oder Sokrates. Jugendliche selbst werden dabei viel zu selten befragt. In der Jugendforschung ist es erst in den 1970ern, also erschreckend spät, Usus geworden, Jugendliche als Akteure ihrer eigenen Kultur zu verstehen und nicht nur als Interpreten der vorhandenen.
DIE FURCHE: Was macht die Faszination von Computerspielen für Kinder und Jugendliche aus?
Koberg: Bei Bildschirmspielen geht es vorrangig nicht um Inhalte, sondern um Spieldynamiken. In meiner Workshop-Arbeit mit Jugendlichen habe ich herausgefunden, dass der Grad der Aufregung während des Spiels selbst nichts mit den erzählten Inhalten zu tun hat. Es geht also nicht darum, ob ich Krieg spiele oder Auto fahre, sondern darum, wie stark Emotionalität zustande kommt und ob das Spiel Frustrationsmomente schafft oder verhindert. "Ego-Shooter", die online gespielt werden, schaffen sehr kurze Frustrationsmomente: Ich werde erschossen und kann ein paar Sekunden später wieder starten. Hier ist das Frustrationspotenzial nicht groß. Was Jugendliche hingegen viel mehr aufregt, sind realitätsnahe Simulationen wie sie etwa in Fußballspielen am Computer vorkommen: 90 Prozent der von mir befragten Jugendlichen regen sich hier etwa beim Spiel "FIFA" auf. Jugendliche wollen spielen, weil es das ist, was sie von Erwachsenen trennt. Was außerdem Reiz ausübt, ist die Freiheit, moralisch experimentieren zu können. Das wiederum stellt oft ein Problem für die Eltern dar. Die meisten der von mir interviewten Jugendlichen kommen aus so genannten 68er-Elternhäusern, das heißt, ihre Eltern sind pazifistisch und liberal eingestellt. Gegen eine solche Elterngeneration zu rebellieren ist nicht einfach. Bildschirmspiele bieten da einen willkommenen Anlass, diesen toleranten Eltern endlich auf die Nerven gehen zu können, sich an ihnen reiben zu können.
DIE FURCHE: Aggression spielt hier also doch eine Rolle?
Koberg: Wir tun so, als hätte ein ordentlicher Mensch, der sich unter Kontrolle hat, keine Notwendigkeit, auch einmal Dampf abzulassen. Ein Thema, das hinter der ganzen Diskussion über mögliche Zusammenhänge zwischen Computerspielen und Gewalt liegt, ist: Was dürfen wir überhaupt noch, wenn wir einmal sauer sind? Kindern wird kaum noch Umgang zugestanden mit ihrer Aggression und Wut. Es gibt in unserer Gesellschaft keine akzeptierte Form der Aggressionsäußerung mehr - das ist das Problem. Kinder und Jugendliche halten das ganz lange im Kochtopf und irgendwann explodiert es. Der Pazifismus, der uns prägt, ist kein reflektierender, sondern ein beiseite-schiebender.
DIE FURCHE: Die Angst vor einem negativen Einfluss des Computerspielens ist somit unbegründet?
Koberg: Wer in einem gesunden sozialen Umfeld aufwächst, für den stellen Computerspiele keine Gefahr da. Grundsätzlich ist der Lebensalltag der Kinder ein guter Indikator dafür, wie mit Computerspielen umgegangen wird: Wenn die schulischen Leistungen passen, wenn sozialer Umgang mit Freunden da ist, wenn Sport gemacht wird, dann stört meistens auch ein hohes Zeitpensum an Spielen nicht. Aufmerksam werden sollten Eltern, wenn Aktivitäten im sozialen Bereich weniger werden. Das führt für mich zum entscheidenden Punkt, dass Bildschirmspiele und die Diskussion rund um sie oft Themen zutage treten lassen, die auch ohne sie vorhanden wären: Wie ist es mit Sozialkontakten, mit Aggression, mit der Fähigkeit zu verlieren?
DIE FURCHE: Heißt das generell, dass die Debatte über Computerspiele in eine falsche Richtung läuft?
Koberg: Tatsächlich halte ich die Diskussion, so wie sie seit Jahren geführt wird, für problematisch. Der Diskurs über den Zusammenhang von Computerspielen und Gewalt entpuppt sich letztlich als reiner "Wohlfühldiskurs", der dazu da ist, andere Themen zu verdecken. Komplexere Fragen wie soziale Ausgrenzung, Zugang zu Waffen oder Frustration im Bildungswesen können damit wunderbar zur Seite geschoben werden. Der deutsche Anthropologe Kaspar Maase schreibt, dass die Elterngeneration Sündenböcke braucht, damit sie nicht selbst in der Verantwortung stehen muss für das, was Jugendliche tun. Wer die bösen Medien beschuldigt, gegen die man nicht ankommt und die man verantwortlich macht für das, was Kinder tun, braucht sich selbst nicht in die Verantwortung zu rufen. Insofern besteht kein Interesse, sich in seiner Meinung zu hinterfragen. Ein solches Verhalten dient dem eigenen Wohlbefinden und dazu, sich viele selbstkritische Fragen zu ersparen.
Die Furche: Wie sollen Eltern vorgehen, wenn Kinder beginnen, Bildschirmspiele für sich zu entdecken?
Koberg: Das Wichtigste ist, die Kritikfähigkeit des Kindes zu überprüfen, indem man einfache Fragen stellt: Warum spielst du, was macht dir Spaß daran? Durch im Alltag geführte Gespräche kann man gut herausfinden, ob das Kind reflektieren kann oder nicht. Kinder können ja bereits ab dem vierten Lebensjahr zwischen Virtualität und Realität unterscheiden. Grundsätzlich rate ich dazu, mit Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren klare Regeln auszumachen. Erfahrungsgemäß wird das Zeitpensum später immer schwerer kontrollierbar, weil die Kinder den Computer dann auch für die Schule brauchen. Parallel dazu sollen Eltern versuchen, ihre eigene Medienkompetenz weiter zu entwickeln.
Die Furche: Sie selbst spielen auch gern und viel. Wo liegt denn für Sie der besondere Reiz?
Koberg: Ich selbst komme aus einem medienarmen Elternhaus. Mein Vater hatte zwar früh einen Computer, aber hauptsächlich zum Arbeiten. Mein wirklicher Computerspiel-Einstieg war im frühen Erwachsenenalter, als ich anfing, als Spiele-Gutachter zu arbeiten. Was für mich den Reiz an Bildschirmspielen ausmacht, ist der Ehrgeiz, etwas schaffen zu können. Die größte Faszination und zugleich das Alleinstellungsmerkmal dieses Mediums ist, dass man in Welten eintauchen und Abenteuer selbst beeinflussen kann. Im Gegensatz zu Filmen habe ich hier die Möglichkeit dazu. Die Verbindung von Geschichten-Erleben und sie zugleich mitzubestimmen ist es, was Bildschirmspiele für mich einzigartig macht.