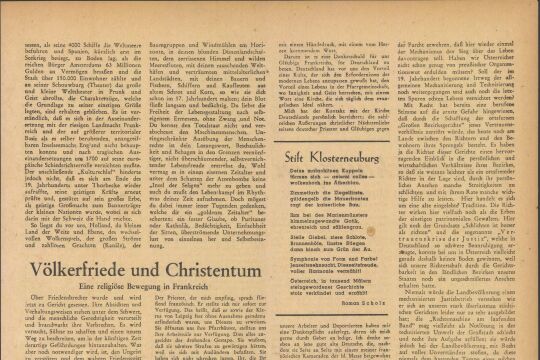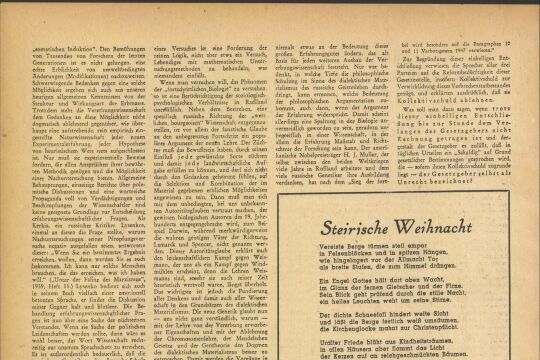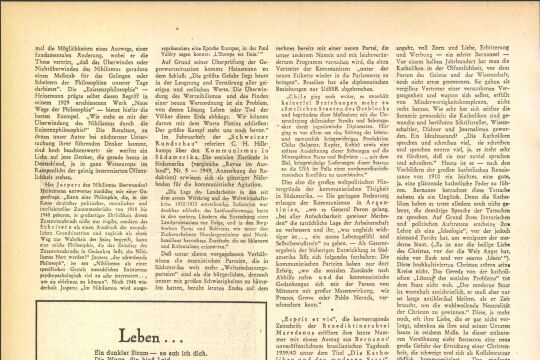Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Laie als Richter
Die Laiengerichtsbarkeit, die Teilnahme juristisch nicht vorgebildeter Staatsbürger an der Rechtsprechung im allgemeinen, an der Strafrechtspflege im besonderen, ist eine Idee der demokratischen Strömungen und ist auch als solche über Großbritannien und Frankreich nach Mitteleuropa gekommen. Zwar gab es bereits im Karolingerreich „Schöffengerichte“, doch wurden diese Institutionen im Laufe des Mittelalters zurückgedrängt, um mit dem Aufkommen des Inquisitionsprozesses (Constitutio Criminalis Carolina, 1532) völlig zu verschwinden. Erst als Protest gegen den Absolutismus und seinen nichtöffentlichen Inquisitionsprozeß wurde die Forderung nach Beteiligung von Laien an der Strafrechtspflege erhoben. In Österreich zwischen 1848 und 1852 für kurze Zeit Bestandteil des Strafverfahrens, wurde die Laiengerichtsbarkeit in die von Julius Glaser entworfene Strafprozeßordnung 1873 als fester Bestandteil aufgenommen.
In der geltenden Verfassung ist die Laiengerichtsbarkeit im Art. 91 festgelegt:
•Das Volk hat an der Rechtsprechung mitzuwirken.
• Bei den mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, die das Gesetz bezeichnet hat, sowie bei allen politischen Verbrechen und Vergehen entscheiden Geschworene über die Schuld des Angeklagten.
• Im Strafverfahren wegen anderer strafbarer Handlungen nehmen Schöffen an der Rechtsprechung teil, wenn die zu verhängende Strafe ein vom Gesetz zu bestimmendes Maß überschreitet.
Nach, einheitlicher Interpretation des Art. 91 B-VG sind unter Geschworenen (nach der Strafprozeßordnung „Geschworne“) solche Laienrichter zu verstehen, die allein über die Schuldfrage entscheiden, und zwar nach Beratung unter Ausschluß der Berufsrichter. Die Entscheidung über die Strafe steht grundsätzlich den Berufsrichtern zu. Schöffen hingegen sind Laienrichter, die gemeinsam mit den Berufsrichtern über Schuld und Strafe entscheiden.
Die Teilnahme der Laien an der Rechtsprechung soll die Unabhängigkeit des Gerichtes verbürgen, die durch die Berufsrichter mit ihrem geringeren Abstand von der Staatsgewalt nicht genügend gewährleistet erscheint. Der Vorteil der Geschwormengerichte gegenüber den Schöffengerichten ist, daß die Geschwor-nen, die durch das System der Alleinberatung der unmittelbaren Beeinflussung durch die Berufsrichter entzogen sind, allein und damit so unabhängig wie nur möglich über die Schuld des Angeklagten entscheiden. Der Nachteil aber ist, daß Staatsbürger, die in den meisten Fällen mit der Rechtsordnung nicht näher vertraut sind, sich plötzlich einer Aufgabe gegenübersehen, welche die verantwortungsvollste juristische Tätigkeit überhaupt ist: zu richten. Dieser Aufgabe oft nicht gewachsen, flüchten sich die Geschwornen in eine Haltung, die keine richterliche mehr ist. Sie prüfen dann nicht mehr, ob ein bestimmter konkreter Sachverhalt unter einen strafrechtlichen Tatbestand zu subsumieren ist, sondern sie fällen unbelastet vom positiven Recht Werturteile. Sie glauben, nicht an das gesatzte Recht gebunden zu sein, sondern das, was sie für „Recht“ halten, an Stelle des Gesetzes höranziehen zu können — nicht zuletzt, weil ihnen dieses Gesetz als oft undurchdringliches Dickicht entgegentritt. Sie glauben, nicht das Gesetz durch ihren Spruch vollziehen zu müssen, sondern über dem Gesetz zu stehen. Wenn aber an die Stelle der Gesetze sehr unterschiedliche private Wertungen treten, sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit in Gefahr.
Gegen diese Tatsachen wiegt auch das Argument wenig, daß dann, wenn vom Angeklagten verlangt wird, er müsse trotz Unkenntnis des Gesetzes Recht und Unrecht unterscheiden können, dies auch für Geschworne gelte. Tatsache ist, daß die Geschichte der österreichischen Geschwornengerichte verbunden ist mit einer Kette von offensichtlichen Fehlurteilen1. Dies ist vom Standpunkt der Rechtssicherheit um so bedenklicher, als der Wahrspruch der Geschwornen nur wegen Irrtums in der Rechtsfrage (error iuris) im ordentlichen Rechtsweg angefochten werden kann, nicht aber wegen Irrtums in der Tatfrage (error facti). Im Falle eines solchen Irrtums hat der aus drei Berufsrichtern bestehende Schwurgerichtshof nur die Möglichkeit, wegen offensichtlichen Irrtums in der Hauptfrage einstimmig den Wahrspruch der Geschwornen auszusetzen ( 334 StPO). Der Oberste Gerichtshof verweist dann diese Rechtssache an ein anderes Gesohwornengericht. Stimmt jedoch der Wahrspruch der zweiten Geschwornenbank mit dem der ersten überein, so ist dieser Spruch bezüglich der Tatfrage irreparabel. Aber auch der Umstand, daß Urteile der Geschwornengerichte nicht begründet werden, ist ein fast unerträglicher Anachronismus. Im Strafverfahren herrscht also der Grundsatz, je wichtiger die Strafsache, desto unwichtiger ist eine rationale Begründung des Spruches.
Besonders unglückliche Auswirkungen hatten Urteile von Geschwornen in politischen Prozessen. Blicken wir in die Geschichte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!