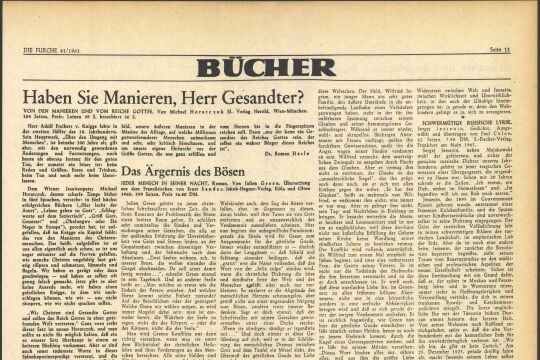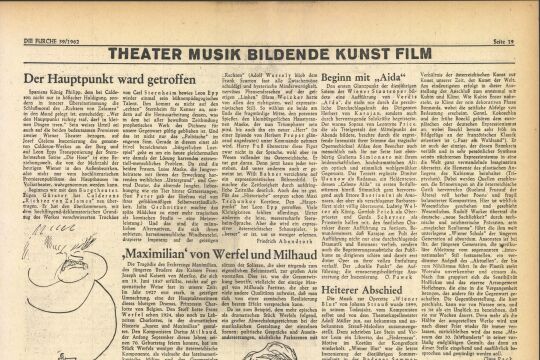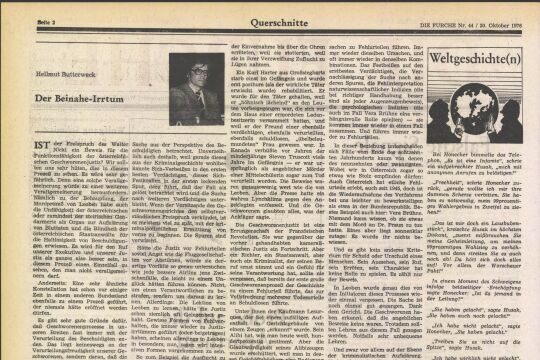Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Urteil über Tod und Leben
Wieder führt uns ein Theaterstück von der ersten bis zur letzten Szene eine Gerichtsverhandlung vor. Allerdings diesmal eine fiktive: Geschworene sind wegen eines zu milden Urteils angeklagt. Das hat es wohl nie gegeben. „Das Fehlureil“ heißt diese „Verhandlung in zwei Tetilen“ von Helmut Schwarz, die dieser Tage im Volkstheater urauf- geführt wurde. Fehlurteile haben in der letzten Zeit in Kriegsverbrecherprozessen Empörung verursacht, berechtigt wendete sich der Unwille gegen die jeweiligen Geschworenen. Aber liegt in dem Stück von Helmut Schwarz ėin Fehlurteil vor? Jünger und Streich, zwei ehemalige Schutzpolizisten, die in dieser Verhandlung nicht auftreten, waren in früheren Prozessen angeklagt, im Jahr 1943 drei jugoslawische Zivilisten bei einer „Säuberungsaktion“ getötet zu haben. Sie wurden aber nicht als Mittäter zu lebenslänglichem Kerker, sondern nur als Gehilfen einer Mordtat zu lediglich vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Jene Geschworenen nun, die dieses mildere Verdikt bewirkten, sind wegen ihres „Fehlurteils“ angeklagt, obwohl Beweise, eindeutige Indizien, wie sich zeigt, für die Mittäterschaft der beiden ehemaligen Schutzpolizisten nicht mehr zu erbringen sind.
Die Geschworenen gaben ihr Urteil aus sehr persönlichen Motiven ab, aus der Nachwirkung eigener kriegsbedingter Erlebnisse, aus Ressentiments. Deshalb fordert der Verteidiger in seinem Plädoyer, daß die Urteilsfindung in Kriegsverbrecherprozessen künftig allein Berufsrichtern Vorbehalten bleiben solle. Aber die Berufsrichter könnten im vorliegenden Fall aus rein juridischen Gründen zu keinem anderen Urteil gelangen als die an- geklagten Geschworenen aus ihren privaten Motiven, wollen sie flicht das Recht brechen. Auch sie könnten, lediglich deshalb, weil sie einer Aussage nicht glauben, keineswegs ein „Lebenslänglich“ aussprechen.
Dieser Fall eignet sich somit nicht dafür, das Heranziehen von Geschworenen bei Kriegsverbrecherprozessen zu desavouieren. Helmut Schwarz scheint das zu spüren, er wählt einen „offenen“ Schluß, indem er uns, die Zuschauer, zum Urteil aufruft. Das szenische Geschehen beeindruckt durch eine überaus klare Herausarbeitung vielfältiger, gegensätzlicher Einstellungen zur Problematik der Kriegsverbrecherprozesse, wobei das dichte Gewebe rein rationaler Argumentationen vereinzelt Emotionales umschließt. Letztlich warnt die kühle Unbestech lichkeit des Autors verdienstvoll davor, politische Emotionen in die Rechtsfindung einbrechen zu lassen. Jedenfalls bietet hier ein österreichischer Dramatiker einen wertvollen szenischen Beitrag zur Bewältigung einer unserer drängendsten Fragen. (Doch daß einer der beiden Kriegsverbrecher „Ernst Jünger“ hieißt, ist entschieden abzulehnen.)
Leon Epp gelingt als Regisseur eine vortreffliche Wiedergabe, wobei das Rationale ebenso beeindruckt wie das Emotionale. Die Leistungen aller zehn Mitwirkenden, von Hans Rüdgers als Richter bis zu Benno Smytt als jüdischer Geschworener, erweisen sich als völlig gleichwertig. Das fragmentarische Bühnenbild stammt von Rudolf Schneider- Manns Au.
In einer Zeit, da die Elementarereignisse im politischen Weltgeschehen überschäumen, wirkt das Elementare im individuellen Bereich auf der Bühne eng und damit mehr und mehr antiquiert. Das gilt auch für das von Ferdinand Bruckner im Jahr 1939 geschriebene Schauspiel „Fährten“ — es wird derzeit vom Volkstheater in den Wiener Außenbezirken wiedergegeben —, das ein Urgefühl als eine letztlich siegende Urkraft vorführt. Die Magd Lene ärwartet vom Gutsherrn Pless, der sich von ihr abwenden will, ein Kind. Ihre „Fährte“ ist der fanatische Glaube an das Recht des werdenden Geschöpfs, weshalb sie einen Meineid begeht, um zu erreichen, daß dem Kind der Vater erhalten bleibe.
Man hat an diesem naturalistischen Stück die Kunst des Dramenbaus gelobt, heute spüren wir viel zu sehr die Mache. Ja, Bruckner scheut sich nicht, den brutal unbekümmerten Pless am Schluß plötzlich unglaubhaft bereit zu zeigen, daß er Lene heiraten werde. Die Diktion ist oftmals zu intellektuell, den Gestalten nicht angemessen, Banalitäten fehlen nicht. So holt Gustav Manker in der Aufführung aus dem Stück, was sich bei der gegebenen Besetzung herausholen läßt. Ingrid Fröhlich ist eine verhalten fanatische Lene, bleibt aber etwas monoton. Dem sympathischen Rudolf Strobl glaubt man die Brutalität des Pless nicht. Das milieugerechte Bühnenbild schuf Brigitte Brunmayr. Es ist durchaus möglich, daß das Stück in den Außenbezirken — die Premiere fand im Haupthaus statt — besonders bei den Frauen Erfolg hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!