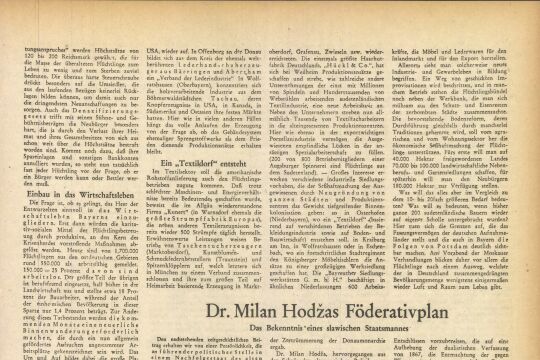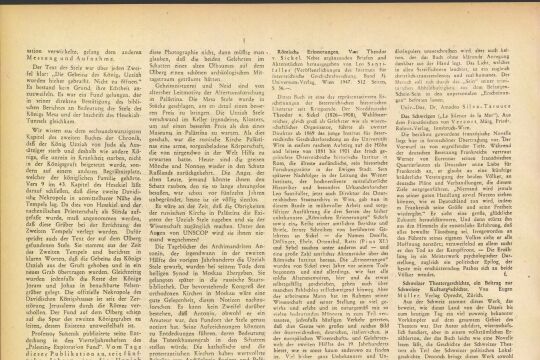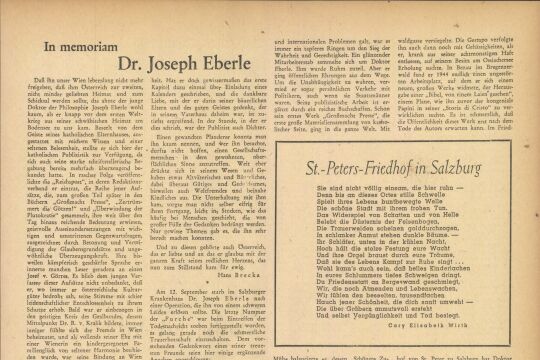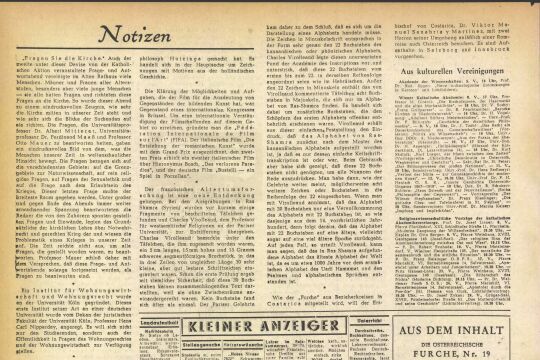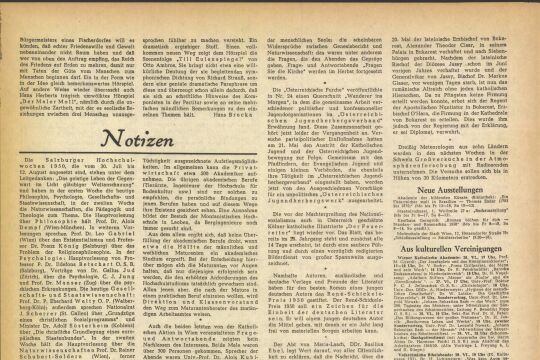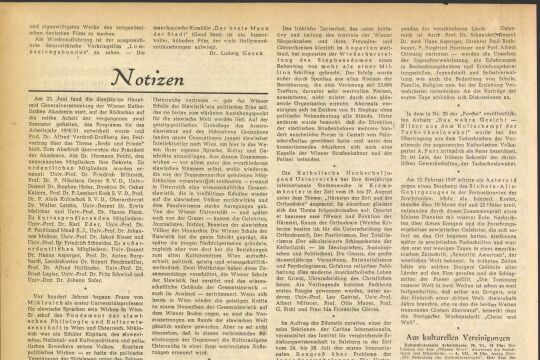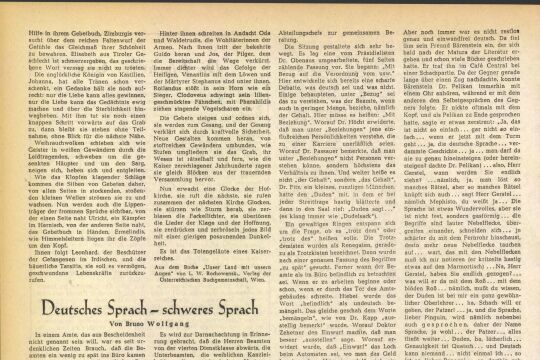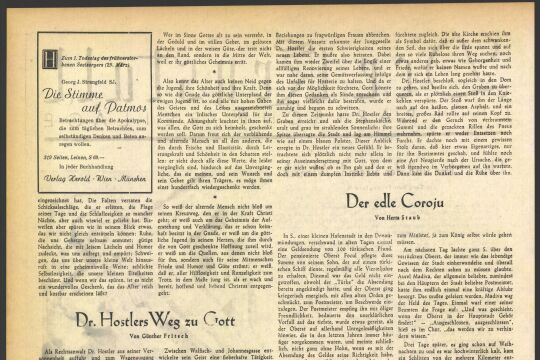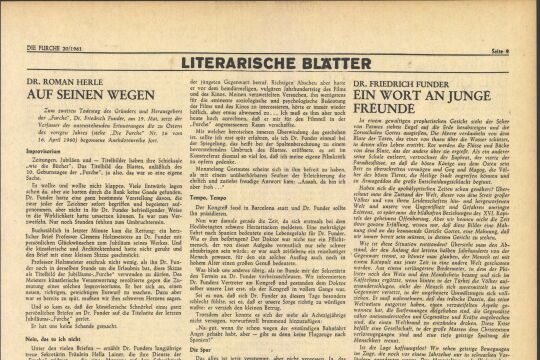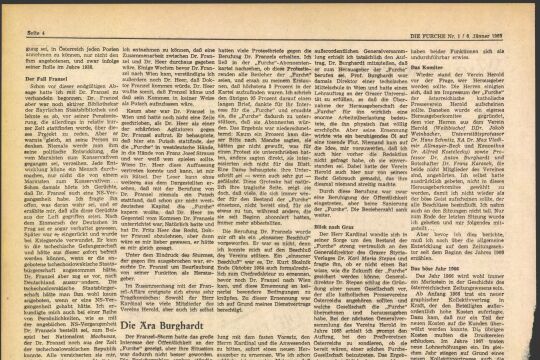Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vergebliche Bemühungen
Die Herren sahen eine längere Verhandlungszeif voraus und ernannten mich deshalb für die Zwischenzeit zum Herausgeber und Chefredakteur. Dr. Skalnik, der stellvertretender Chefredakteur geworden war, wünschte den Titel eines geschäftsführenden Chefredakteurs. Wir schlossen dann einen Kompromiß, nach dem ich nach außen hin nicht als Chefredakteur auftreten würde, so daß alle Welt der Meinung sein konnte, Dr. Skalnik sei der Chefredakteur.
Gemäß meinem Auftrag fuhr ich nach Deutschland und traf mich mit Dr. Böhm. Ich fuhr sehr oft und versuchte immer wieder Dr. Böhm zu überreden, das Anbot anzunehmen. Ich glaubte, niemals in meinem Leben habe ich so intensiv versucht, eine Persönlichkeit für das Haus Herold zu gewinnen wie Dr. Böhm. Die Verhandlungen zogen sich buchstäblich über Jahre hinaus. Dr. Böhms Einstellung zu dem Anbot schwankte sehr. Seine Befürchtung, er könne Dr. Skalnik verdrängen, konnte ich sofort beruhigen, denn er sollte ja nicht Chefredakteur, sondern Herausgeber werden. Dr. Böhm wollte gerne nach Österreich zurückkehren und sah dieses Anbot als eine große Chance an, diese Sehnsucht zu erfüllen. Anderseits fürchtete er, seine seinerzeitige Rolle im Haus Herold werde ihm trotz der Versicherung des Vereins Herold in der Öffentlichkeit doch übel anigekreidet werden.
Einmal aber bekam ich doch eine endgültige feste Zusage, und kurz darauf — ein endgültige Absage. Dr. Böhm schrieb mir, daß er nicht nach Österreich zurückkommen könne, und zwar aus zwei Gründen: einem innerlichen und einem äußerlichen: Dr. Roegcle, der Chefredakteur des „Rheinischen Merkur“, war Professor für Zeitungswissenschaften an der Münchner Universität geworden und übernahm die Rolle eines Herausgebers des „Merkurs“. Wenn er, Dr. Böhm, der jetzt Chefredakteur des „Merkur“ werden solle, diesen auch noch verlassen würde, müßte er um die Linie des Blattes fürchten. Dies war der äußere Grund. Der innere war, daß er der Überzeu-gung sei, in Österreich jeden Posten annehmen zu können, nur nicht den ihm angebotenen, und zwar infolge seiner Rolle im Jahre 1938.
Der Fall Franzei
Schon vor dieser endgültigen Absage hatte ich mit Dr. Franzei zu verhandeln begonnen. Dr. Franzei aber war noch aktiver Bibliothekar der Bayrischen Staatsbibliothek und lehnte es ab, vor seiner Pensionierung, die allerdings in relativ kurzer Zeit stattflnden werde, über dieses Projekt zu reden. Aber er warnte gleich, an seine Person zu denken. Niemals werde man ihm seine politische Entwicklung, die vom Marxisten zum Konservativen gegangen sei, verzeihen. Jede Entwicklung könne ein Mensch durchmachen, nur nicht die von einem Marxisten zum Konservativen ... Schon damals hörte ich Gerüchte, daß Dr. Franzei auch eine NS-Ver- gangenheit habe. Ich fragte ihn offen, was daran wahr sei, und er erzählte mir, daß alle diese Gerüchte aus der Luft gegriffen seien. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Prag sei er sogar verhaftet gewesen. Später war er eingerückt und wurde bei Kriegsende verwundet. Er kam in die tschechische Gefangenschaft und hätte aus dieser sofort befreit werden können, wenn er die angebotene tschechoslowakische Staatsbürgerschaft angenommen hätte. Dr. Franzei aber zog es vor, nach Deutschland auszu—andern. Die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft hätte man ihm wohl kaum angeboten, wenn er eine NS-Ver- gangenheit gehabt hätte. Ich erkundigte mich auch bei einer Reihe von Persönlichkeiten, wie es mit der angeblichen NS-Vergangenheit Dr. Franzeis bestellt sei, zum Beispiel bei Nationalrat Machunze, der Dr. Franzei noch aus der Zeit der tschechoslowakischen Republik kannte. Alle versicherten sie mir, daß ihnen nie etwas Ähnliches zu Ohren gekommen wäre. Prälat Dr. Kindermann, Leiter des Institutes in Könlgsfeim, heute auch Weihbischof von Limburg, einst Professor an der theologischen Fakultät in Prag, versicherte, daß Dr. Franzei einer der überzeugtesten Katholiken sei, die er kenne.
Als Dr. Böhm endgültig abgesagt hatte und Dr. Franzei inzwischen pensioniert worden war, fragte ich deshalb neuerlich bei ihm an, ob er nicht doch die Stelle eines Herausgebers — ich wiederhole Herausgebers und nicht Chefredakteurs — der österreichischen „Furche“, an deren Seite eine mutierte Ausgabe für Süddeutschland treten solle, übernehmen möchte. Dr. Franzei zögerte und zögerte. Aber die „Sehnsucht nach den alten Gassen“ war in ihm doch einmal stärker, und so sagte er zu und erklärte sich bereit, ab 1. November 1964 die Funktion eines Herausgebers der „Furche“ zu übernehmen.
Als Dr. Franzei am 2. November 1964 zu mir ins Herold-Haus in Wien kam, war der Plan der süddeutschen Ausgabe bereits gestorben, und alle Aufregung, die darüber in der Öffentlichkeit entstand, war eigentlich umsonst. Der Leiter des Zeitschriftenverlags, Direktor Maximilian Heine-Geldern, ein begeisterter Anhänger des Planes, hatte am 30. Oktober 1964 um 18 Uhr im Büro mit mir noch über die kommende Neuordnung gesprochen. Um 20.30 Uhr erlag er im Alter von 49 Jahren einem Herzinfarkt. Ich hatte einen der besten und treuesten Freunde und Mitarbeiter verloren. Mit ihm starb auch das geplante Projekt, denn Direktor Heine-Geldern mit seinen Fähigkeiten wäre wohl der einzige gewesen, der organisatorisch dieses Projekt hätte durchführen können.
Einige Monate bevor Dr. Franzei nach Wien kam, hatte ich nicht nur mit Dr. Herle, sondern auch mit Dr. Heer gesprochen und den beiden Herren mitgeteilt, daß möglicherweise Dr. Franzei nach Wien kommen werde. Im Sommer 1964 hatte ich Dr. Heer und Dr. Franzei zu einem Mittagessen im Kerzenstüberl eingeladen und die beiden Herren gebeten, sie möchten sich aussprechen und offen erklären, ob sie Zusammenarbeiten könnten. Ich betrachtete es als eine der wichtigsten Grundlagen des neuen Plans, daß eine reibungslose Zusammenarbeit aller Herren stattflnden würde. Ich hatte die Zusicherung Dr. Franzeis, daß er keinerlei personelle Veränderungen vornehmen werde. Aus dem Ergebnis dieser Unterredung glaubte ich entnehmen zu können, daß eine Zusammenarbeit zwischen Dr. Franzei und Dr. Heer durchaus gegeben wäre. Einige Wochen bevor Dr. Franzei nach Wien kam, verständigte Ich außerdem noch Dr. Heer, daß Doktor Franzei kommen würde. Dr. Heer wußte somit, daß Franzei käme und daß sein Kommen in keiner Weise als Putsch aufzufassen wäre.
Kaum aber war Dr. Franzei in Wien und hatte noch nicht eine Zeile geschrieben, als Dr. Heer als einer der schärfsten Agitatoren gegen Dr. Franzöl auftrat. Er behauptete, daß hier ein Putsch stattflnde, der die „Furche“ in westdeutsche Hände, in die Hände von Franz Josef Strauss und wer weiß wen spielen sollte. Wieso Dr. Heer diese Auffassung vertreten konnte und kann, ist mir ein Rätsel. Der Leser kann ohne weiteres aus dem Dargestellten ersehen, daß mit der Berufung von Dr. Franzei niemals ein Putsch stattfand, daß schon gar nicht westdeutsches Kapital die „Furche" kapern wollte, daß Dr. Heer im Gegenteil vom Kommen Dr. Franzeis unterrichtet war. Natürlich hatte und hat Dr. Fritz Heer da® Recht, Doktor Franzei abzulehnen, aber dann wäre es mir Heber gewesen, er hätte es mir gleich gesagt.
Unter dem Eindruck des Sturmes, der gegen ihn ausgebrochen war, ersuchte Dr. Franzei um Beurlaubung von seiner Funktion als Herausgeber.
Im Zusammenhang mit der Fran- zel-Affäre ereignete sich etwas sehr Tragikomisches: Sowohl der Herr Kardinal wie viele Mitglieder des Vereins Herold, aber auch ich selbst hatten viele Protestbriefe gegen die Berufung Dr. Franzeis erhalten. Ich ließ in der „Furche“-Abonnenten- kartei nachsehen, ob diese Protestierenden alle Bezieher der „Furche“ seien, und ersah zu meinem Erstaunen, daß höchstens 5 Prozent in der Kartei aufzufinden waren. Ich schrieb den übrigen 95 Prozent darauf einen langen Brief, dankte für ihr Interesse für die „Furche“ und ersuchte sie, die „Furche“ dadurch zu unterstützen, daß sie Abonnenten würden. Das Ergebnis war niederschmetternd: Kaum ein Prozent kam dieser Bitte nach. Manche sagten, sie hätten gar nicht gewußt, was für einen Protest sie unterschrieben hatten, andere sagten direkt, sie interessierten sich nicht für das Blatt. Eine Dame behauptete, ihre. Unterschrift sei — wenn auch sehr gut — gefälscht. Diese Groteske hat natürlich ihre tragische Seife, zeigt sie doch, daß viele, die sich immer wieder für den Bestand der „Furche" einsetzen, nicht bereit sind, für sie etwas zu tun, während andere, die sie seit Beginn abonniert hatten, immer mehr abbestellten.
Die Berufung Dr. Franzeis wurde mir oft als ein „einsamer Beschluß“ vorgeworfen. Er war es nicht, denn ich konnte mich auf den Beschluß des Vereins stützen. Ein „einsamer Beschluß" war es, Dr. Kurt Skalnik Ende Oktober 1964 auch formalrecht- lich zum Chefredakteur zu ernennen, bevor noch Dr. Franzei nach Wien kam, und diese Ernennung an keinerlei besondere Bedingungen zu knüpfen. Zu dieser Ernennung war ich auf Grund meines Dienstvertrags berechtigt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!