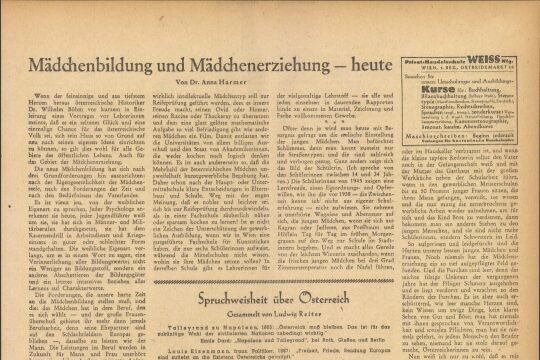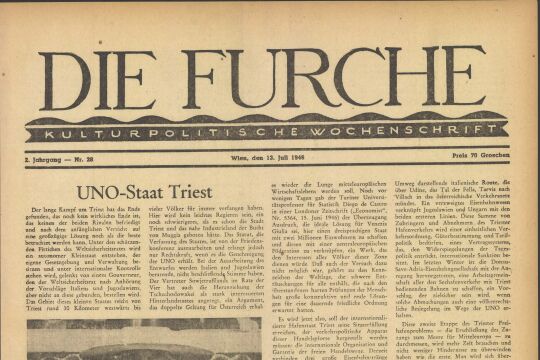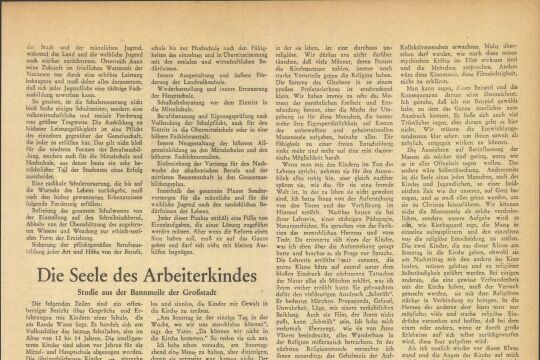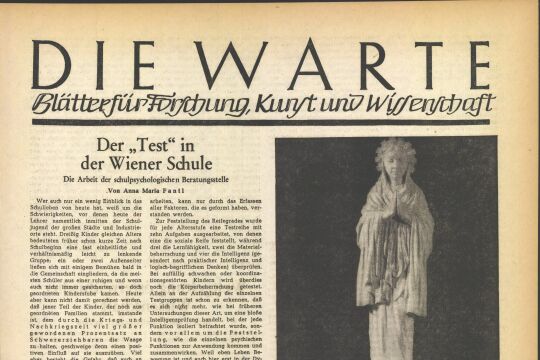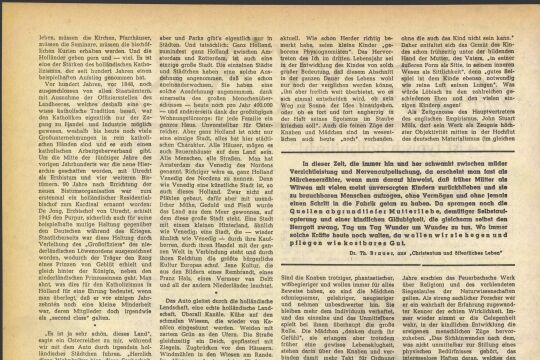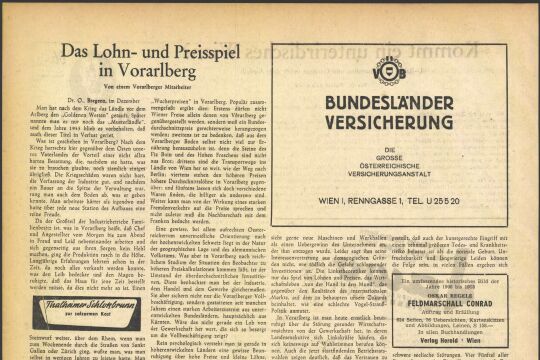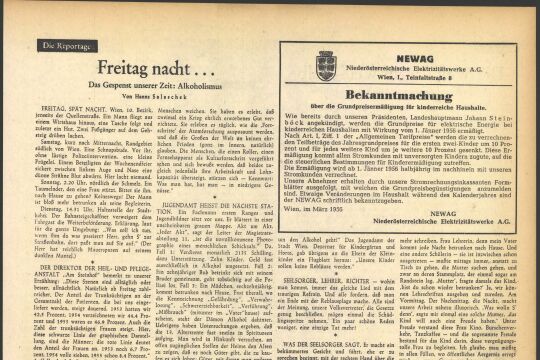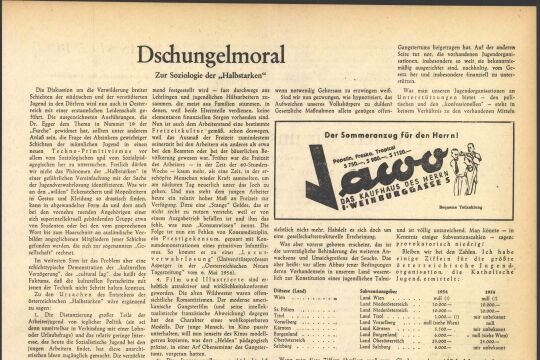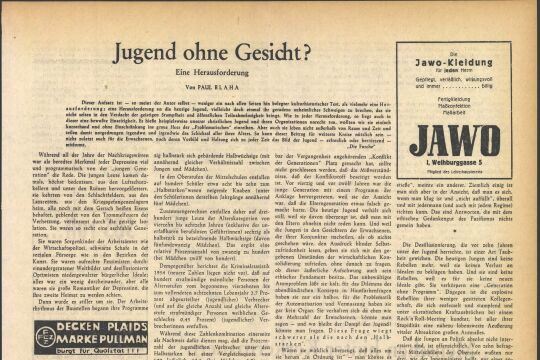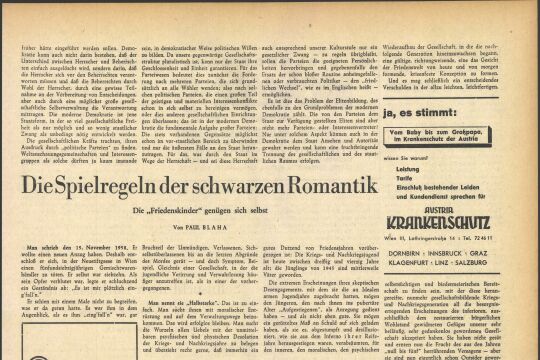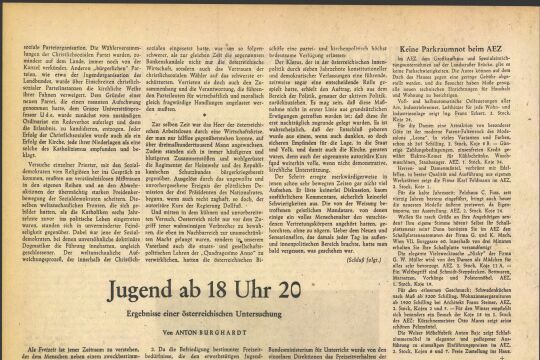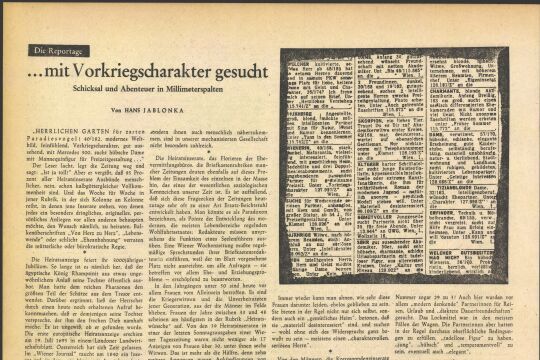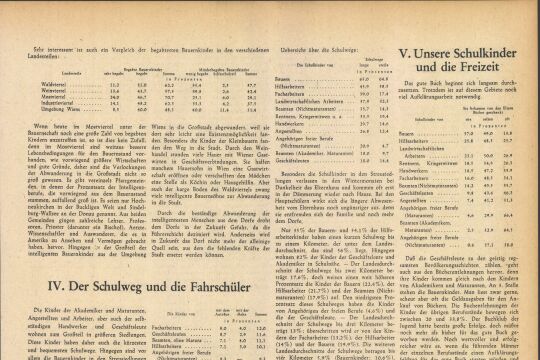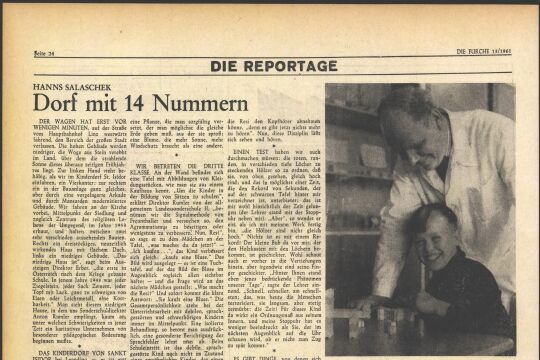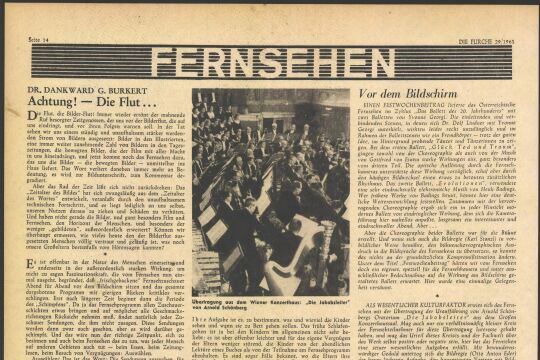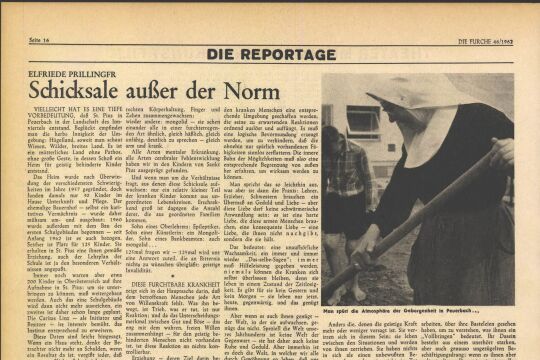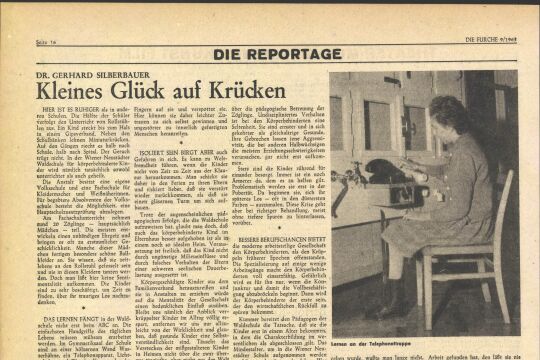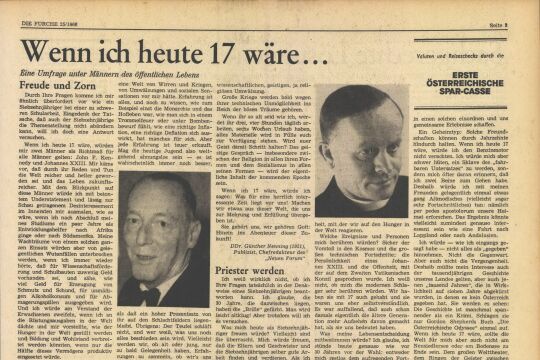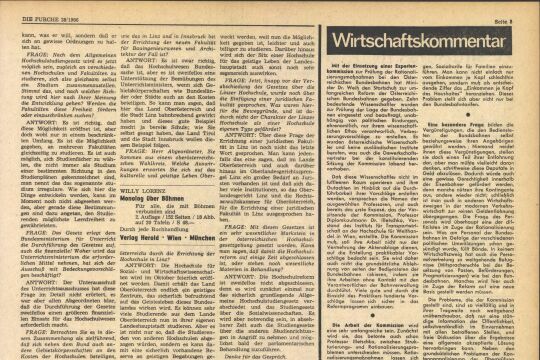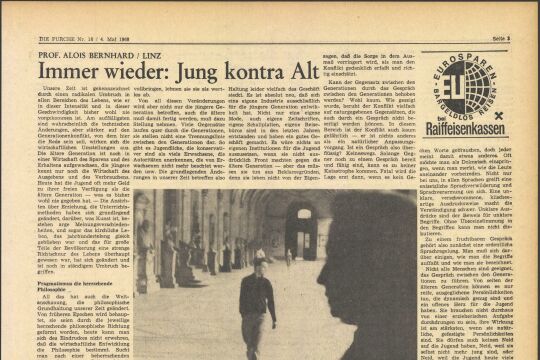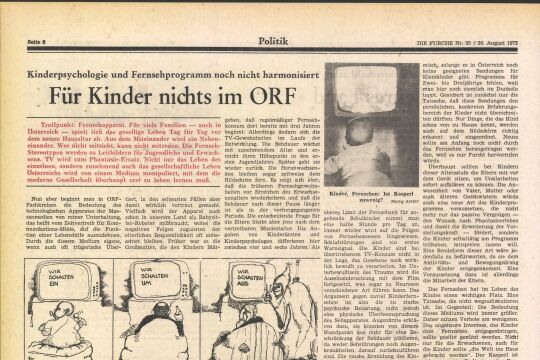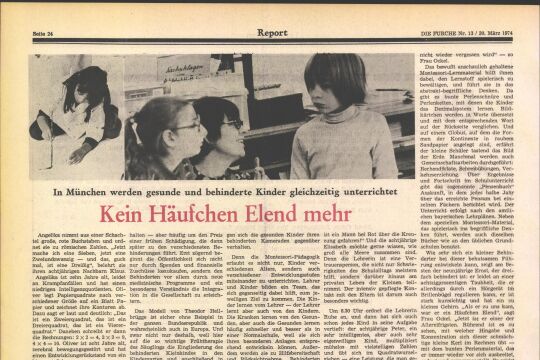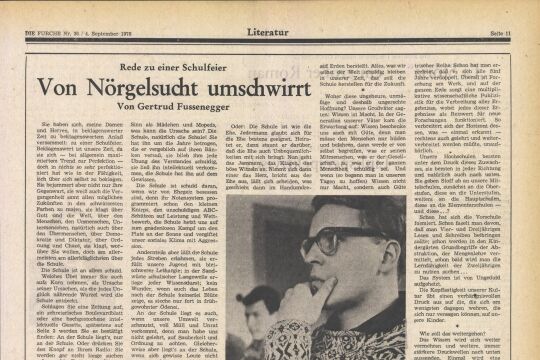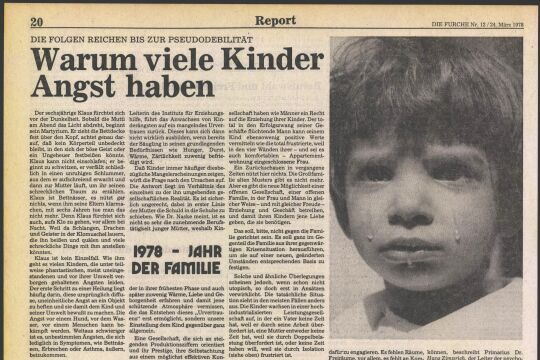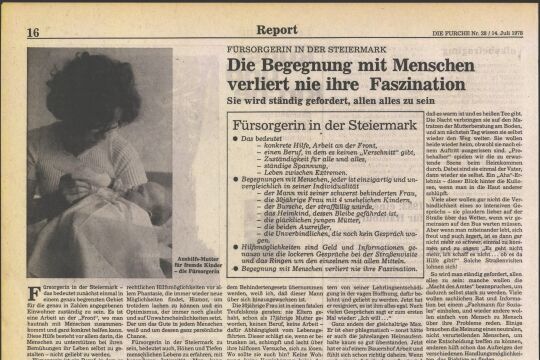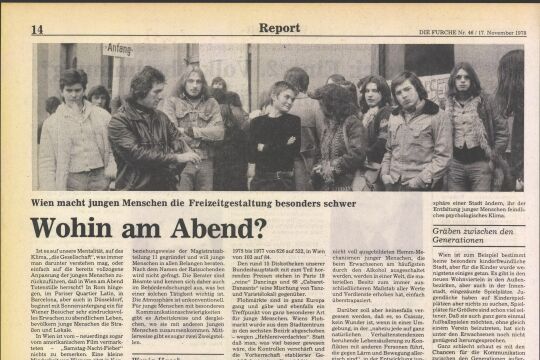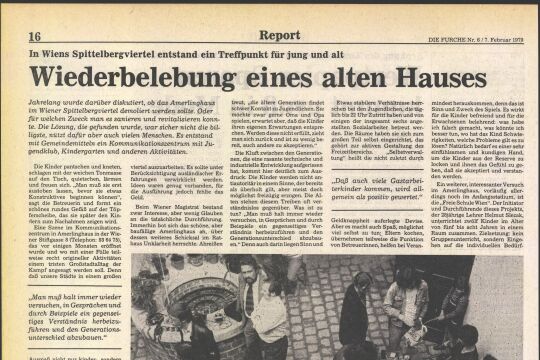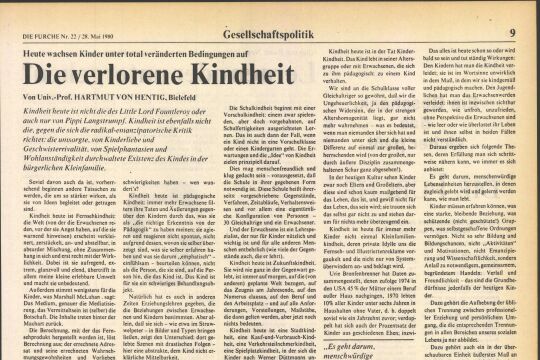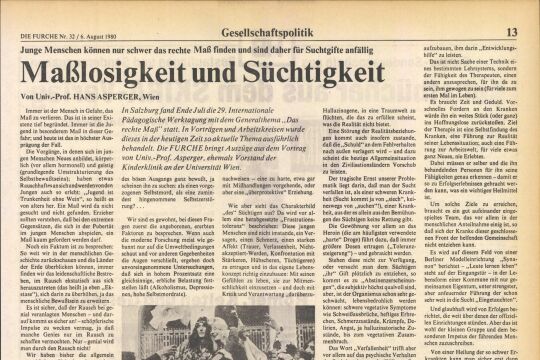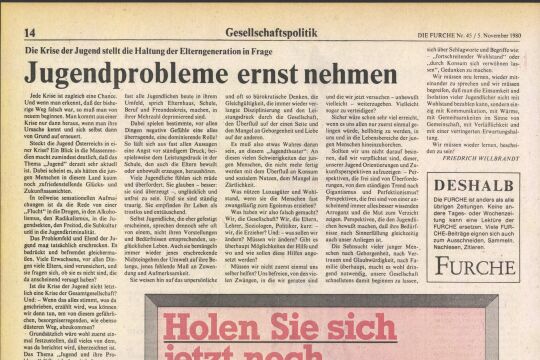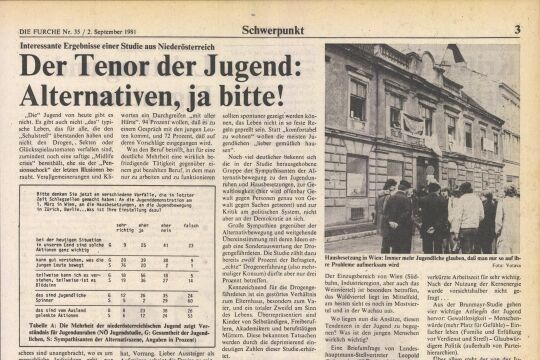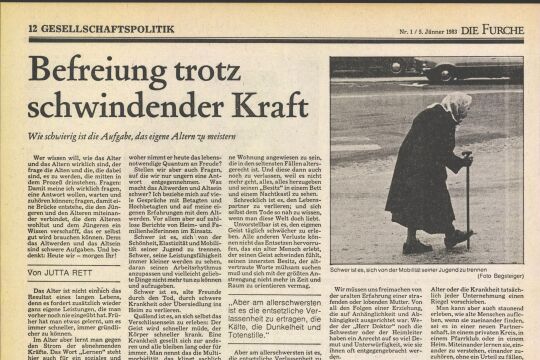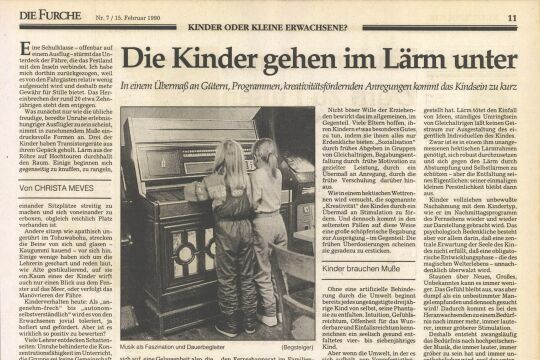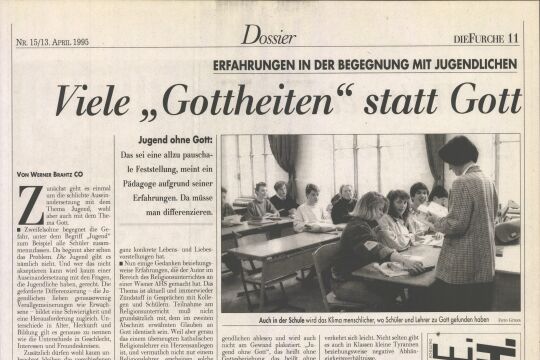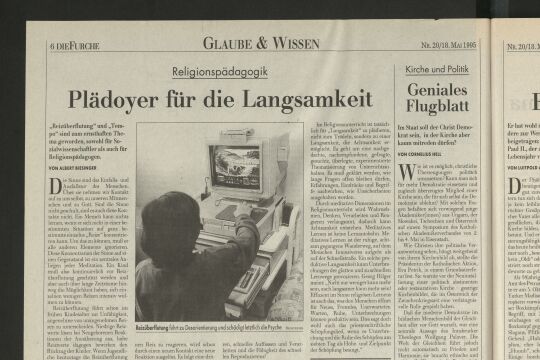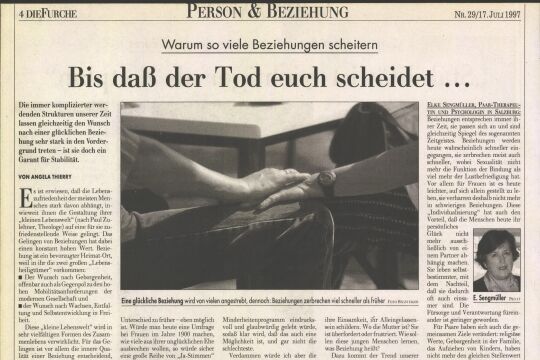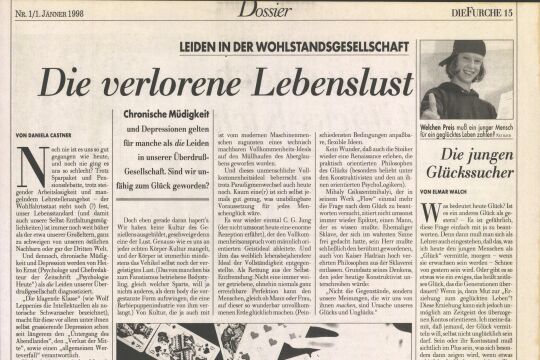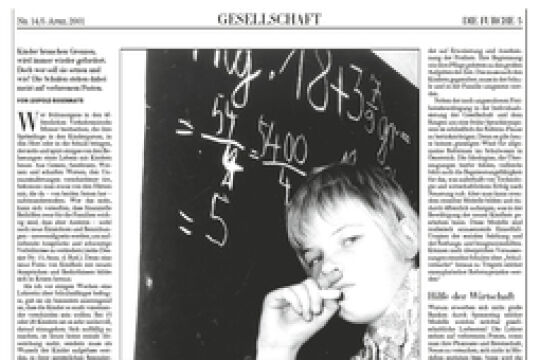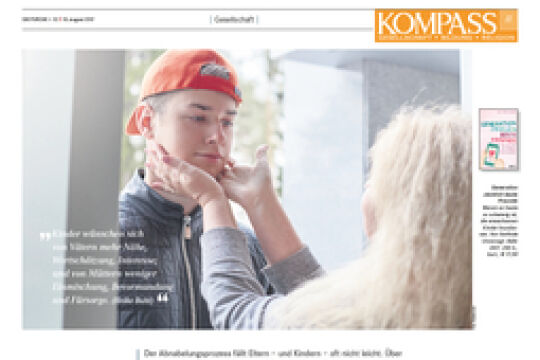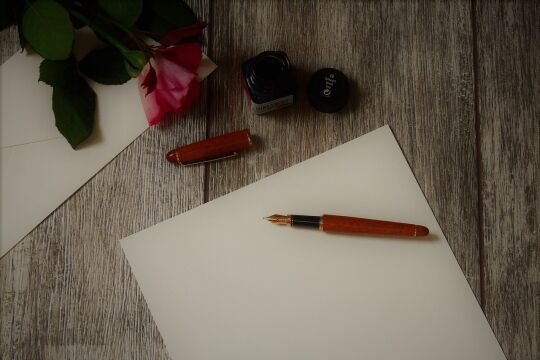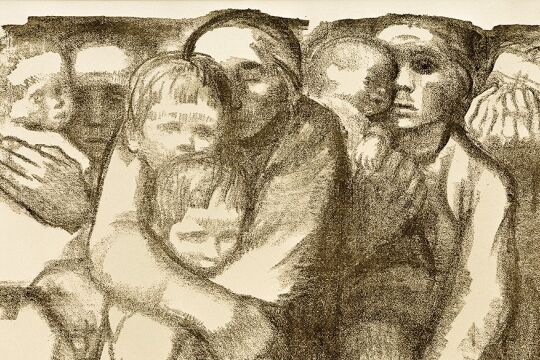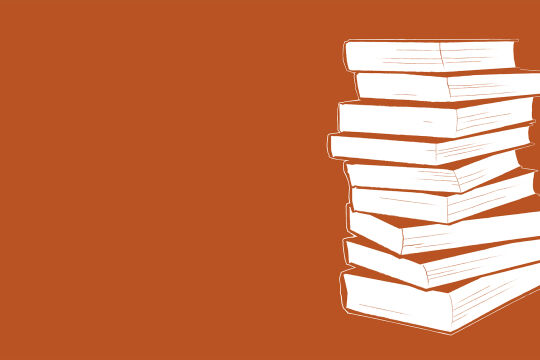Glück: Von Kindern lernen
Kinder sind heute - trotz hoher Scheidungsraten - zumeist zufrieden mit ihrem Leben. Vom Glück der Kinder könnten auch Erwachsene so einiges lernen.
Kinder sind heute - trotz hoher Scheidungsraten - zumeist zufrieden mit ihrem Leben. Vom Glück der Kinder könnten auch Erwachsene so einiges lernen.
"Bisher bin ich immer glücklich gewesen", sagte in einem Forschungsprojekt über Kindheitsglück eine Zehnjährige. Ihre Aussage scheint dem, was massenmedial über heutige Kindheit verbreitet wird, diametral zu widersprechen. Kinder seien gestresst, sie müssten, Termine im Handy, von einer Kindheitsinsel auf die andere eilen: Wohnung - Ballett in der City - Reiterhof am Stadtrand; sie seien zerteilt in Rosenkriegen (jedes zweite Kind sei Scheidungswaise, faktisch aber wachsen nach wie vor 80 Prozent der Kinder bei beiden leiblichen Eltern auf); sie würden immer früher mit Sedativa ruhiggestellt, damit die Angst vor den Schularbeiten erträglich sei, und aus den Bildschirmen stürze eine verwirrende Bilderflut auf sie ein - kurz: Früher sei Kindheit gemächlicher, behüteter und vor allem glücklicher gewesen (was früher auch schon behauptet wurde, so um 1870 vom Pädagogen Friedrich Paulsen).
Wie glücklich Kinder wirklich sind, wollte das ZDF anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Tabaluga tivi wissen. Nach Vorlage der Salzburger Studie zu Kindheitsglück, die der Autor Ende der neunziger Jahre durchgeführt hat, wurden, zwischen Zugspitze und Ostsee, 1239 Kinder, zwischen sechs und 13 Jahre alt, von geschulten Psychologen umfassend befragt: Wie glücklich ihr bisheriges Leben war, was sie in ihrer Freizeit tun, wie sie die Schule erleben und so fort. Zentrales Ergebnis: 40 Prozent bilanzierten ihr bisheriges Leben als sehr glücklich, 45 Prozent als glücklich, und 15 Prozent zeigten auf ein Gesicht mit einem waagrechten Mund.
Aus der Vielfalt der Ergebnisse werden einige herausgegriffen, die für Erwachsene von Bedeutung sein könnten, um ihre Lebenszufriedenheit zu steigern.
In Bewegung sein: Heutigen Kindern wird vielfach nachgesagt, träge vor dem Fernseher herumzuliegen oder vor den Flachbildschirmen zu sitzen, in Computerspiele hineingesogen, die umso faszinierender seien, je mehr Blut spritzt. Doch unsere empirischen Daten zeigen klar: Die meisten Kinder sind auch heute regelmäßig in Bewegung. Sie radeln, skaten, klettern auf Bäume, balancieren über Eisenstangen, sind in einem Sportverein (62 Prozent). Wenig ist für sie unerträglicher, als lange still sitzen zu müssen. Bewegung setzt körpereigene Glücksbotenstoffe frei. Wenn sich Erwachsene für die dreihundert Meter bis zur Trafik in den Wagen setzen, ist dies nicht der Fall; anders hingegen, wenn die Jogging-Schuhe angeschnallt werden, um für den Halbmarathon zu trainieren. Eine jüngere psychiatrische Studie zeigte: Bei Personen, klinisch an Depression erkrankt, zeitigten 30 Minuten Radfahren pro Tag den gleichen Effekt wie Neuroleptika.
Flow suchen & Gefühle zeigen
Flow-Situationen aufsuchen: "Flow" ist das populärste Konzept der Glücksforschung; er besteht in einem Zustand des Fließens und Schwebens, wenn der Mensch mit seiner Tätigkeit regelrecht verschmilzt. Das erleben viele Kinder nach wie vor, speziell im Spiel oder dann, wenn sie, an einem Gerüst herumkletternd, die Grenzen ihrer Kräfte und ihrer Geschicklichkeit austesten. Die ZDF-Studie zeigte: Je häufiger Kinder erleben, dass sie im Zuge ihrer Tätigkeiten die Zeit vergessen, desto glücklicher sind sie. Der Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi schrieb, Kinder suchten mit der Unvermeidlichkeit eines Naturgesetzes Flow-Situationen auf. Dieser wird begünstigt, wenn die situative Herausforderung und unsere Handlungsressourcen im Gleichgewicht sind. Ist erstere zu hoch, erleben wir Angst (ein ungeübter Alpinist vor der Eigernordwand), ist sie zu niedrig, gähnt Langeweile (Reinhold Messner vor dem Salzburger Gaisberg). Von Kindern ist zu lernen, sich immer wieder in Flow-Situationen hineinzubegeben, sich neuen Herausforderungen zu stellen, neugierig zu sein und sich Zeit für solche Tätigkeiten nehmen, in denen die Zeit vergessen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!