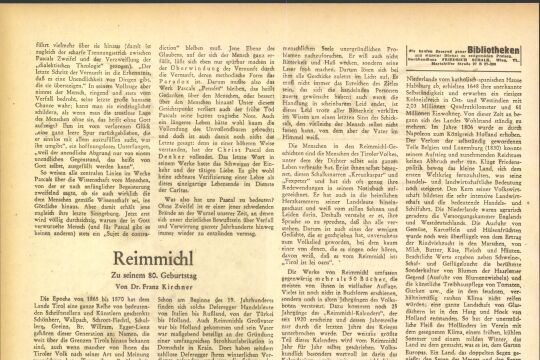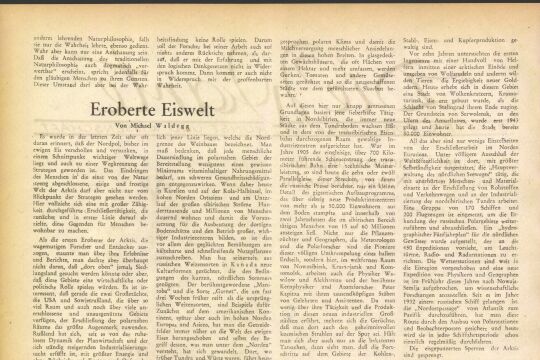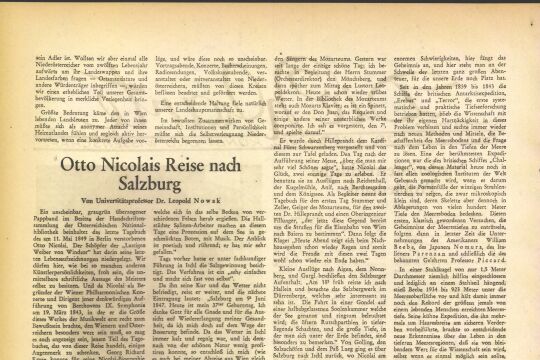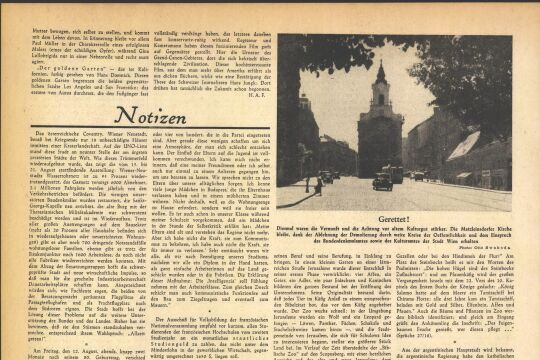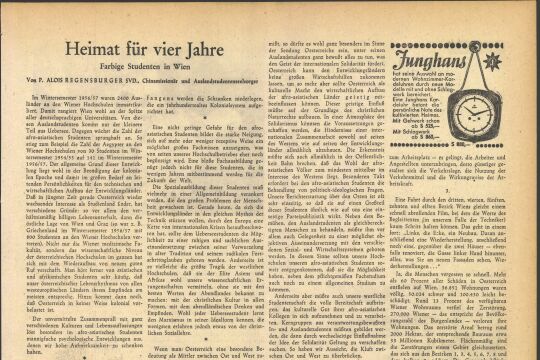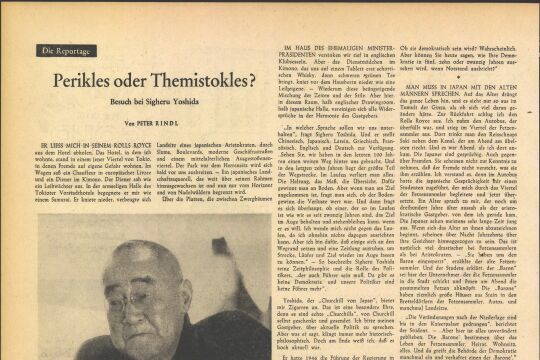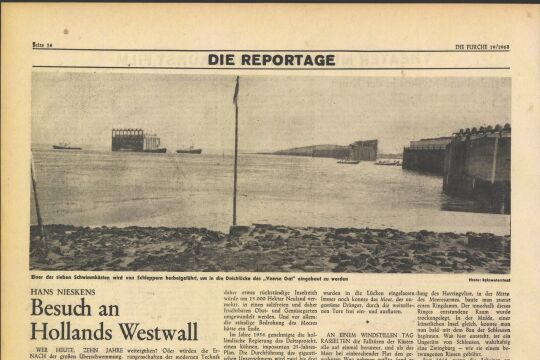"Die meisten Evakuierten bauten sich an anderen Orten ein neues Leben auf. Die Regierung hat die Sorgen und Wünsche vieler Betroffener aber nicht berücksichtigt."
Am Ufer des Flusses Kitakami und gut 3 km vom Pazifik entfernt stand die Okawa Volksschule. Das halbrunde Betongebäude, seiner Fenster beraubt und mit eingestürzten Verbindungsgängen, steht als Mahnmal in der Einöde zwischen dem Flussdamm und dem Berghang. Am Zaun erinnern handgeschriebene Tafeln und Fotos an den einstigen Schulalltag, darunter liegen Plüschtiere und Blumen. Die Gesichter der Kinder wurden unkenntlich gemacht, ausgelöscht. An einer Mauer sind die bunten Zeichnungen der Kinder zu sehen.
Als sich das Erbeben ereignete, wurden die 78 Schüler zunächst auf den Sportplatz evakuiert. Das Amt für Meteorologie erließ bald darauf eine Tsunami-Warnung mit einer möglichen Höhe von bis zu 10 Metern. Die Lehrer konsultierten das Notfallhandbuch. Dieses wird an die örtlichen Gegebenheiten der Schule angepasst. Kamaya galt nicht als Tsunami-Gefahrengebiet.
Der Flutwelle entgegen
Die Lehrer entnahmen dem Manual nur, dass die Kinder im Falle eines Erdbebens "in ein freies Gelände in der Nähe der Schule" evakuiert werden sollten. Dabei stand das Gebäude direkt neben einem gut 200 m hohem Hügel, auf das die Kinder mühelos hinaufklettern hätten können.
Die Lehrer entschieden, dem Manual folgend, die Kinder auf die Straße in Richtung einer Verkehrsinsel zu führen, genau der Tsunamiwelle entgegen. Als das Wasser über sie kam, starben 74 Schüler und 10 Erwachsene. Nur vier Kinder und ein Lehrer überlebten.
Seitdem prozessieren Eltern von 23 Kindern gegen die Präfektur Miyagi und die Stadt Ishinomaki, Sitz der Schulbehörde. Obwohl sie in erster Instanz gewonnen haben, fordern sie weiterhin, dass Schuldige für den Tod ihrer Kinder benannt und zur Verantwortung gezogen werden. Der Lehrer, der als einziger Klarheit in die Geschichte bringen könnte, leidet an der posttraumatischen Belastungsstörung und hat seit der Tragödie kein Wort mehr gesprochen.
Die Schule von Kamaya ist trotzdem eine besonders tragische Ausnahme. Der überwiegende Teil der Tsunami-Opfer war über 60 Jahre alt. Der Grund ist die Altersstruktur des Katastrophengebietes. Die am stärksten betroffene Sanriku-Küste im Nordosten Japans hat einen spröden Charme, sie erinnert an die Bretagne. Vor dem Tsunami war diese Landschaft für Japan exzeptionell. Kam man von der Hauptstraße, die an den Klippen vorbeizog, zur Küste herab, gelangte man in kleine Fischerdörfer, die so abgelegen und vereinsamt schienen, als wären sie am sprichwörtlichen Ende der Welt.
Alte Männer mit ihren Mini-Trucks, beladen mit Fischernetzen, Bojen, oder dem Fang des Tages, waren der einzige Gegenverkehr. Die Küste war beeindruckend, die kleinen Städtchen hingegen heruntergekommen, fast ausgestorben, von der Welt vergessen. Zwar versuchte man da und dort mit einem lokalen Aquarium oder einem Walfangmuseum Tagesausflügler zu locken, doch diese "Attraktionen" blieben zumeist menschenleer.
Baufieber und Neuanfang
Die Stadt Minamisanriku zählte bis zum Erdbeben ca. 15.000 Einwohner. Als die Welle den Ort fast vollständig auslöschte, starben 1200 Menschen. Danach wurden hinter dem neuen Schutzwall pyramidenartige Strukturen aus Sand errichtet, das ganze Stadtgebiet um 12 bis 18 m angehoben.
Unermüdlich fahren Planierraupen und Bagger die künstlichen Hügel auf und ab, Lkws bringen Steine und Sand aus höher gelegenen Orten. Hier oben soll die neue Stadt entstehen. Die ersten permanenten Bauten haben auf dem erhöhten Grund mit großem Pump 2017 eröffnet: ein Einkaufszentrum mit rund 30 Geschäften soll die Wiedergeburt symbolisieren.
Aufgrund der Priorisierung der Sportanlagen -und Infrastrukturprojekte für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 kam es zudem im Katastrophengebiet zu großen Verzögerungen. Viele Bauunternehmer und Arbeiter sind dem lukrativen Lockruf aus Tokio erlegen und ließen die Bauplätze an der Sanriku-Küste verwaisen. Hinzu kommt, dass das olympische Baufieber die Preise für Baustoffe innerhalb von nur wenigen Jahren bis auf das Fünffache in die Höhe schnellen ließ, ein Umstand, der Betroffene von einer Rückkehr abhält.
Die japanische Gesellschaft altert so schnell wie keine andere. Tohoku, wie dieser Teil Nordjapans genannt wird, leidet nicht erst seit dem Erdbeben an einem besonders raschen Bevölkerungsschwund. Die Katastrophe hatte diesen Prozess nur beschleunigt. Die Bevölkerung von 31 betroffenen Gemeinden in den Präfekturen Iwate, Miyagi und Fukushima fiel seit 2011 um 5,5 %. Wie andernorts auch, haben die meisten Landbesitzer in Minamisanriku keine Pläne, in der Stadt neue Häuser zu bauen.
Die lange erwartete Infrastruktur ist beinahe fertig -für 2018 ist der Abschluss der Arbeiten geplant -es könnte sich aber herausstellen, dass diese Orte dennoch nicht wieder mit Leben gefüllt werden können. Arbeitsplätze gibt es zur Genüge. Doch auch das kann sich bald ändern. Die Regierung hat begonnen, das Sonderbudget für den Wiederaufbau wieder zurückzufahren. Umgerechnet 195 Milliarden Euro, davon 75 Milliarden nur für Baumaßnahmen, flossen in die Katastrophengebiete bis 2015. Bis 2020 sollen es weitere 50 Milliarden werden, weniger als die Hälfte davon für den Wiederaufbau.
Sieben Jahre nach der Dreifachkatastrophe fällt die Bilanz des Wiederaufbaus gemischt aus. Abgesehen vom radioaktiv kontaminierten Sperrgebiet rund um den Unglücksreaktor in der Präfektur Fukushima konnten entlang der nordöstlichen Küste Japans die betroffenen Fischer den Fischfang wieder aufnehmen.
Die meisten Evakuierten bauten sich an anderen Orten ein neues Leben auf. Während der materielle Wiederaufbau mit einem unermesslichen finanziellen und personellen Einsatz weit fortgeschritten ist, wurden die Sorgen und Wünsche vieler Betroffener nicht berücksichtigt. Stattdessen haben die Technokraten des "Eisernen Dreiecks", bestehend aus Politikern, Ministerialbürokraten und Bauunternehmern, ihren lang erprobten Weg fortgesetzt. Ein Symbol dafür ist eine gigantische Betonmauer, die die gesamte Landschaft dominiert. Nicht selten gegen den Willen der lokalen Bevölkerung hatte die Regierung in Tokio bereits kurz nach der Katastrophe beschlossen, auf 400 km Länge Hunderte 15 Meter hohe und 9 Meter breite Schutzwälle aus Beton zu errichten, die die nordöstliche Küste vor Tsunamis schützen sollen.
Von Kritikern bereits als die "Große Japanische Mauer" verhöhnt, wird sie die Landschaften und Ökosysteme auf Jahrhunderte hinaus verändern. Das Land dahinter darf ohnehin nur noch landwirtschaftlich genutzt werden. Aber ob sie jemals ihren Zweck erfüllen wird müssen, ist äußerst fraglich, denn ein Naturereignis dieses Ausmaßes ist statistisch nur ein bis zwei Mal im Jahrtausend zu erwarten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!