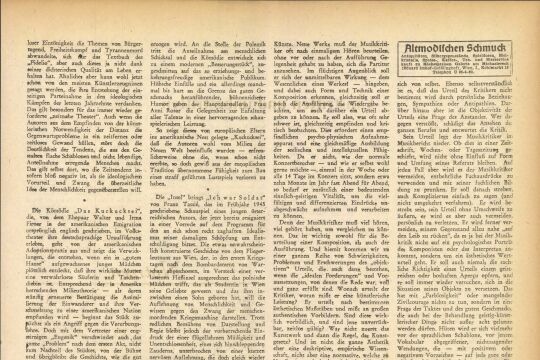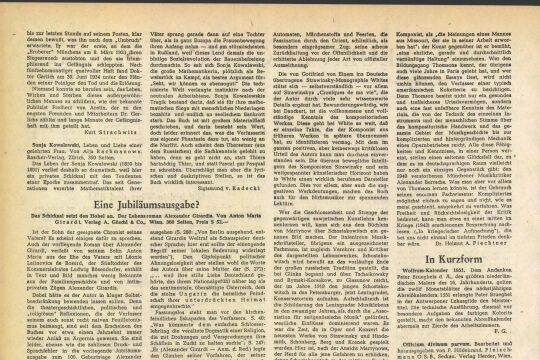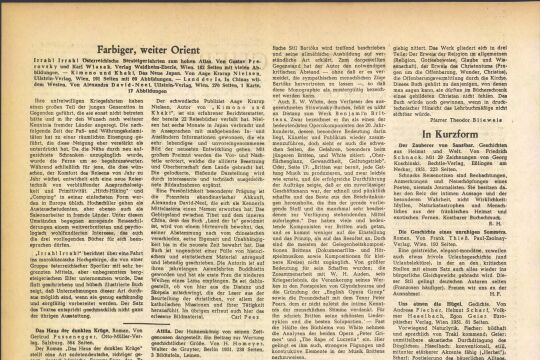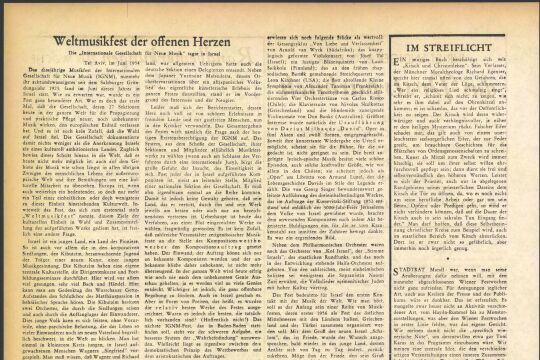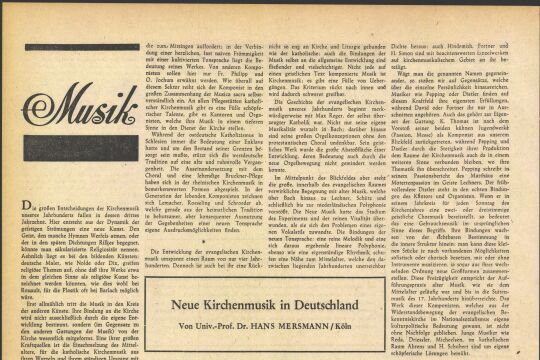Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musik im Fernsehen
Fernseher, die sich von der neunten Kunst vornehmlich musikalische Genüsse erwarten, stellen sicher eine Minorität dar. Dank der Verbreitung dieses Massenmediums ist indessen auch diese Minorität, die sich im ständigen Kampf gegen die Majoritäten der Sportwelt, der Löwinger-Freunde und der Quizliebhaber befindet, ein Faktor, dessen zahlenmäßige Bedeutung die der regelmäßigen Konzertbesucher bei weitem übertrifft. Trotzdem hat diese Bedeutung noch zu keiner Lösung der Probleme geführt, die sich aus dem Kontakt von Musik und Fernsehschirm ergeben. Relativ selten sind noch die Kunstwerke, die versuchen, schon bei der Genese die beiden Komponenten zu verbinden: in der Regel existiert zuerst die Musik, die dann durch das Bild kommentiert wird — eine Ausgangssituation, die von vornherein eine echte Symbiose unmöglich macht. Der Großteil der Musikproduktionen, die beim 20. Premio Italia — der internationalen Konkurrenz der Radio- und Fernsehstationen, die heuer in Rom stattfand — präsentiert wurden, trugen diesen Makel der Geburt an sich. Die wenigen Ausnahmen verdienen eine nähere Betrachtung.
Der erste Preis für Musikproduk- tiionen im Fernsehen ging an das Zweite Deutsche Fernsehen für „Dies irae” nach der Musik von Krzysztof Penderecki. Er hatte bezeichnenderweise seine Musik nicht für dieses Medium komponiert: sie entstand als Oratorium zum Gedenken an die Opfer von Auschwitz und wurde für die Zwecke des Fernsehens lediglich um eine Einleitung zu den drei Teilen — Lamentatio, Apocalypsis, Apotheosis — bereichert. Als Text, der eher in seiner musikalischen Qualität als über das Vehikel des Verstandes zum Bewußtsein gelangt, wählte der Komponist Stellen aus polnischen zeitgenössischen Dichtungen sowie von Valery und Aragon, aus den „Eume- niden” des Äschylos und aus der Apokalypse. Der Bildeindruck, der vom Regisseur Helmut Rost und dessen Choreographen Jean Deroc bestimmt wird, ist stark: gesichtlose, aus dem Grabe gestiegene Gestalten vollziehen vor dem Altar einer ausgestreckten Hand und eines Schädels die kultische Handlung der Anklage, der Verzweiflung und des nutzlosen Aufstandes gegen die Gewalt. Diese emotionell leicht zu erfassenden Inhalte gehen durchaus konform mit der Ausdruckskraft von Pendereckis Musik: was beiden Faktoren fehlt, ist der Aufbau, die Kraft, den Inhalt zu einer Peripetie, zur Geschlossenheit zu bringen. Die Idee, Wochenschauaufnahmen aus den Vernichtungslagern einzublenden, wirkt als Schock ohne künstlerische Zielrichtung: die Unvereinbarkeit der krassen Realität mit der höheren Realität der Kunst wird an dieser Konfrontation überdeutlich. Zumal wenn der durchaus befriedigende Gesundheitszustand der Tänzer, die sich da mit den Opfern der Bestialität identifizieren, ins Auge springt. Immerhin sind sowohl in der Musik Pendereckis wie in der Anlage der künstlerischen Aussage echte Werte enthalten. Vielleicht werden sie eines Tages zum Durchbruch kommen, wenn die weltweite Verachtung der Elemente Form und Aufbau überwunden sein wird.
Wir lernen ja nie aus. Auch Pierre Boulez hat zugelernt. In einem Bildungsfilm der BBC, der leider ohne Auszeichnung blieb, erklärt er eine Stunde lang — neben Werken von Berg und Webern — auch die Bedeutung Arnold Schönbergs, den er vor nicht allzu langer Zeit — 1952 — für tot erklärt hatte. Die Lebendigkeit, mit der er die Meister der Wiener Schule analysiert — wobei er auf das trefflichste von der optischen Komponente unterstützt wird —, läßt hoffen, daß Boulez auch andere, die er zum Tode verurteilt hat, auferstehen läßt.
Der im Sinne der oben geforderten idealen Symbiose gelungenste Beitrag zur Konkurrenz kam aus Schweden. „Der Turm zu Babel” ist der Versuch, eine abstrakte Idee allein aus den Möglichkeiten des menschlichen Körpers zu konkretisieren. Der Titel ist symbolisch zu verstehen: er nimmt auf jenen geistigen Turmbau bezug, den der Künstler aus den Bausteinen seines Materials errichtet, wobei ja auch dieses Material Eigengesetz und Eigenleben besitzt, somit ebenfalls durch Menschen dargestellt wird. Die Choreographin Birgit Cullberg und der Regisseur Arne Arnbom haben diese Idee ohne Seitenblicke auf materialfremde Möglichkeiten ins Bild umgesetzt. Leider ist die Musik von Hilding Rosenberg nicht so stark, um aus sich heraus zu diesem Turmbau Wesentliches beizutragen.
Die ganze Problematik des Nachschaffens auf der Grundlage prä- formierter Kunstwerke zeigte sich in der Gestaltung von Strawinskys „Sacre du printemps” durch Flemming Flindt. Ein hervorragender Tänzer war hier als Choreograph dieser dänischen Produktion am Werk, ein Künstler, der auf dem Gebiet des reinen Tanzes Bedeutendes zu leisten imstande ist, wenngleich er alles im Bannkreis der klassischen Schule konzipiert. So ist seine tänzerische Auffassung, anders als die von Maurice Bejart, auf der Grundschule des klassischen Tanzvokabulars aufgebaut, was mit der Musik des „Sacre” schwer zu vereinbaren ist, während die Abstraktion von Kostüm und Folklore ä la Polowetzer Tänze heute durchaus schon akzeptabel wirkt. Zudem hat er ein Ballett filmen lassen: das Fernsehen ist auf die Rolle des Übermittlers beschränkt. Sonderbarerweise liegt ihm diese Rolle durchaus nicht. Die Television will sich nicht damit begnügen, zu übertragen: sie will mitwirken. Es wäre hoch an der Zeit, diesen Willen zu respektieren — nicht, indem man dem Bildgestalter die Aufgabe stellt, eine Musik zu kommentieren, sondern, indem man an der Basis ansetzt: dort, wo das Kunstwerk entsteht. Komponist und Bildgestalter müssen Zusammenarbeiten wie Komponist und Librettist, in Erwartung, daß die neuen Möglichkeiten einer Kunstgattung, die sich noch in ihren Anfängen befindet, auch jene All- round-Künstler hervorbringt, die alles in Personalunion zu vereinigen verstehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!