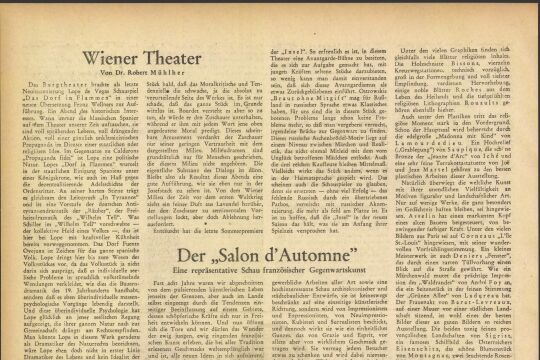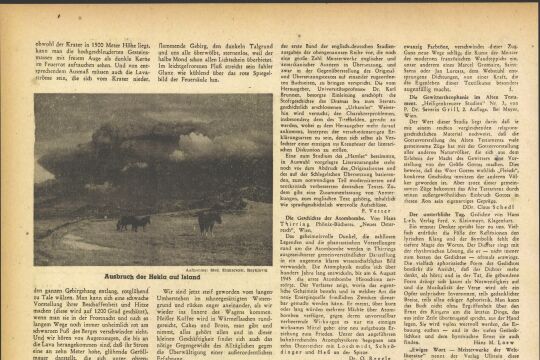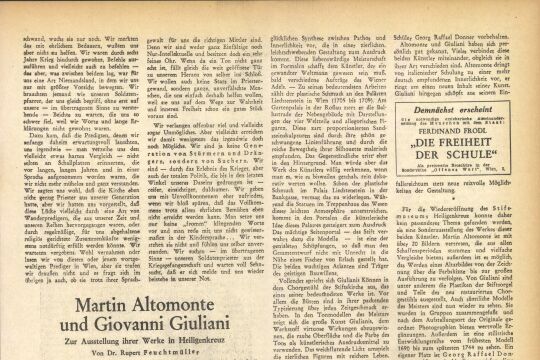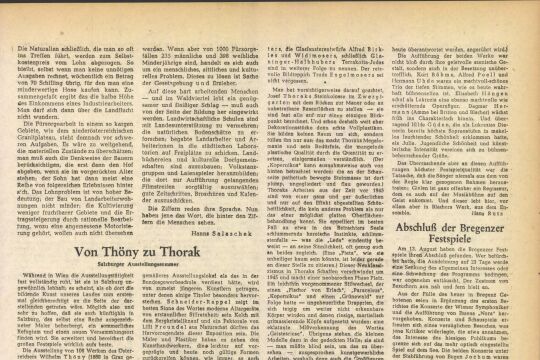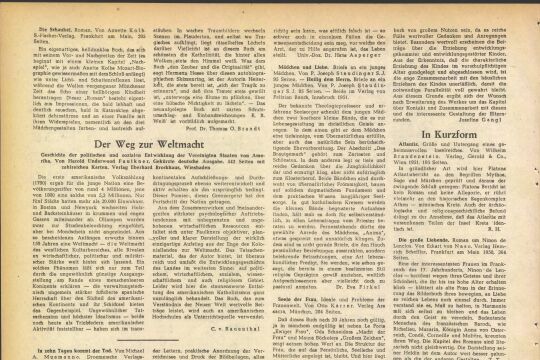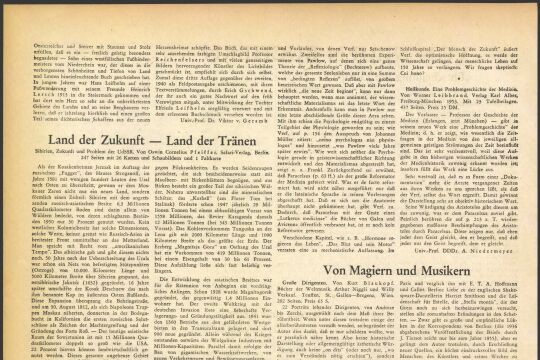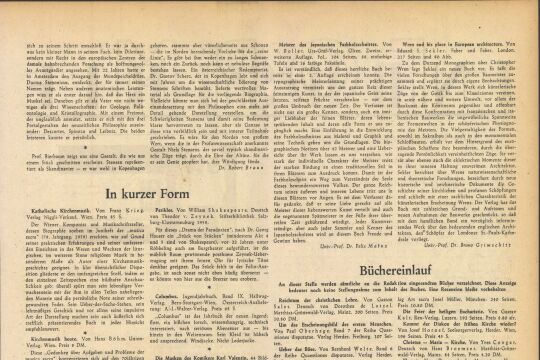Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Perlmutterkunst
Eine sehr empfehlenswerte, kleine und hübsch gestaltete Ausstellung, die einer halbvergessenen Kleinkunst gewidmet ist. ist derzeit im Ausstellungsraum des Niederösterreichischen Landesmuseums zu sehen. Sie zeigt in eindringlicher Form, welche Rolle als Zier-und Schmuckelement das Perlmutter vom Paläolithikum bis in das vergangene Jahrhundert spielte, nicht zuletzt durch seine uralte magische und symbolische Bedeutung. Daß die Niederösterreichischa Landesregierung und die Niederösterreichische Handelskammer das Aussterbes des einst blühenden Handwerks mit diesem faszinierenden Material wirksam zu verhindern trachten, muß besonders begrüßt werden. Daß ihr Bestreben nicht umsonst ist, zeigen formschöne, moderne Schmuck-und Gebrauchsgegenstände. Der äußerst wertvollen Ausstellung ist zu wünschen, daß sie das Verständnis und die Liebe für diese Kleinkunst, das Handwerk und den. Werkstoff neu belebt.
Das Erfreuliche an den Zeichnungen und Aquarellen von Fritz M a r t i n z in der Ausstellung im Keller der Secession ist die unermüdliche Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper, die in ihr zu finden ist. Woran es Martinz aber meist noch mangelt, ist die konsequent plastische Darstellung seiner Formen und Kompositionen im Sinne einer inneren Geometrie. Die manieristische Überbetonung des Fleischlichen, die meist nicht den Funktionen gehorcht, verlangt nach größerer Disziplin und Präzision, das Gefühlsmäßige nach größerer Konzentration und Differenzierung. Martinz müßte mehr Paraphrasen nach klassischer Kunst wie die über Poussin zeichnen und damit die Ansätze vertiefen, die stellenweise in Blättern, wie „Frauenraub 1/63“, „Menschen in der Landschaft I/II 63“ und „Badende Menschen 62“, in letzter Zeit auftauchten. Nur so wäre die Gefahr der naturalistischen Vulgärität, die bei den Naturstudien so peinlich ist, zu überwinden und ein wesentlich strengeres Verhältnis zur Form, die bei ihm allzuoft teigig zerrinnt, zu gewinnen.
Die besten Arbeiten von Eduard D i e m, einem Autodidakten, sind seine Holzschnitte. Die Zeichnungen leiden wie die Ölbilder unter Formlosigkeit, die sich bei letzteren hinter stilisierter „Sachlichkeit“ zu verstecken sucht. Diem scheint vor allem eine dekorative Begabung zu sein, erst ein eindringlicheres Naturstudium und ein Abbau der Buntheit könnte interessantere Leistungen hervorbringen Claus1 P a c k
Can-Can und Knöpfe
Pas Paris des vorigen Jahrhunderts in typisch amerikanischer Hollywood-Aus-gabe.stellt uns der farbige „Todd-AO“-Film, ,Jan-C-an“ vor und entfaltet einen, wahren Rausch an Farben und Ausstattung. Es ist jenes Paris der leichten Unterhaltung in den unzähligen Amüsierstätten, in denen sich der anfangs noch verbotene und von der Polizei verfolgte frivole „Can-Can“-Tanz langsam durchsetzt. Wenn man auch nicht sages kann, daß diese freche und nicht sehr ästhetische Tanzform eine kulturhistorische Errungenschaft war, so galt der Can-Cah doch eine Zeitlang als der Inbegriff pariserischer Lebensfreude. Der Film bemüht sich weitgehend, Peinlichkeiten zu vermeiden, und stellt eine schwungvoll inszenierte Komödienhandlung in des Mittelpunkt, in der vor allem Shirley McLaine in all ihrer Vielseitigkeit brillieren kann.
Das französische Dorfmilieu und das Leben der Kinder, ihren Alltag und ihren Zeitvertreib zeichnet der Film „Krieg der Knöpfe“ und wendet sich dabei nicht an ein jugendliches, sondern an das erwachsene Publikum. Nicht ungeschickt, manchmal sogar mit einem Hauch von Poesie und Kinderromantik zeigt er auf, daß die Kinder im Grunde nichts als das getreue Spiegelbild ihrer Eltern sind und deren Vorbild besonders im Negativen getreulich nacheifern, obwohl sich die Alten darüber empören. Leider ist die Sicht des Films doch zu einseitig. Mit Ausnahme des einsichtsvollen Lehrers sind alle • Eltern nur polternde und primitive Lümmel, die den Streichen ihrer Kinder keinerlei Verständnis entgegenbringen.
Der prächtige Fernandel kommt diesmal viel leiser und viel menschlicher in dem Kriminalfilm von Leo Joannon, „D e r Mörder steht im Telephon-b u c h“, zur Wirkung. Joannon schuf seinerzeit den unvergeßlichen Priesterfilm „Der Abtrünnige“ und bemüht sich auch in dieser amüsanten Kriminalkomödie um menschliche Töne. Fernandel ist ein etwas unbeholfener Bankangestellter, dessen vorbehaltloser Glaube an das Gute im Menschen von sinem raffinierten Gauner systematisch ausgenutzt wird. Es ist also keine vordergründige, reißerische Kriminalunterhaltung, sondern ein heiter-besinnliches Spiel, trotz aller Spannung und der erheblichen Anzahl von Toten. Aber die gehören nun einmal als dramaturgische Notwendigkeit zu der lebensgefährlichen Geschichte, in die der biedere Angestellte verwickelt wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!