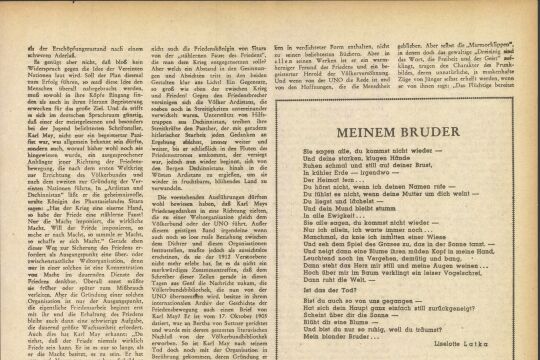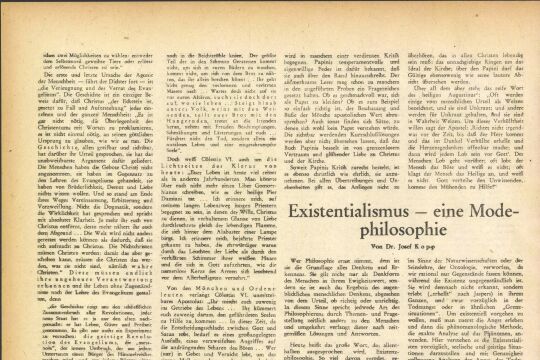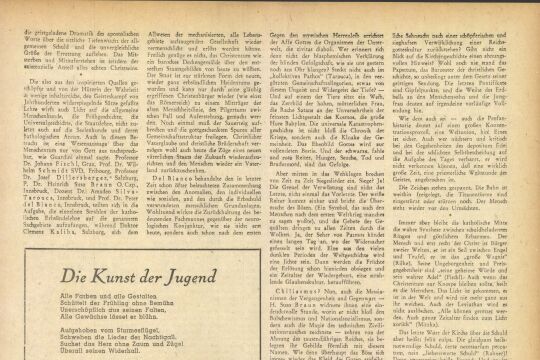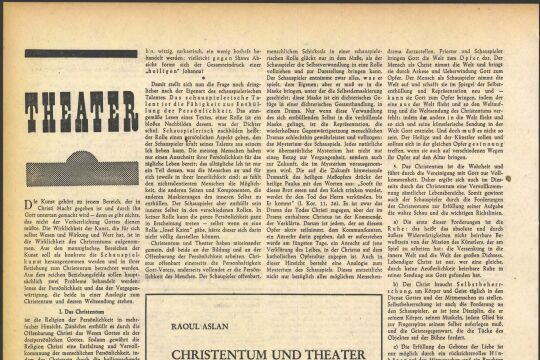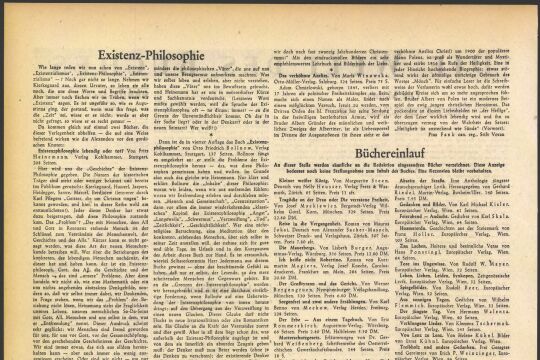Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erich Przywara SJ. — Zum 75. Geburtstag am 12. Oktober 1964
Die äußere Lebenskurve mit dem meteorischen Aufleuchten nach 1920 und dem Absinken in die Einsamkeit des Krank- und Verlassenseins verrät nichts von den wahren Ausmaßen der Sendung. Und das literarische Lebenswerk türmt sich zu solchen Höhen und umarmt solche Horizonte, daß sein Übermaß den pressierten Leser von heute entmutigt: der Auftrag wie seine Ausführung scheinen beide zu groß für diese Zeit. So haben sich die Christen dispensiert gefühlt, sich das Geschenk anzueignen und es den anderen zu erschließen. Heilige, die man in ihrer Weltstunde verkennt, lassen sich nachträglich kanonisieren, Denker leider nicht. Dabei ist Przywaras Gesamtwerk licht und bis ins kleinste geformt; es ist prall und dicht, wundersam fruchtbar und ergiebig. Es gibt wie kein zweites zeitgenössisches das Bwußtsein unabsehbarer Freiheit und Weite, das stolze Gefühl der gottabbildlichen Vollkraft des Geistes inmitten der Demut seiner Hingegebenheit ins letzte Mysterium.
Die heutige Kirche ist wie der Mensch dieser Zeit intensiv mit sich selber und mit der Gestaltung ihres Erdenauftrages beschäftigt. Gott ist ihr fast nur noch selbstverständliche Voraussetzung, die aber von den andern nicht anerkannt wird, so daß die Folgerungen sie schwerlich berühren. Przywara lebt immerfort auf dem nackten Berührungspunkt des Menschen mit Gott und entfernt sich keinen Finger breit davon, im unbeschreiblichen Aug in Auge zum je größeren, je unähnlicheren, je majestätischeren Gott, der sich um so mehr über der Kreatur erhebt, je inniger er sie durchdringt und je liebender er sich zu ihr hin ver- nichtigt. An diesem Punkt entspringt gleicherweise das philosophisch-theologische wie das spirituell-hymnische Werk Przywaras. Aber der Denker erhebt immerfort warnend die Hand: „Seinsanalogie“ heißt Gottes je größere Unähnlichkeit, verbietet deshalb jede denkende Bewältigung Gottes, jedes Beziehen quasi-absoluter Positionen, fordert reine Schwebe aller endlichen Seins- und Geiststrukturen vor dem Geheimnisabgrund, bis zur Grenze des Ineinanderschlagens und -wogens aller Weltspannungen und Gegensätze. Der Beter und Sänger gewinnt durch diese Auskehr den Raum frei für den Niederfall vor der grundlos-närrisch ins Nichts der Welt und der Sünde sich ausleerenden Gottliebe.
Die Existenz in der Direktheit zu Gott legt schlechterdings alles apokalyptisch offen und frei: Die Offenbarung mit ihren Gewitterblitzen („Himmelreich“, „Christus lebt in mir“, „Crucis Mysterium“, „Christentum gemäß Johannes“, besonders „Alter und Neuer Bund“), das Gottbewußtsein überhaupt („Religionsbegründung“, „Gottgeheimnis der Welt“, „Gott“, „Ana- logia Entis I und 11“, „Summula“); die große Tradition, die zunächst die Gotterfahrung der Meister nachvollziehen läßt: Augustinus („Augustinus, Die Gestalt als Gefüge“), Dionysius, Thomas, Cusanus, der Ordensvater Ignatius („Majestas Divina“, „Deus semper maior“, ein dreibändiger theologischer Exer- zitienkommentar, „Ignatianisch“), Kierkegaard („Das Geheimnis Kierkegaards“), Newman („Christentum, ein Aufbau“, zahlreiche Aufsätze), Therese von Lisieux, Edith Stein, Simone Weil. Aber auch die große Philosophie legt sich offen aus, vom Orient und Heraklit über die griechischen Klassiker zur Moderne; mit ihrer Frage um Gottes Gegenwart im „Reich“ (daraus die Gespräche mit G. von le Fort, mit den Nationalsozialisten, mit Reinhold Schneider usf.), mit der Frage schließlich um die Breite des Menschlichen überhaupt („Humani- tas“, „Mensch I“) und seiner sozialen Gestaltungen („Logos“). So kommt es zu einer immerwährenden kritischen Auseinandersetzung („In und Gegen“) mit jeglichen Spielformen des Geistes, zumal mit dem, was Jahr für Jahr an neuen Entwürfen hervortritt: nichts ist Przywara zu gering; er liest es, wägt es, ordnet es unermüdlich, wie die stupende Gesamtbibliographie seiner Werke und Aufsätze zeigt („Erich Przywara, Sein Schrifttum 1912 bis 1962“).
Przywaras Fülle und Radikalität wirkt auf manche entmutigend. Aber große Ströme sind nicht zum Austrinken da, eher für den Menschen zum Anwohnen, zum Baden, zum Sich-tragen-Lassen ein Stück weit. Und wie Wasser überall Wasser ist, so ist Przywara immer er selbst: in jedem Teil seines Werkes lebt das Ganze, pulst der gleiche Rhythmus, auf den es ihm vor allem ankommt, erweist sich, was Analo- gia Entis, Leben vor Gott und in Gott im Vollzug ist. Fähren quer hinüber gibt es keine, noch Kurzmethoden in Taschenbuchformat, sowenig Theologie je eine Methode bieten kann, mit Gott fertig zu werden. Andere entmutigt Przywara, weil er angeblich zu viel weiß, für jedes eine Ordnungsnummer habe, mit allem, was ein anderer stammelnd zu denken versucht, immer schon fertig zu sein scheint. Was er weiß, ist aber: daß das Neue, wie immer es ausfallen wird, nicht Starrform, sondern Welle sein muß im unendlich sich ausgleichenden Meer der an Gott scheiternden Endlichkeit: dies unermüdlich gesagt und bewiesen zu bekommen, behagt keinem und ist doch das Hilfreichste.
Es ist nicht zu spät für Przywara und sein Werk. Wenn ein Teil dieses Werkes sich klar bewußt der Zeit verschrieben hat (ihr als Widerhaken eingebohrt, um zu ziehen, was sich ziehen läßt), so bleibt der größere zeitenthoben. Und dieser ist uns bitter nötig, brennendes Salz der schal gewordenen Christenheit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!