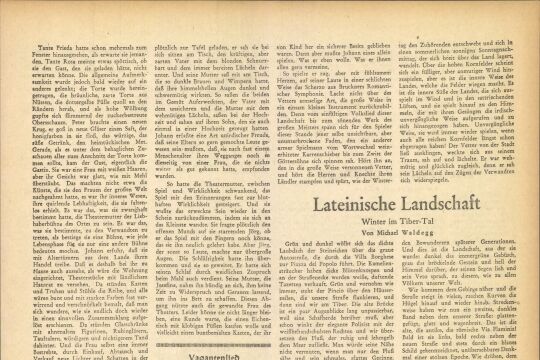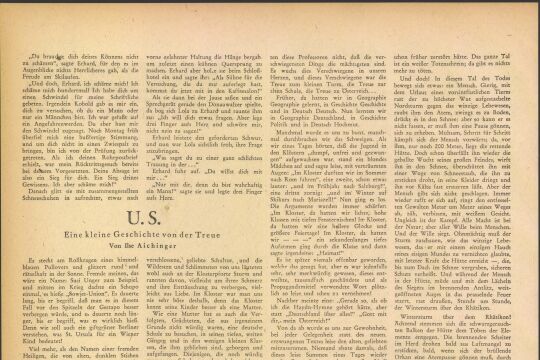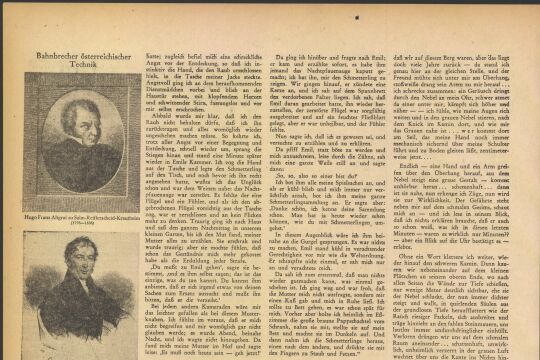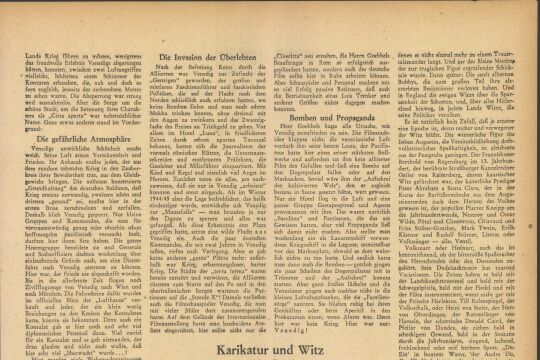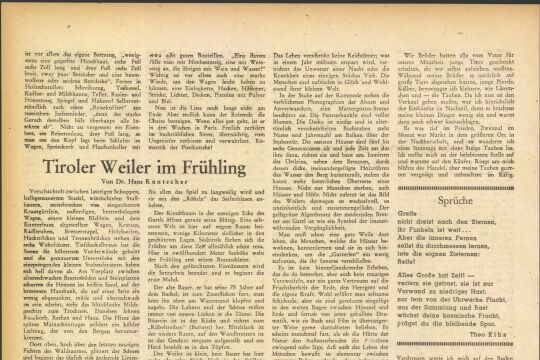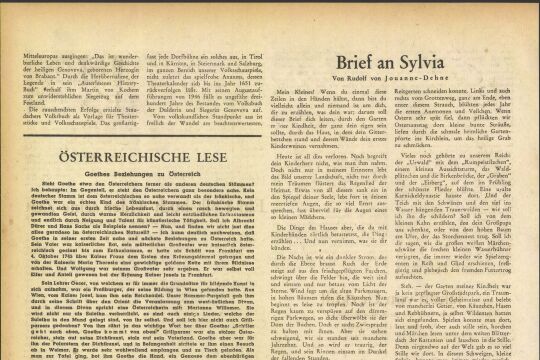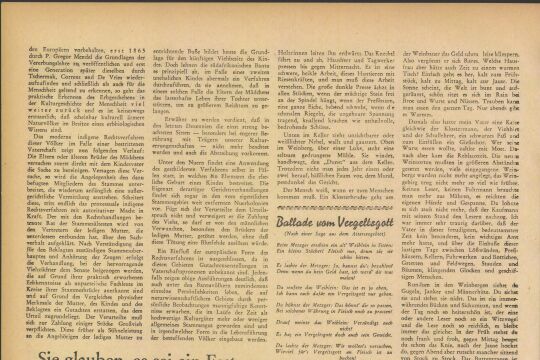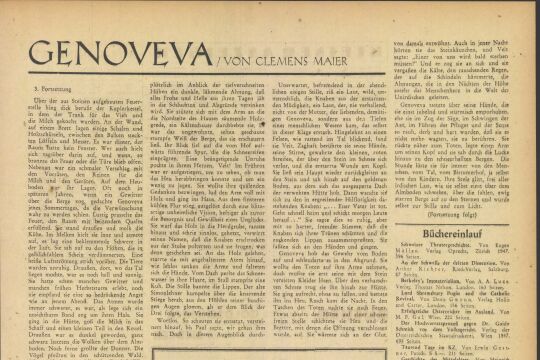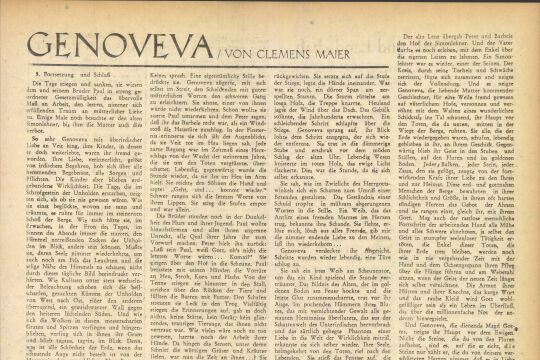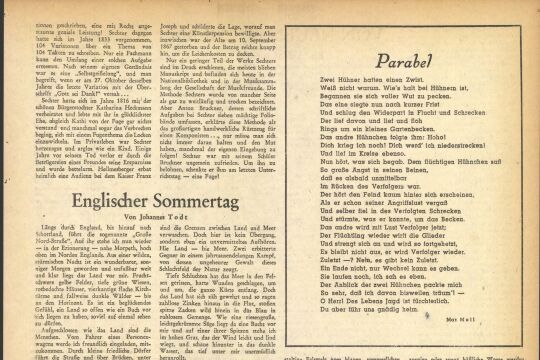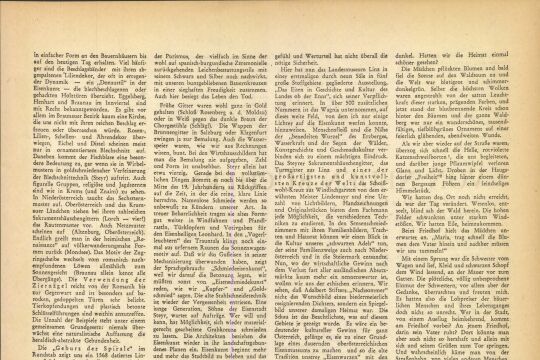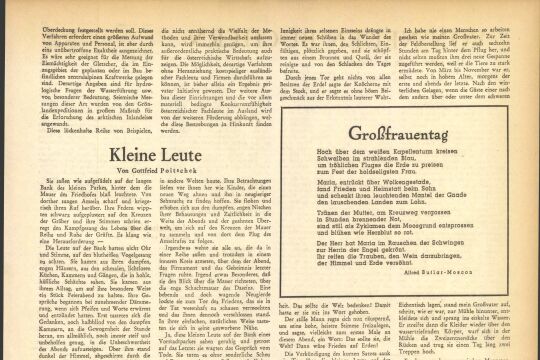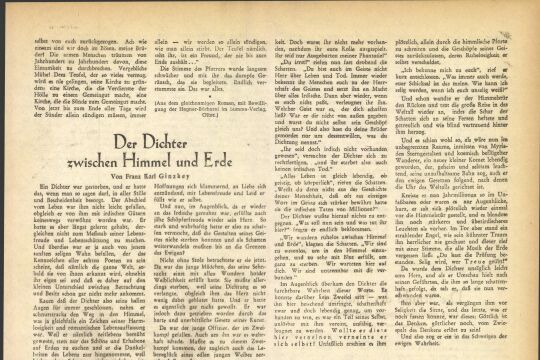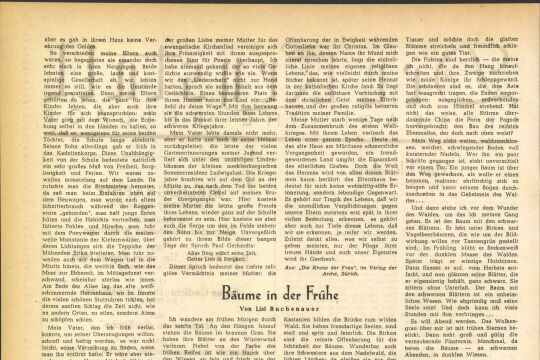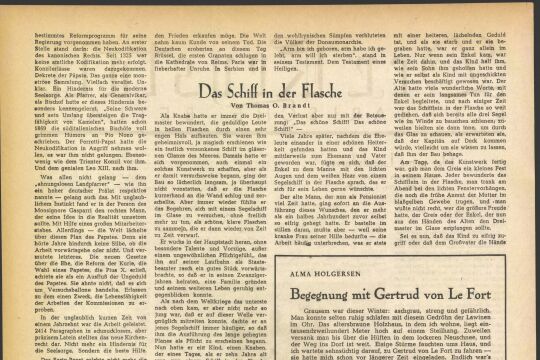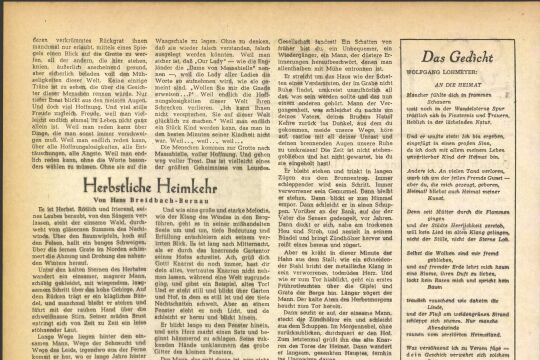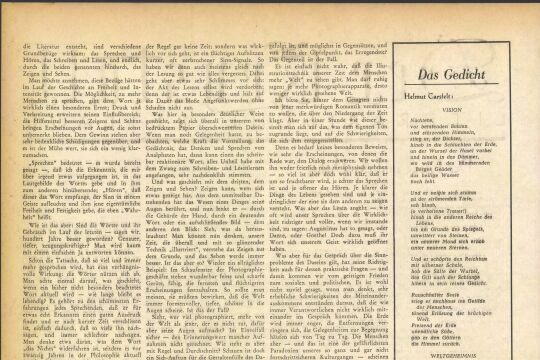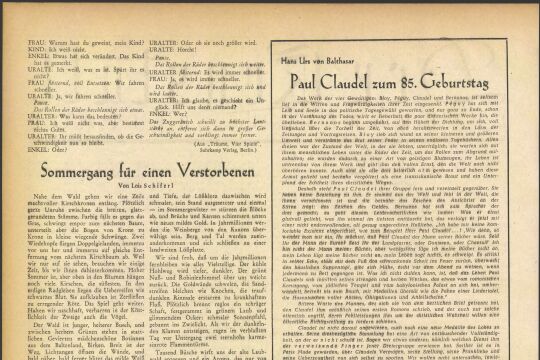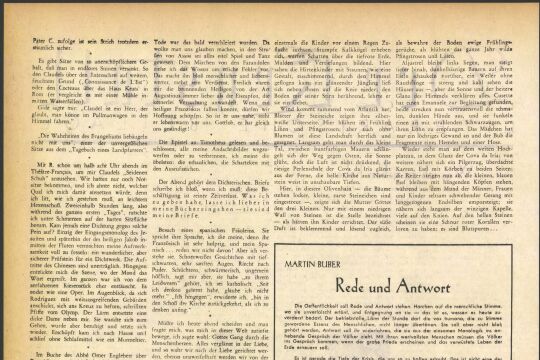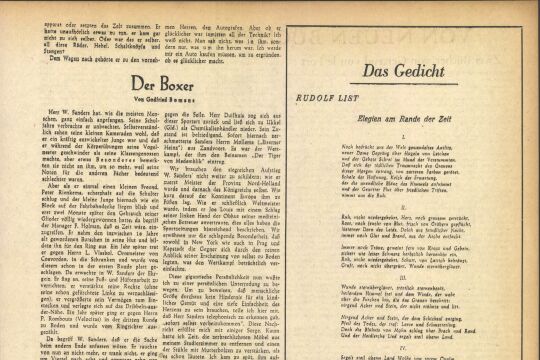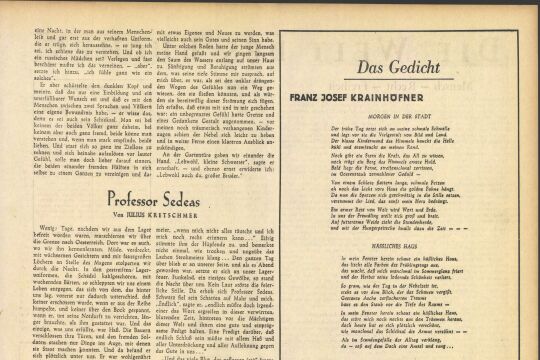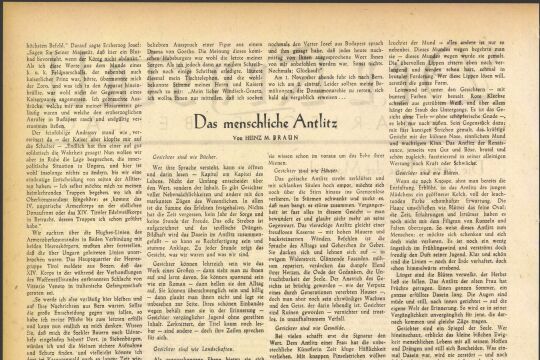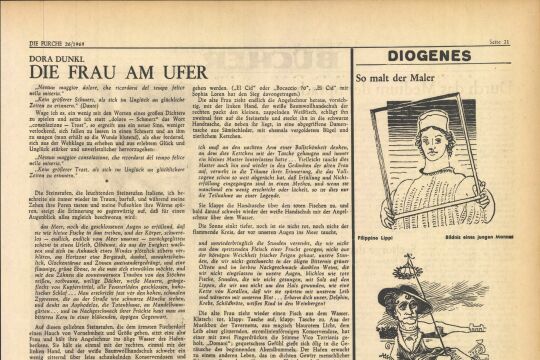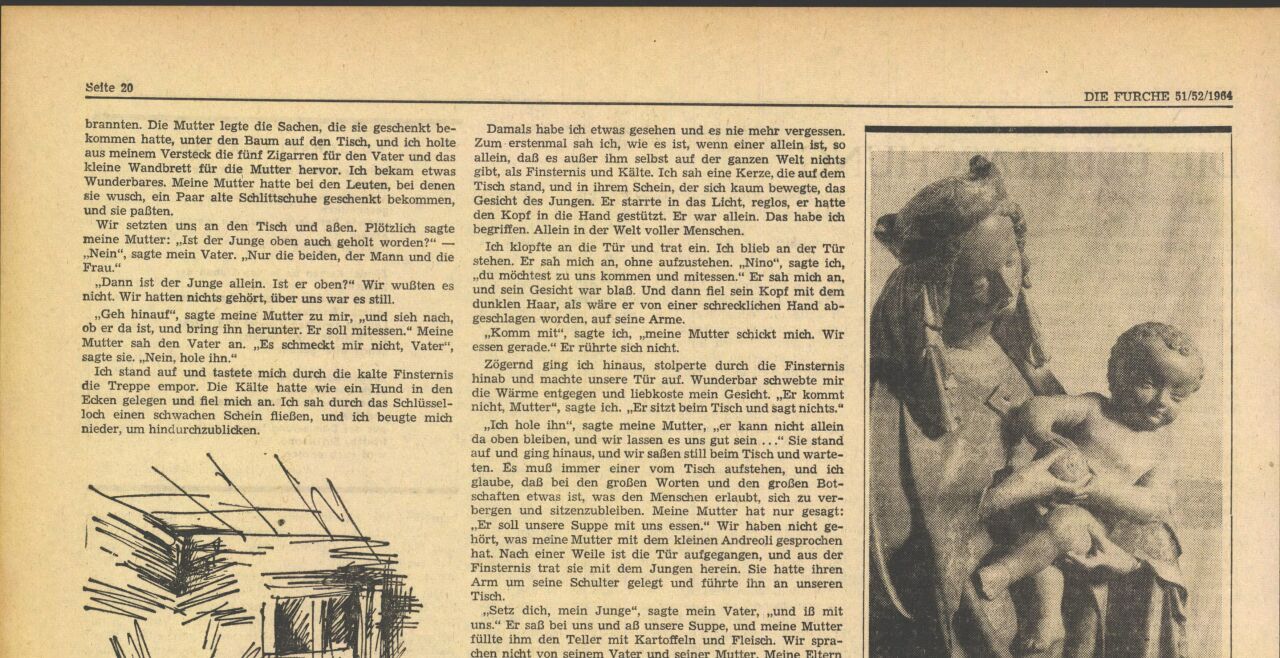
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
GANG ÜBER DAS JOCH
„Und jetzt muß ich gehen, wenn ich noch heimkommen will“, sagt Marie. Ihre Wangen glühen, denn sie ist lang beim Herd gesessen. Die Großmutter war gestorben, sie hatte ihr einige Gewänder und sechs Hinterglasbilder vererbt. Die Kleider freuen sie wohl, aber den Bildern schenkt sie keine Beachtung. Sie verabschiedet sich von ihren Verwandten, es ist Zeit, über das Joch zu wandern. In den Bergen liegt nicht viel Schnee, und wie gut kennt Marie den Weg über das Gebirge!
Sie tritt hinaus in den schillernden Tag. Das graue Licht lockt keinen Glanz aus ihrem korngelben Haar. Der Himmel hängt rauchfarben nieder, die Bäume auf den Steilhängen in ihrer stumpfen Schwärze drängen nąhe heran. Wie in meergrünem Wasser stehen die alten Fichten mit den wehenden Bärten, knisternd und summend. Nun kommt der Bergzaun, ineinanderverkrochene Almhütten. Die ansteigenden Wiesen glänzen wie von innen erhellt. Das Mädchen, von der Wichtigkeit und dem Ernst seiner 15 Jahre getragen, geht steil bergan. In der seidigen Graue dieses Tages ist sie blank und wach wie nichts rundum. Ihre lackroten Wangen haben dieselbe Farbe wie die Füßchen der Schneehühner, die sich vor ihr knarrend erheben. Als es ein wenig zu schneien beginnt, ist Marie schon hoch droben bei den Zirbelbäumen, deren gewaltige Leiber gewaltige Äste ausbreiten; in ihnen klingt dunkel der Wind. Beinahe schwarz flockt es aus dem einsamen Himmel. Erst schwanken die Schneesterne nur langsam nieder, später werden sie zu schrägen Schnüren, in die Unendlichkeit gespannt.
Marie versinkt darin, tausende Schneeflocken teilen ihren Körper und gliedern ihn in die Landschaft ein. Knapp bevor sie auf das Joch kommt, fällt der Sturm sie an. Ganz plötzlich rast er daher, drohend und eisig. Sie zieht das wollene Tuch tiefer in die Stirn. Hinter ihr füllen sich ihre Fußstapfen mit leichtem Schnee. Gleichgültig stellt sie fest, daß sie eine Rast halten muß. Sie hockt sich in eine Mulde. Ja, diese Wildheit kennt sie, die aus schimmernden Hängen graue Fremdheit macht. Und instinktiv versteht sie es, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Sie kramt in ihrem Rucksack und voll Eifer beginnt sie, mit einer der Glastafeln, die Grube zu vertiefen. Aber bald schmerzt sie das Gesicht so sehr, daß sie es mit dem gebeugten Arm zudecken muß. Der Wall ist noch immer zu niedrig. Das Schreien und Rasseln des Sturmes geht allmählich in ein monotones Fauchen über. Marie duckt sich zusammen und sie beschließt, in dieser Grube zu bleiben. Wie lang: darüber denkt sie nicht nach.
Der kalte Wind fegt ihr den Schneestaub ins Gesicht. Ja, der Wall aus Schnee vermag sie nicht zu schützen. Das Mädchen beginnt sich hier häuslich niederzulassen. Ganz wie ein spielendes Kind stellt sie die Glastafeln rund um sich auf. Nun stecken sie in dem Schneewall, lückenlos aneinandergereiht. Marie lächelt schlau: Nun haben sie plötzlich einen Sinn, die Bilder, die sįe vordem gar nicht beachtet hat. Jetzt ist es auch möglich, daß sie die Laterne anzünden kann.
Das Licht läßt alles hell aufleuchten. Erschreckend nahe sind die Gesichter der Heiligen und auf resedengrünem Hintergrund weiße Lilien. Die Jungfrau auf dem einen Glasbild hat einen leuchtend blauen Mantel an. Noch nie hat die Kleine Farben so erschreckend schön gesehen. Durch den zuckenden Schein der Laterne, durch den eigenen Atem bekommen die Figuren geheimnisvolles Leben. Die Gottesmutter selbst kommt auf sie zu, bis zu den Knien versunken im tiefblauen Schnee, ein goldener Himmel öffnet sich und erhellt das stumpfe Grau der Dämmerung.
So umgeben die Gestalten der Heiligen das Mächen. Maria, der Nährvater Josef und der Jesusknabe, und im flak- kernden Rot hängt triumphierend die Sichel der heiligen Notburga. Die Glastafeln bilden, aneinandergereiht, ein Haus, ein Obdach gegen die Stürme, das völlige Dunkel, gegen die Dichte der Finsternis auf Erden. Auch der heilige Michael und der heilige Florian waren durch den tiefen Schnee gekommen, die kleine Marie zu schützen. Außerhalb des Licht- soheiijes steigt aus der ödnis ein summender Ton, schwillt an, es rollt in den Tiefen, kracht und poltert, einbrechen will der Sturm in den behüteten Raum, aber er kann sich nicht durchzwängen zwischen den meerblauen, den zinnoberfarbenen Gewändern, vermag nicht einzudringen in die resedengrüne Dichte, und in das Gewirr der schneeigen Lilien.
Marie hockt zusammengekrümmt in der Mulde und sie wundert sich über gar nichts. Sturm ist gekommen, sie stellte die Glasbilder rund um die Grube auf und jetzt haben sie einen Sinn. Sie betrachtet alles ganz genau, und staunt über die Pracht der Farben. Ein wenig muß sie vor sich hinkichem, weil der Nährvater Josef nur einen Arm hat; den anderen hat der Maler vergessen. Sie reibt sich die Hände, duckt den Kopf ein wenig und schlummert ein. Der Schnee fällt nun schwarz und undurchdringlich. Die Kerze in der Laterne ist längst ausgegangen.
Und wenn auch am Morgen alles von blindem Grau überwuchert ist, die Farben erloschen sind, die Gesichter der Heiligen unkenntlich, die prunkenden Töne matt, so erhebt sich Marie dennoch wohlbehalten, nur ein wenig steif. Sie gähnt. Es herrscht milde Stille. Die Bilder sind jetzt schneeüberkrustet, kaum kenntlich, im ersten Licht blinkt nur die Sichel der heiligen Notburga. Die Glastafeln bilden, aneinandergereiht ein Haus, ein Obdach gegen das völlige Dunkel, gegen die Dichte dieser Finsternis auf Erden.
Marie hüllt die alten Tafeln wieder in die Gewänder, die sie geerbt. Mit steifen Fingern verstaut sie alles in ihren Rucksack. Nebelwülste lagern noch über dem Joch, das sie jetzt, munter wie ein Kind, das in seinem Bett wohlbehütet geschlafen hat, überschreitet.
Die Welt wird hell.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!