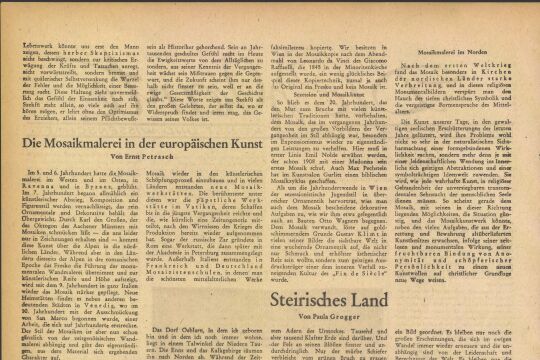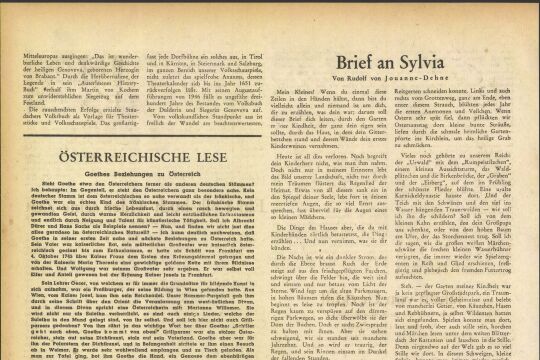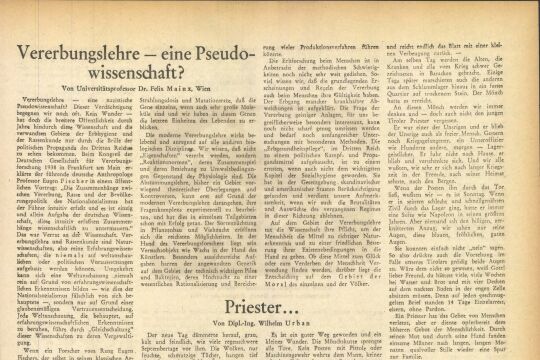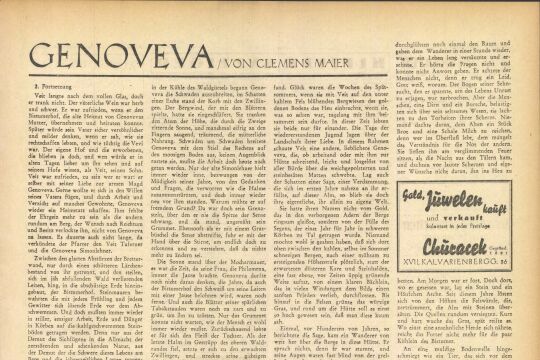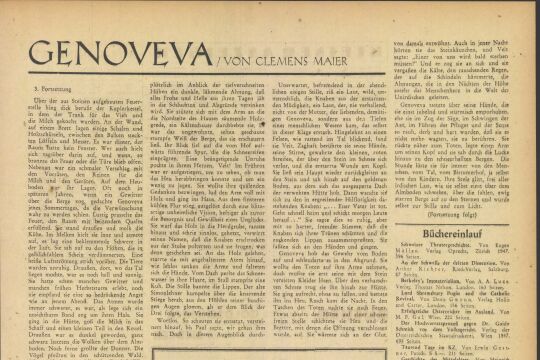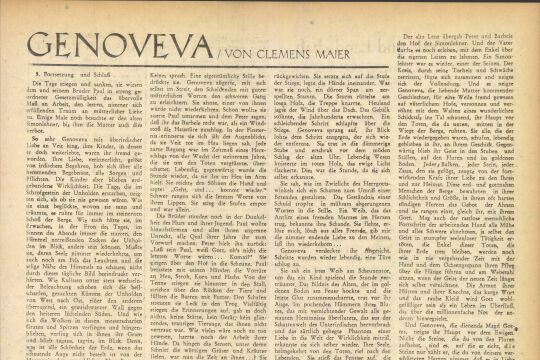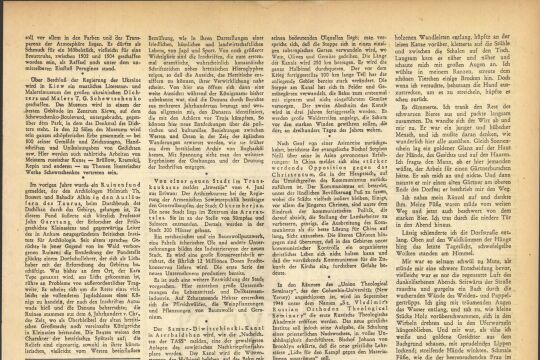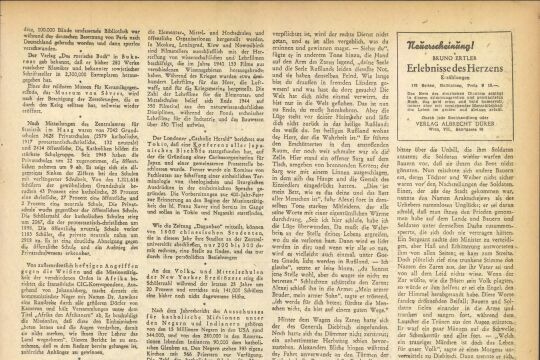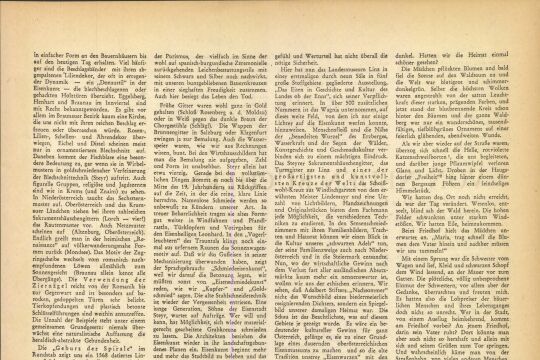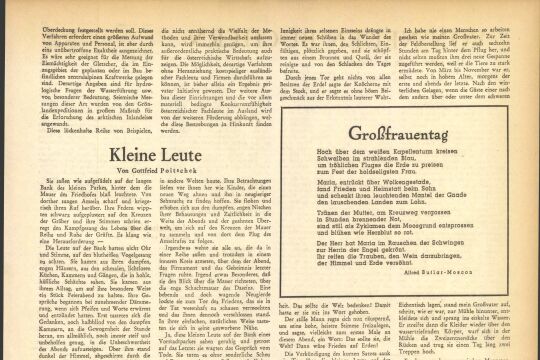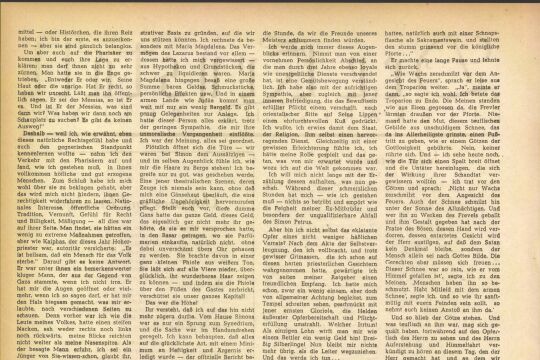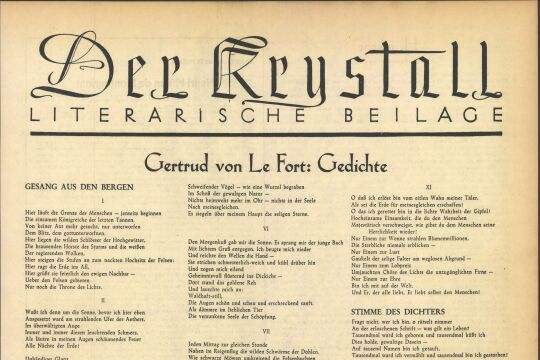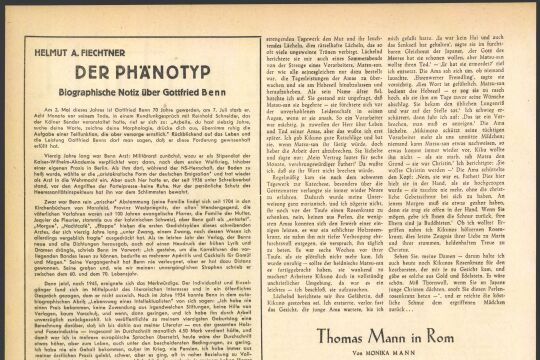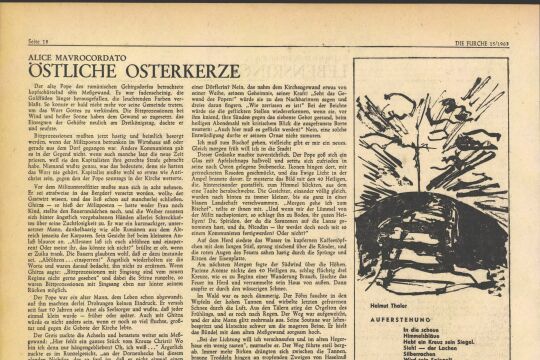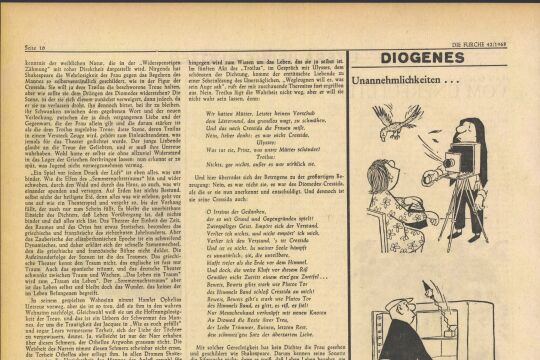Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DIE BRUDER VOM BERG
Das kleine Kloster lag auf halber Höhe des Berges, wo sich erste Tannen zwischen Buchen und Birken mischen, und der Pfad, der durch den Wald hinführte, war wenig getreten.
Ein paar Mönche führten dort ihr weitabgewandtes Leben mit Gebeten und Liturgien zu Ehren Gottes und der Heiligen. Sie nährten sich von Beeren, Pilzen und wilden Früchten. Das Klopfen des Schlagbretts und zitternd schwaches Glockengebimmel tönten, wenn der Wind aus der Richtung des Klosters wehte, bis hinab ins Tal, zu den Dörfern am Altfluß. Die Bauern nahmen ihre Pelzmützen — oder im Sommer die runden Filzhüte — ab, sahen zum Berg hinauf und bekreuzigten sich.
Der Stifter — vielleicht ein Bojar aus Altrumänien, jenseits der Karpaten, der mit der Errichtung der frommen Stätte eine Schuld von seiner Seele wälzen wollte — mochte nicht vorausgesehen haben, daß die Summe Geldes, die er zur Instandhaltung des Klosters und zum Lebensunterhalt für die frommen Brüder beim Bischofssitz von Curtea-de-Arges hinterlegt hatte, ein knappes Jahrhundert später ihren Wert längst verloren haben würde. Das viereckige Gebäude aus Stein hielt wohl stand; doch der Glockenturm vermorschte nach und nach, die hölzerne Kirchentür hing nur noch schief in den Angeln, im Gebetgestühl tickte der Wurm; im Frühling trug der Wind Unkrautsamen durch die zerbrochenen Fenster, setzte ihn zwischen Ritzen und Spalten, Blindschleichen und Haselmäuse nisteten hinter den Altarwänden. Die Mönche wehrten ihnen nicht. Mochten sie ruhig den Psalmen und Litaneien zuhören!
An hohen Feiertagen kamen die Dörfler aus dem Tal. Sie beteten vor den alten Ikonen, erflehten von ihnen Wunder, Hilfe und Beistand in Krankheit, Not und Bedrängnis — stellten den Mönchen, die unbeweglich im Gestühl hockten, Körbe und Schüsseln mit Lebensmitteln hin. Die frommen Männer nickten nur stumm und ließen die hölzernen Rosenkranzkugeln durch ihre gelben Finger gleiten. Fünf oder sieben Greise mochten es sein — man wußte nicht, welcher von ihnen der Starez war. Sie hatten alle die gleichen fleischlosen Gesichter und weißen Barte.
Als wieder einmal der lange Winter vorüber und der Tag des heiligen Georg gekommen war, fanden die Bauern nur noch drei Mönche vor. Der eine — ein hagerer Alter mit hellen Augen, die gütig unter den buschigen Brauen hervorsahen — wies mit dem Daumen nach Erdhügeln hinter der Kirche. „Der lange schwere Winter“ murmelte er wie entschuldigend, und die beiden anderen nickten. Auch sie waren abgezehrt — der eine, ein Männchen, dessen Gesicht kaum so groß wie eine Handfläche schien, der zweite, halb zur Erde gekrümmt, mit schütterem Bart.
Die Bauern beschenkten sie reichlicher als sonst. Ein Bursch lief noch einmal zurück und legte einige Kleidungsstücke vor die Kirchentür. v
„Hast du es ihnen gesagt?“ fragten die anderen. „Man müßte die frommen Brüder warnen!“
„Sie verstehen es doch nicht... daß wir jetzt in einen Kolchos kommen sollen und all das mit dem Kommunismus ...“
„Man wird das Kloster schließen!“
„Die Miliz ist schon überall gewesen ...“ ,
„Nur bei den Brüdern vom Berg nicht!“ „Vielleicht hat man sie vergessen?“
„Oh... das wäre gut!“ Eine Frau bekreuzigte sich. „Heiliger Georg, mach, daß man die armen Brüder vergißt!“
„Wenn sie nur nicht das Schlagbrett klopfen würden!“
Die Dörfler schwiegen das letzte Stück des Weges. Angst schnürte ihnen die Kehlen zu. Sie zerstreuten sich am Dorfrand und suchten ihre Gehöfte auf. Der Milizposten im Gemeindehaus hatte scharfe Augen!
Es wurde Sommer. Oben, im Wald um das Kloster, begann die gute, reiche Jahreszeit. Hellgelb stäubten die Föhrenzweige, wilde Bienen summten um die Kronen der Berglinden, Wildkirsohe und Holzapfel verblühten, die Singvögel schwiegen und brüteten in ihren Nestern, der Ruf des Kuckucks klang träge durch den warmen Mittag.
Die drei alten Mönche wußten, wo die Heidelbeeren zuerst reiften, in welchem hohlen Baumstamm die Bienen ihre Honigwaben versteckten und griffen Forellen mit der Hand aus dem Bach. Es war alles wie in jedem Jahr — nur kamen immer weniger Dörfler zum Kloster emporgestiegen. Der Hagere, der jetzt Starez war, zählte sie jedesmal genau, wenn er auch die Augen halb geschlossen hielt und in Andacht versunken schien. Am Tag der Heiligen Elena und Constantin waren es noch fast ein Dutzend gewesen — am Eliastag gerade sechs und gar zur Kreuzerhöhung, Anfang September, nur noch vier! Was hatte das zu bedeuten? Sie brachten weit mehr Gaben, als es sonst Brauch war, stellten gewissenhaft die Körbe in zwei Reihen auf, als erfüllten sie Aufträge der Daheimgebliebenen, und hasteten verlegen davon.
Auch das gab zu denken!
Langsam kam der Herbst. Die Blätter rauschten von den Bäumen und verschütteten die Wege; manchmal strich ein Fuchs zwischen den Stämmen, und ein blaßblauer Himmel wölbte sich über den Wipfeln. Die Mönche suchten Steinpilze und Bitterlinge, die im Moos, an sonnengefleckten Stellen steckten, und nach den wilden Äpfeln mit süßherbem Duft zwischen trockenem Laub.
Dann fiel erster Reif und hing wie ein blaugrauer Winterpelz an den Lehnen. Die Sonne versank am Nachmittag dunkelrot hinter dem Berg. Kalt stieg es aus den Tälem.
Am Weihnachtstag begann es zu schneien. Vier bewaffnete Milizsoldaten erstiegen den steilen Weg. Sie hatten Befehl, das Tor des Klosters zu versiegeln und die Mönche ins Tal zu bringen. Unterwegs tranken sie sich Mut aus dem Pflaumenschnaps ihrer Feldflaschen an — Burschen vom Lande, die weder lesen noch schreiben konnten und denen bei diesem Unternehmen nicht allzuwohl zumute war.
Sie stürzten in die Kirche: „Geht arbeiten, ihr Nichtstuer! Das Kloster wird geschlossen! Befehl der Partei!“
„Wer ist die Partei?“ fragte der Starez leise.
„Nehmt die Ikonen und Meßgeräte und geht!“ drängten die Soldaten. „Wir wollen keine Gewalt anwenden.“ Sie begannen die Türen zu versiegeln und stießen die Greise ins Freie. Die alten Mönche liefen wie aufgescheuchte Waldtiere den Pfad hinab.
Der Anführer der Streife zuckte gelassen die Schultern als er die beklommenen Blicke seiner Mannschaft bemerkte. „Laßt sie, bei dem Wetter kommen sie nicht weit.“
„Es war nicht recht...“, flüsterten die Soldaten untereinander, „heute ist Weihnachten! Die Strafe des Himmels ...“
Der Unteroffizier tat, als höre er die Worte nicht und stapfte gewichtig durch den halbzerfallenen Innengang des Klosters.
Der Schnee sohüttete dicht aus den niederen Wolken und drückte die Äste der Tannen nieder. Der Wald schien zu schlafen. Der Wildbach führte wenig Wasser, und an seinen Ufern hatten sich Eiskrusten gebildet, die Marder und Wiesel mißtrauisch prüften. Die Farnkräuter, fahlbraun und verschrumpft, verschwanden unter dem frischgefallenen Schnee. Er lag flaumig auf dem frostverbrannten Gras.
Die drei Mönche schleppten sich mühselig am Bachrand entlang. Sie hielten die Ikonen fest an sich gepreßt. Sie waren aus Lindenholz, mit den unbeholfen gemalten Gestalten der Heiligen bedeckt. Zeit, Kerzenqualm und die Lippen der Andächtigen hatten die Farben verwischt und sanft getönt, aber den Bildstöcken nichts von ihrer geheimnisvollen Kraft genommen.
Die Mönche stolperten in löchrigen Bundschuhen, ihre Kutten hingen zerfetzt an den dürren Körpern. Der Gebückte verfing sich an einem Sehlehenbusch, der mit seinen Dornenzweigen nach ihm langte. „Ach, laß mich doch!“ flüsterte der Greis hilflos, als wäre der Busch ein Lebewesen, das seine Worte verstünde, „siehst du nicht, wie elend wir sind?“
„Komm!“ drängte der Starez, „wir müssen vor Abend im Dorf sein. Bei dem Wetter können wir nicht im Freien nächtigen.“
„Laß uns nur ein wenig ruhen!“ bettelte der Dritte.
„Ja ... nur ein wenig ausruhen!“ wiederholte der Gebückte.
Der Starez sah sie sorgenvoll an. Wohin sollte er die zwei gebrechlichen Brüder führen? Sie hatten keinen Unterschlupf für den Winter, keine Kleidung, keinen Besitz, außer den alten Ikonen und ihrem Vertrauen auf Gott.
Sie setzten sich auf einen Stein und beteten. Jeder beugte sich tief zur beschneiten Erde, als wollte er die leise gemurmelten Worte geheimnisvoll für sich bewahren.
Der Schneefall hörte auf. Es dämmerte und wurde dunkel — sie merkten es nicht. Als sie schließlich die Köpfe hoben, zerteüte sich das Gewölk. Sterne funkelten am Himmel. Die Christnacht sank herab!
„Es waren Hirten auf dem Felde...“, begann der Starez leise das Weihnachtsevangelium.
Die Greise rückten ganz nahe aneinander. Sie fühlten weder Hunger noch Kälte noch ihre Verlassenheit und Armut. „Fürchtet euch nicht...“
Der helle Schein der Blendlaterne schimmerte durch die Stämme und kam langsam näher.
„Seht doch ... ein Engel!“ Der kleine Mönch, dessen Gesicht nur so groß wie eine Handfläche schien, deutete vor Freude zitternd darauf.
Der Starez erkannte als erster, daß es kein Engel war, der dort in langem Uniformmantel den Hang herabstieg. „Der Unteroffizier? Was will er noch von uns?“ Er stand auf, trat ihm entgegen, die gefalteten Hände wie in Bitte und Abwehr erhoben.
Der Unteroffizier, ein derb-untersetzter Bursch mit ausdruckslosem Gesicht, dem der schwarze kurze Schnurrbart etwas Bösartiges gab, blieb stehen. „Was treibt ihr hier?“ knurrte er und ließ den Lichtschein sedner Laterne über die drei Mönche kreisen.
„Christus ist in Bethlehem geboren ...“
„Es ist Christnacht...“
„Wir beten.“
„Macht, daß ihr in euer Kloster zurückkommt!“ Die Stimme klang belegt, fast unsicher. „Wir haben das Tor versiegelt ... aber es gibt ja auch eine Hintertüre!“ Der Uniformierte hob grüßend seine Hand an die Mütze. „Das Schlagbrett sollt ihr nicht mehr klopfen — oder, wenn es schon sein muß, nicht so laut“, sagte er noch im Weitergehen und tauchte wieder in die Dunkelheit.
„Wir können wieder in unser Kloster gehen! Gott hat sich unser erbarmt! Kommt, Brüder!“ Die drei alten Mönche gingen — einer hinter dem anderen — wie in feierlicher Prozessdon durch das verschneite Bachtal, und ihre dünnen Greisenstimmen sangen die fromme Liturgie der Weihnachtsnacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!