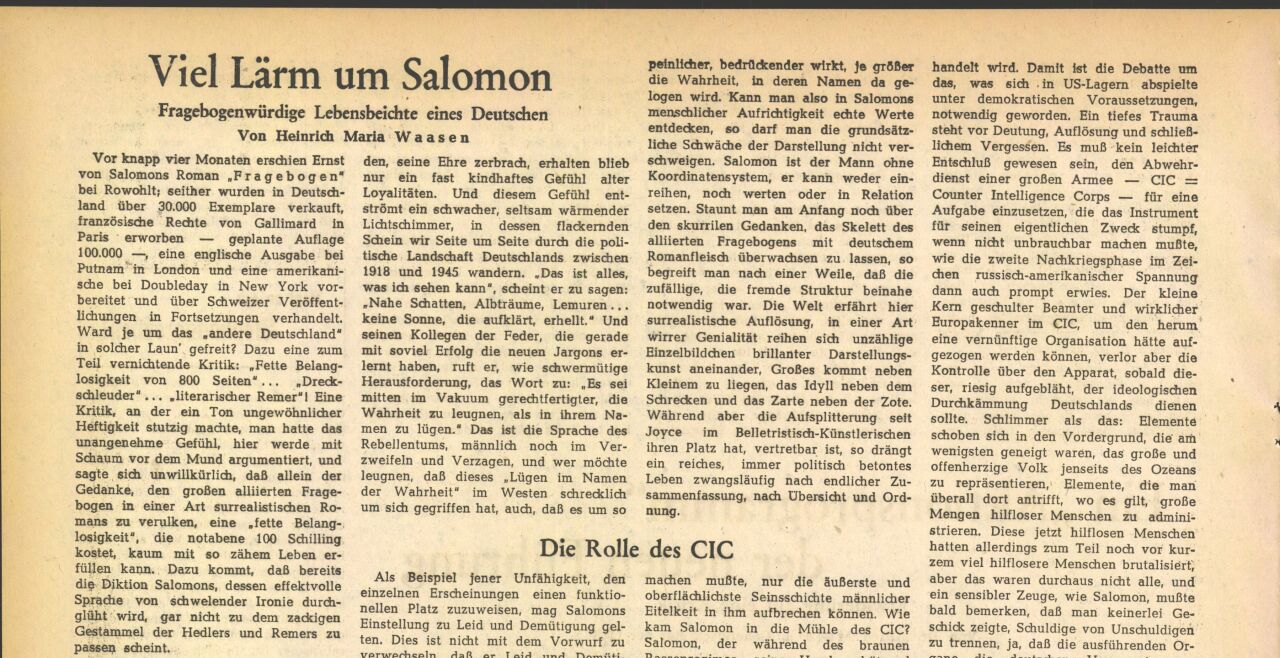
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Viel Lärm um Salomon
Vor knapp vier Monaten erschien Ernst von Salomons Roman „Fragebogen“ bei Rowohlt; seither wurden in Deutschland über 30.000 Exemplare verkauft, französische Rechte von Gallimard in Paris erworben — geplante Auflage 100.000 —, eine englische Ausgabe bei Putnam in London und eine amerikanische bei Doubleday in New York vorbereitet und über Schweizer Veröffentlichungen in Fortsetzungen verhandelt. Ward je um das „andere Deutschland“ in solcher Laun' gefreit? Dazu eine zum Teil vernichtende Kritik: „Fette Belanglosigkeit von 800 Seiten“... „Dreckschleuder“... „literarischer Remer“! Eine Kritik, an der ein Ton ungewöhnlicher Heftigkeit stutzig machte, man hatte das unangenehme Gefühl, hier werde mit Schaum vor dem Mund argumentiert, und sagte sich unwillkürlich, daß allein der Gedanke, den großen alliierten Fragebogen in einer Art surrealistischen Romans zu verulken, eine „fette Belanglosigkeit“, die notabene 100 Schilling kostet, kaum mit so zähem Leben erfüllen kann. Dazu kommt, daß bereits die Diktion Salomons, dessen effektvolle Sprache von schwelender Ironie durchglüht wird, gar nicht zu dem zackigen Gestammel der Hedlers und Remers zu passen scheint.
Was aber den Inhalt des neuen Buches anbelangt — Salomon war bekanntlich seinerzeit in den Mord an Rathenau verwickelt und büßte die Schuld im Zuchthaus —, so basiert die Behauptung, daß es sich hier um ein neonazistisches Werk handle, auf drei Argumenten: 1. Salomon ist kein Demokrat. (Er gibt dies in der Tat ganz offen zu, sagt, daß er sioh unter „Demokratie“ nichts Präzises vorstellen könne.) 2. Salomon ist bar eines lebendigen, religiösen Gefühls, er gehört also nicht zu den Männern, die, wie etwa Niemöller, sich trotz allem einer eindeutigen politischen Klassifikation entziehen. 3. Salomon ist kein Kommunist. Welcher Gruppe kann man ihn also zuzählen? Nun, es bleibt ja nur der Neonazismus über! Aber in diesem „ergo“ liegt viel von der Problematik unserer Zeit, der Problematik unserer Intellektuellen. Da ist zunächst die Nützlichkeit, oft gar die Notwendigkeit, sich einem Lager zuzugesellen, sodann die Erfahrungstatsache, daß die meisten es so halten, schließlich die intolerante Schlußfolgerung, daß man einen Mann, den man in den ersten Lagern nicht gefunden habe, im letzten gar nicht suchen brauche, dort müsse er ja sein.
Die Schriftsteller, die anscheinend ohne tiefen, bis an die Wurzeln der Existenz gehenden Kampf aus dem nationalen ins europäische Lager übergesiedelt sind oder im Schatten diverser Galgen auf der Bank der Spötter sitzen — auch das eine Gruppe und Schule —, um endlose Listen vergangener Schrecknisse anzulegen, in denen auch die der Jüngstvergangenheit ihren Platz haben, repräsentieren aber nur eine breite Schicht von Menschen, die äußerlich Stellung bezogen haben, ohne durch ein tiefes, zwingendes Erlebnis dahingekommen zu sein, die zwar der vagen Meinung sind, ihr Lager sei, wie die Dinge liegen, wohl noch das beste, trotzdem auf die Notwendigkeit oder Nützlichkeit, Farbe zu bekennen, mit Ressentiment reagieren. Die Zeiten, da man innerlich Stellung nahm, heimlich einen Kult, einen Monarchen, einer Staatsform nachlebte und nach außen farblos blieb, um, wie T. S. Eliot es nannte, „leben und halbwegs leben zu können“, sind vorbei, man trägt nach außen Deckfarbe, ist innerlich grau, unentschlossen, führungslos. Ernst von Salomon aber ist, wohl ohne es recht zu wissen, zum Sprecher dieser Masse geworden, zum Sinnbild derer, die, in fremden Lagem heimatlos, den bewundern, der allein auf weiter Flur nicht nach dem schützenden Dach Ausschau hält. Darin liegt seine Bedeutung, darin wohl zum Teil auch sein Erfolg.
Salomon lebt lieber in eigenen Trümmern, als in fremden „Weltanschauungen“. Seine alten Vorstellungen und Ideale sind nach und nach zerstört wor-
den, seine Ehre zerbrach, erhalten blieb nur ein fast kindhaftes Gefühl alter Loyalitäten. Und diesem Gefühl entströmt ein schwacher, seltsam wärmender Lichtschimmer, in dessen flackernden Schein wir Seite um Seite durch die politische Landschaft Deutschlands zwischen 1918 und 1945 wandern. „Das ist alles, was ich sehen kann“, scheint er zu sagen: „Nahe Schatten, Albträume, Lemuren... keine Sonne, die aufklärt, erhellt.“ Und seinen Kollegen der Feder, die gerade mit soviel Erfolg die neuen Jargons erlernt haben, ruft er, wie schwermütige Herausforderung, das Wort zu: „Es sei mitten im Vakuum gerechtfertigter, die Wahrheit zu leugnen, als in ihrem Namen zu lügen.“ Das ist die Sprache des Rebellentums, männlich noch im Verzweifeln und Verzagen, und wer möchte leugnen, daß dieses „Lügen im Namen der Wahrheit“ im Westen schrecklich um sich gegriffen hat, auch, daß es um so
peinlicher, bedrückender wirkt, je größer die Wahrheit, in deren Namen da gelogen wird. Kann man also in Salomons menschlicher Aufrichtigkeit echte Werte entdecken, so darf man die grundsätzliche Schwäche der Darstellung nicht verschweigen. Salomon ist der Mann ohne Koordinatensystem, er kann weder einreihen, noch werten oder in Relation setzen. Staunt man am Anfang noch über den skurrilen Gedanken, das Skelett des alliierten Fragebogens mit deutschem Romanfleisch überwachsen zu lassen, so begreift man nach einer Weile, daß die zufällige, die fremde Struktur beinahe notwendig war. Die Welt erfährt hier surrealistische Auflösung, in einer Art wirrer Genialität reihen sich unzählige Einzelbildchen brillanter Darstellungskunst aneinander, Großes kommt neben Kleinem zu liegen, das Idyll neben dem Schrecken und das Zarte neben der Zote. Während aber die Aufsplitterung seit Joyce im Belletristisch-Künstlerischen ihren Platz hat, vertretbar ist, so drängt ein reiches, immer politisch betontes Leben zwangsläufig nach endlicher Zusammenfassung, nach Ubersicht und Ordnung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































