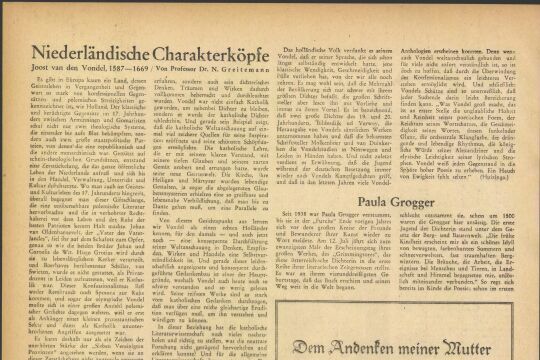Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Waffengang sprechen die Musen
Seit den Tagen, da die Kriegslyrik den unerreichten Gipfel des Engelland“- und Erika“-Liedes zu übertreffen suchte, bemühen sich die totalitären Herrscher verschiedener Couleur, auch die Dichtkunst den erhabenen Zielen des Staates dienstbar zu machen. Der schleimige Hofpoet von einst, der quasi statisch den Landesherrn zu besingen hatte, ist dem literarischen Dynamiker von heute gewichen, der, in das Weltgeschehen eingreifend, den Gang der Dinge beeinflussen soll. Es gibt heute bereits eine Blütenlese solcher Elaborate (einige besonders zügige Beispiele aus dem heutigen Ungarn wurden kürzlich in einer Wiener Zeitung veröffentlicht), denen sich mühelos Parallelerscheinungen, schöpfend aus ein und derselben Inspiration, in verschiedenen östlichen Zungen zugesellen Meßen.
Das alles ginge noch hin. Neu daran ist freilich der Umstand, daß derlei bestellte Arbeit in früheren Zeiten von angestellten Versefabrikanten geliefert wurde, die ernstzunehmenden Dichter dazu aber nur ihre Mußestunden oder Perioden notorischen Geldmangels benutzten, daß es heute aber dortselbst zum Prüfstein des Genies geworden ist, „aktiv“ zu dichten. Aber selbst das könnte man achselzudcend zur Kenntnis nehmen, wenn nicht ausgerechnet von dieser Seite und aus diesem Klima mit bewundernswerter Ausdauer und Zähigkeit Appell auf Appell an die Dichter der freien Welt erginge, zu einem Gespräch, zu einem begegnenden Treffen im geheiligten Atrium der Poesie zusammenzutreten. Und wenn 6ich nicht immer und immer wieder Menschen finden würden, die diese Einladung für bare Münze nehmen.
Es liegt uns daran, zu beweisen, daß ein solches Kulturgespräch im Streit der Weltmächte, diese geistige Begegnung im Rahmen eines imaginären Gesamtdeutschlands ein Widerspruch in sich und in diesem Rahmen, den besten, ehrlichen Willen auf beiden Seiten vorausgesetzt, unmöglich ist, unmöglich der inneren Natur nach. Die Diplomaten, die Wirtschaftsleute, die Praktiker des Verkehrs, der Post, des Handels, sie alle haben es unvergleichlich leichter. Sie können einander im Vorfeld der eigentlichen Probleme begegnen. Ihr Streit ist nicht unversöhnlich, ihre gefundenen Teillösungen sind in ihrer Art tragsicher. Hier aber wird die Grenze unüber-steiglich.
Gewiß, wir verstehen unter Gespräch kein verwaschenes Geschwätz allseitiger Toleranz. Als gläubige Katholiken bekennen wir uns zur grundsätzlichen Intoleranz dem Irrtum gegenüber, aber wir halten dafür, daß dennoch jedes Gespräch möglich ist, wenn man das Anliegen des andern im letzten ernst nimmt, wenn man ihn aus seiner eigenen Welt heraus versteht, wenn man den dieser Welt zugrunde liegenden Irrtum, diese Fehlhaltung als solche diskutiert, ihren Wahrheitskern untersucht, ihren Träger aber auch in seinem Irrtum durch und durch voll nimmt. Und eben das kann eine Dichtung, die unbewußt, viel öfter aber noch stolz bewußt Funktion eines innerweltlichen Götzen geworden ist, nicht tun.
Für all das kann das in der Woche nach Pfingsten zu Ende gegangene und erst jetzt in seinem verschiedenen pressemäßigen Niederschlag überschaubare Gesamtdeutsche Dichtergespräch“ in Leipzig zum Beispiel werden. Für den, der in Kenntnis der inneren Entwicklungslinien zwischen den Zeilen zu lesen versteht. Die Fakten mögen hart sein, besonders deswegen, weil wir nur eine Sprache und eine begriffliche Nomenklatur haben, die wehrlos dem Zugriff dieses oder jenes totalen Usurpators ausgesetzt ist. Und weil eine letzte Scheu den einen oder anderen westlichen Dichter ehrlich guten Willens davon zurückhält, einen so heiligen und geheiligten Begriff wie .Kulturgemeinschaft“, „Einheitsgefühl“, „Friedensgedanke“, „ritterliches Streitgespräch“ fallen zu lassen, bloß weil er, wie vorstehend skizziert, von einer Seite in Anspruch genommen wird, die ihn zu seinem Gegenteil degradiert. Und dennoch hat diese schmerzhafte Klärung auch in Deutschland, dem Lande der Gründlichkeit, aber auch des Ressentiments und der Gefühlsbetontheit, eingesetzt. Das bewies nicht zuletzt der Leipziger Kulturkongreß, zu dem Johannes R. Becher, der schon zuvor Gespräche mit westdeutschen Dichtern beim „Kaffee“ in München entriert hatte, arrangieren wollte. Die Klärung war fast dramatisch zu nennen.
Schon wenige Wochen vorher hatten deutsche Dichter nicht nur ihren eigenen Trennungsstrich gezogen, sondern auch allgemein an das Verstehen ihrer Kollegen appelliert, das, wie Rudolf P e c h e 1, der bekannte freikonservative, christliche Publizist, schrieb, sich nun nicht mehr „auf Gutgläubigkeit und Tumbheit ausreden könne“. Ähnlichlautende Erklärungen kamen aus der Feder des Romanciers Stephan Andres, des Vorsitzenden des Berliner Schriftstellerverbandes und unermüdlichen Aufklärers Günther B i r k e n f e 1 d und, am gewichtigsten wohl, von der Seite P1 i e v i e r s, der als Autor des „Stalingrad“-Buches und Kenner der Sowjetunion, als Präsident des thüringischen Kulturbundes und bewährter Vorkämpfer der Linken, durch seine Flucht aus der Ostzone und die ihr folgende schwerringende Auseinandersetzung mit den Idealen seines Schriftstellerlebens das Problem vielleicht am eindringlichsten durchdacht und durchlitten hatte.
Dennoch fuhren einige Dichter hin. Es waren nicht die versprochenen vierhundert Prominenten“, sondern es war eine in vieler Hinsicht namenlose Schar. Namenlos vor dem Forum der Literatur, namenlos auch nach dem Willen Bechers, der ihre Nennung vermied, um, wie er wörtlich sagte, „sie in ihrer Heimat nicht der Behandlung von Gangstern auszusetzen“. (Die Steine für dieses Glashaus ostzonaler Heuchelei liegen zu nahe am Wege, als daß es der Mühe wert wäre, sie aufzuheben.)
Aber selbst jene, die wirklich in Leipzig eintrafen und denen man schon mehr Sympathie als Objektivität zuschreiben muß, schieden sich zu Anfang des Kongresses von selbst. Alles, was den Eindruck der offenen Tür verringern konnte, so die Haßparolen gegen Adenauer, war, Augenzeugenberichten nach, aus dem Stadtbild verschwunden. Neben der noch vorhandenen dichterischen Prominenz des Ostens, in deren Reihen auch der schweigsame Bert Brecht erschienen war, zierten die Spitzen von Partei, Staat und Wehrpolizei“ das Forum. Und dann kam es zu einer für die breite Öffentlichkeit Ostdeutschlands ziemlich vertuschten Szene, die an den zweiten Akt des .Tannhäuser“ gemahnt. Ähnlich wie Heinrich von Ofterdingens aggressive Lyrik müssen die Worte von der Freiheit des dichterischen Kunstwerks aus dem Munde des Münchner katholischen Dichters Döderlein in den Ohren der staatsfrommen Barden geklungen haben, als er unter anderem der staatlich geforderten Tendenzkunst leidenschaftlich entgegentrat. Die Erwiderung des ostdeutschen Volksbildungsministers war zwar gemessen, aber dennoch voll verhaltener Deutlichkeit. Nun, im „Tannhäuser* war es leichter. Der also sündige Sänger bereut und pilgeit sühnend südwärts gen Rom. Herr Döderlein aber packte seinen Koffer, zusammen mit einigen anderen Kollegen, und fuhr auch südwärts, gen München. Geheilt.
Nun war man wirklich unter sich. Man war, um bei dem volksdemokratischen Vorahner Goethe und seinem Walpurgisnachtstraum zu bleiben, „von Geistern und vom Geist geheilt“. Es war nur folgerichtig, daß Becher den verbliebenen fortschrittlichen Dichtern, die in bewegten Worten ihr Leid im Westen in die Mikrophone klagten, weitgehende Unterstützung, ja sogar das Bürgerrecht der Deutschen Demokratischen Republik versprach. Die westdeutsche Bundesregierung hätte ihren Beitrag in Gestalt eines Freifahr- und Ubersiedlungsscheins für diese Barden leisten sollen.
Und doch sollte man über all dies nicht lachen. Der Mummenschanz der Geistesfreiheit von Leipzig darf niemanden darüber hinwegtäuschen, daß es eine brennende Sehnsucht, ein legitimes Anliegen des Ost-West-Gesprächs — nicht nur in Deutschland — gibt. Die Musen jener Dichter und Künstler hinter dem „Eisernen Vorhang“, die im Waffengang nicht reden dürfen, sondern zum Schweigen verurteilt sind, wenn sie nicht lügen wollen, haben ihr Haupt verhüllt. Diese Menschen brennen auf eine echte Kommunikation, ringen um ein verstehendes, klärendes Gespräch mit Menschen der freien Welt. Ohne Kongreß, in Briefen mit Deckadresse und ohne Absender. Das möge niemals vergessen werdenl
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!