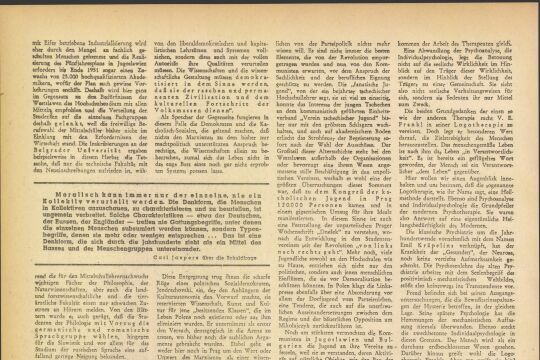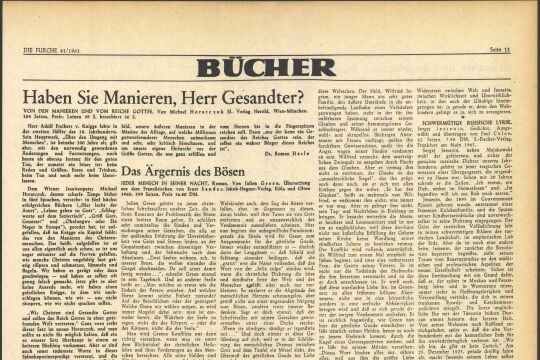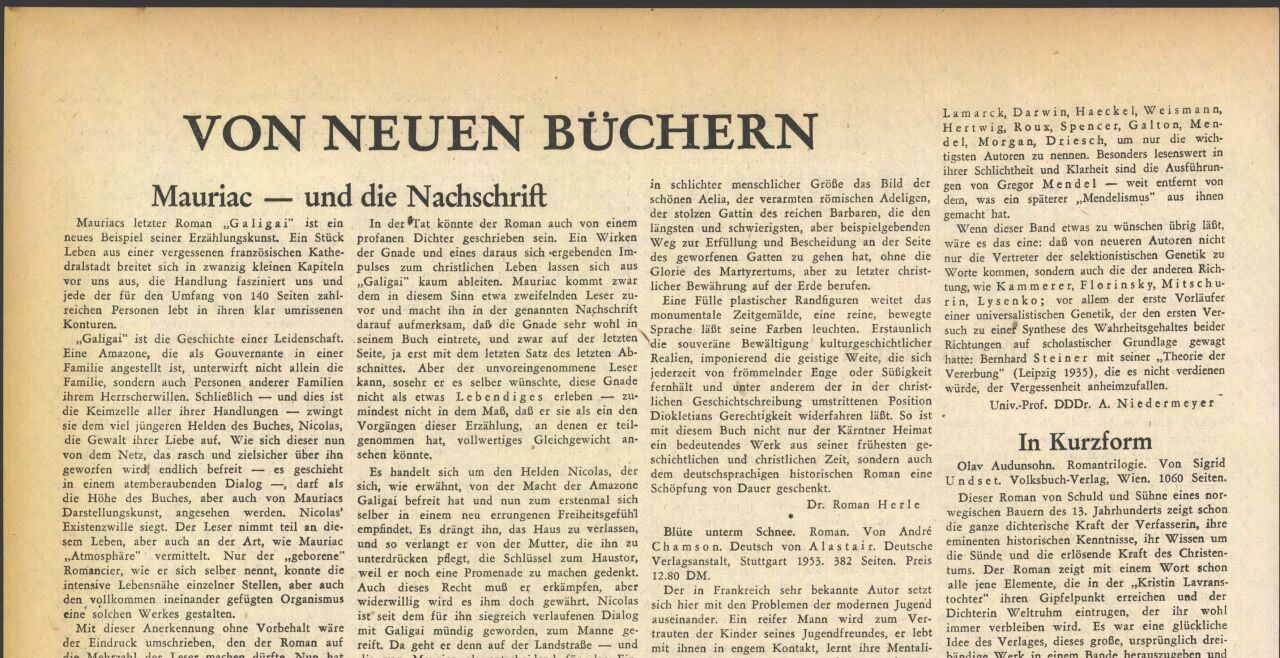
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mauriac — und die Nachschrift
Mauriacs letzter Roman „G a 1 i g a i“ ist ein neues Beispiel seiner Erzählungskunst. Ein Stück Leben aus einer vergessenen französischen Kathedralstadt breitet sich in zwanzig kleinen Kapiteln vor uns aus, die Handlung fasziniert uns und jede der für den Umfang von 140 Seiten zahlreichen Personen lebt in ihren klar umrissenen Konturen.
„Galigai“ ist die Geschichte einer Leidenschaft. Eine Amazone, die als Gouvernante in einer Familie angestellt ist, unterwirft nicht allein die Familie, sondern auch Personen anderer Familien ihrem Herrscherwillen. Schließlich — und dies ist die Keimzelle aller ihrer Handlungen — zwingt sie dem viel jüngeren Helden des Buches, Nicolas, die Gewalt ihrer Liebe auf. Wie sich dieser nun von dem Netz, das rasch und zielsicher über ihn geworfen wird? endlich befreit — es geschieht in einem atemberaubenden Dialog —, darf als die Höhe des Buches, aber auch von Mauriacs Darstellungskunst, angesehen werden. Nicolas' Existenzwille siegt. Der Leser nimmt teil an diesem Leben, aber auch an der Art, wie Mauriac „Atmosphäre“ vermittelt. Nur der „geborene“ Romancier, wie er sich selber nennt, konnte die intensive Lebensnähe einzelner Stellen, aber auch den vollkommen ineinander gefügten Organismus eine solchen Werkes gestalten.
Mit dieser Anerkennung ohne Vorbehalt wäre der Eindruck umschrieben, den der Roman auf die Mehrzahl der Leser machen dürfte. Nun hat aber Mauriac seiner Erzählung eine Nachschrift folgen lassen, die den Sachverhalt wesentlich kompliziert. Das Buch wird dadurch nämlich zu einem neuen Beitrag zur Diskussion, die in sämtlichen Kulturländern vor sich geht: über die Frage der christlichen Literatur und Kunst von heute.
Der Dichter gibt bekannt, daß er nicht ohne Unruhe das Buch dem Druck übergeben hat. Er fürchte den Vorwurf, daß er mit dieser „Geschichte einer Leidenschaft“ eigentlich etwas im christlichen Sinne Unnützes geschrieben habe, weil er darin nicht das Wirken der göttlichen Gnade darstelle. Mauriac ist ja bewußter Katholik, und daraus könnte, so meint er, für sein Schaffen die Verpflichtung zur entsprechenden Tendenz abgeleitet werden.
Im Lauf der Nachschrift versucht Mauriac freilich dem Leser klarzumachen, daß die Meinung des Moraltheologen und die seinige über das Wesen der Romankunst nicht gut zur Deckung gebracht werden können, weil beide unter „Dienst“ etwas entschieden anderes verstehen. Meint der erstere die apostolische Aufgabe damit, so der Dichter seine eigene, der Logik des Lebens folgende Gestaltung. Die Formulierung wäre, als die spezifische Stellungnahme des Dichters und Künstlers, die sie ist, einleuchtend, wenn sich nicht aus der Nachschrift zugleich ergäbe, daß Mauriac offenbar zwei Befürchtungen hegt, die er miteinander vermischt. Einerseits dürfte er die Empfindung eines Ungenügens haben, daß er „Galigai“ doch zuwenig mit Motiven ausgestattet hat, die den Roman als das Werk eines katholischen Verfassers ausweisen ließen. Anderseits sucht er sich von diesem Zweifel durch die Polemik gegen die Moraltheologen zu entlasten, deren Tendenzforderung er als der „geborene Romancier“ niemals anerkennen kann.
In der*Tat könnte der Roman auch von einem profanen Dichter geschrieben sein. Ein Wirken der Gnade und eines daraus sich -ergebenden Impulses zum christlichen Leben lassen sich aus „Galigai“ kaum ableiten. Mauriac kommt zwar dem in diesem Sinn etwa zweifelnden Leser zuvor und macht ihn in der genannten Nachschrift darauf aufmerksam, daß die Gnade sehr wohl in seinem Buch eintrete, und zwar auf der letzten \ Seite, ja erst mit dem letzten Satz des letzten Abschnittes. Aber der unvoreingenommene Leser kann, sosehr er es selber wünschte, diese Gnade nicht als etwas Lebendiges erleben — zumindest nicht in dem Maß, daß er sie als ein den Vorgängen dieser Erzählung, an denen er teilgenommen hat, vollwertiges Gleichgewicht ansehen könnte.
Es handelt sich um den Helden Nicolas, der sich, wie erwähnt, von der Macht der Amazone Galigai befreit hat und nun zum erstenmal sich selber in einem neu errungenen Freiheitsgefühl empfindet. Es drängt ihn, das Haus zu verlassen, und so verlangt er von der Mutter, die ihn zu unterdrücken pflegt, die Schlüssel zum Haustor, weil er noch eine Promenade zu machen gedenkt. Auch dieses Recht muß er erkämpfen, aber widerwillig wird es ihm doch gewährt. Nicolas ist seit dem für ihn siegreich verlaufenen Dialog mit Galigai mündig geworden, zum Manne gereift. Da geht er denn auf der Landstraße — und die von Mauriac als entscheidend für das Eintreten der Gnade angegebene letzte Zeile lautet: „Fremd sich selbst, losgelöst von allem Lebenden setzte er sich auf das Brückengeländer, und dort saß er weiter, wie wenn er mit jemandem eine Begegnung vereinbart hätte.“
Dieser Schluß ist poetisch — gerade in seinem geheimnisvollen Bezug. Warum bleibt Nicolas so lange sitzen, „wie wenn er mit jemandem eine Begegnung vereinbart hätte“? Man kann — ohne die Nachschrift gelesen zu haben — die Frage doch kaum entscheiden und begnügt sich mit dieser viele Möglichkeiten einräumenden Andeutung. Francois Mauriac klärt uns darüber auf, daß mit diesem „jemand“ Gott gemeint sei, daß er damit das Eintreten der Gnade in seinem Roman symbolisieren und rechtfertigen wollte.
Wir dürfen es dem Meister der Erzählungskunst, der Mauriac ist, danken, daß sein katholisches Gewissen ständig bei seiner literarischen Arbeit wachsam bleibt. Denn allein dies bedeutet, daß die Geschichte einer Leidenschaft doch nicht einfach im profanen Sinn dargestellt wurde, wie dies schon so oft in Frankreich geschehen ist, sondern mit der Nuanciertheit des Seelenkenners, der von der Uebernatur weiß, wenn er sie auch in einem keuschen Sinn verschweigt. Daß aber das Motiv der Gnade mit dem letzten Satz überzeugungsvoll in den Roman eintritt und dem gesamten langen Verlauf dieses Romans wirkungsvoll das Gleichgewicht hält, würde kaum ein Leser von selber empfinden. Erst durch den Hinweis der Nachschrift wird er darauf gelenkt. Dies aber ist eher ein Eingriff von Seiten des Verfassers, der einer „Tendenz“ gleichkommt. Und es bleibt zweifelhaft, ob Mauriac selber einem solchen deus ex machina zustimmen würde, wenn er sich in die Lage des nachdenklichen Lesers versetzt fühlte. Dr. Robert Braun, Upsala
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!