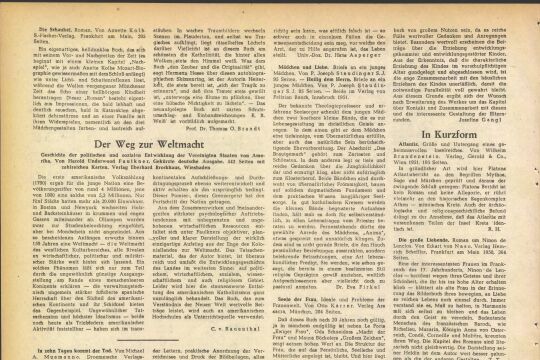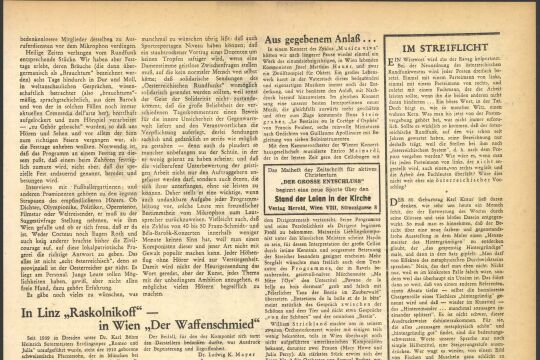Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bekenntnis zur Mutterliebe
Eine österreichische Filmproduktion ist seit Jahren praktisch zum Stillstand ekommen. Man muß dies aber nicht unbedingt bedauern, wenn man bedenkt, wie sie in den letzten 20 Jahren ausgesehen hat. Ob es — wie dies zur Zeit der Kinohochblüte geschah — noch etwa 30 Filme waren, die jährlich aus unseren Ateliers hervorgingen, oder wie später ungefähr fünf, es gab doch zumeist nur billigste Kommerzunterhaltung, von der manches obendrein — man denke nur an die unseligen Stadthia'llen-Filme — das Budget der Gemeinde Wien mit einer neunstelligen Summe belastete.
Aus der früher üppigen, später spärlichen Spreu bat sich ein Weizen abgesondert, der einige beachtliche Halme zum Reifen brachte. Die Projektförderung des Unterrichtsministeriums hat einige Millionen nicht schlecht angelegt. Was tut's, wenn das Fernsehen als Mitproduzent und daher Mitfinanzier auftritt, wenn man wenigstens Filme vorzuweisen hat, deren man sich auch im Ausland nicht zu schämen braucht — auch wenn sie nicht gerade Preise als Lorbeeren heimbringen? Nur wunde man sich als Österreicher wünschen, daß sie auch in unseren Kinos mehr zu sehen wären.
Nach Axel Cortis „Totstellen“ und dem „Jesus von Ottakring“ von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, der kürzlich beim Filmfestival von Locarno positiv auffiel, hat nun der durch seine Fernseharbeiten schon hinreichend legitimierte Jörg A. Eggers mit „Ich will leben“ einen Film geschaffen, der schon vom Titel her aufhorchen läßt und durch seine Thematik den Beschauer einfach engagieren muß. Es geht hier um das Schicksal eines gehirngeschädigten Kindes und damit um die Frage des körperlich und geistig behinderten Menschen überhaupt, der als Außenseiter am Rande der Gesellschaft steht.
Als Exempel dient die Geschichte eines etwa zehnjährigen Buben aus gutem Hause (Vater Universitätsprofessor, Mutter ehemalige Schauspielerin), der nach einem Autounfall eine schwere Schädel-Gehirn-Operation zwar übersteht, aber von nun an an den Rollst.uhl gefesselt, der Sprache nicht mehr mächtig ist und nur noch „mit den Augen lebt“. Der Vater als Neurologe ist sich der Schwere des Falles voll bewußt, beginnt zu resignieren und sich seiner Frau zu entfremden, die all ihre Energie einsetzt, um ihrem Kind mit medizinischen und psychologischen Mitteln zu 'helfen. Unbeirrt von allen familiären Konflikten und den guten Ratschlägen einer inhumanen Umwelt, die darauf hinweist, daß es für solche Fälle ja Heime gibt, steht die Mutter aufopfernd zu ihrem Kind, weil sie weiß, daß keine öffentliche Fürsorge ihre Liebe und Hingebung ersetzen kann.
Das klingt vielleicht zu edel und lesebuchhaft, wobei auch der Umstand, daß die Geschichte in einer sozial gehobenen Schichte, in einer finanziell gesicherten Umwelt spielt, die Glaubwürdigkeit erschwert. Man fragt sich unwillkürlich, wie die Sache aussähe, wenn das Schicksal eine Arbeiter- oder B'auernfamilie träfe. Aber das Verdienst, ein heikles, unpopuläres Thema in künstlerisch sauberer Weise gestaltet zu haben, gibt wöhl den Ausschlag zugunsten von Eggers Arbeit.
Positiv ist schließlich die gute Ensembleleistung hervorzuheben, wobei einige bekannte Bühnen-sohauspieler vorwiegend in Nebenrollen agieren, neben denen Heinz Bennet als Vater und vor allem Kathina Kaiser als Mutter mit sparsamen Mitteln eine wohldifferenzierte Darstellung zeigen. Der er-schütternste Eindruck geht alber von einem gehirngeschädigten Buben aus, der sein bitteres eigenes Schicksal vor der Kamera präsentieren muß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!