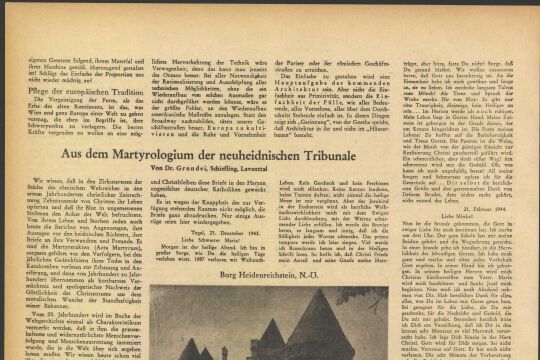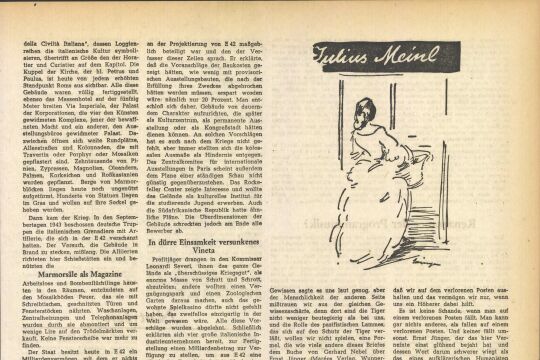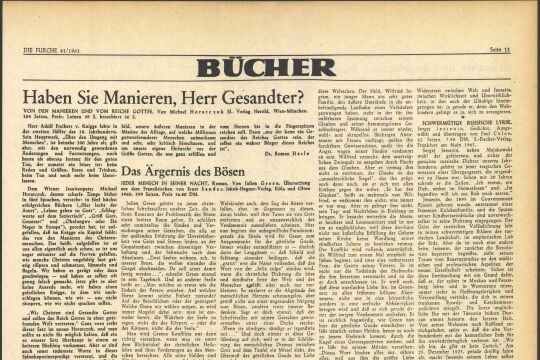Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Man muß die Menschen lieben...“
In den hier vorliegenden, von Frauen geschriebenen Romanen fällt sogleich eine ihnen gemeinsame, sehr weibliche Perspektive auf. Obwohl die Handlung in jedem Fall um trostlose Zeitschicksale kreist, obwohl„ die-Bedrohung-des-Individuums von außen und innen: durch übermächtige Organisationen, durch Kontaktlosigkeit und seelische Verarmung, nicht übersehen und auch nicht banalisiert wird, kommen doch die Möglichkeiten des Einzelmenschen ins Blickfeld, wenigstens in seinem persönlichen Umkreis die Dinge zum Guten zu wandeln. Durch Liebe und Geduld, durch Erkenntnis der Schuld und den Willen zur Buße, durch Tapferkeit und Bewährung. Lauter Dinge — auch darin sind die Verfasserinnen einer Meinung —, die nie verloren sind, die schließlich und endlich, wenn auch nicht immer sichtbar, ins Weite zu wirken vermögen und eine neue, gültige Ordnung aufbauen helfen. Eine positive und versöhnliche Weltsicht also, die um so schwerer wiegt, als sie nicht aus Unkenntnis und Verharmlosung unserer Lage erwächst, sondern an die Kräfte des Herzens appelliert und an ihre heilende Wirkung glaubt.
Pearl Buck erzählt die Geschichte zweier in Korea aufgewachsener junger Mädchen, Töchter eines Missionsehepaares, die durch den Krieg in ihrer Heimat in das Haus ihrer New-Yorker Verwandten verschlagen werden. Sie kommen in eine durch materiellen Ueberfluß, Egoismus, Teilnahmslosigkeit, Einsamkeit und Ueberdruß verdorbene, ihnen völlig fremde Welt. Die Mädchen, in ihrer unmittelbaren und ursprünglichen Art, spüren sofort, was hier los ist und woran es fehlt.
„Hier liegt an niemandem etwas, drüben an jedem ... dort ist Liebe. . . wie die Luft, wie die Sonne, wie der Regen, so ist dort Liebe . . . Hier verbirgt jeder seine Meinung in sich, hier denkt jeder zuerst für sich. Die Amerikaner sind sehr freundlich . . . Sie lächeln, sie geben einem rasch ein Geschenk oder Geld, aber sie kümmern sich nicht darum, wie dem andern zumute ist. . . Ich zweifle, daß man hier überhaupt liebt. . . hier tut man nichts, ohne einen Nutzen davon zu haben.“
Solche Erfahrungen tauschen die Schwestern miteinander aus Aber sie kritteln und nörgeln nicht, sie tun etwas viel Besseres, indem sie einfach ihre Zuneigung und ihren guten Willen an die Menschen verschwenden, unter denen sie jetzt leben, vom Herrn und der Dame des Hauses angefangen, bis zum kleinen Dienstmädchen und Gärtner. Allein durch ihre bezwingende Existenz bewirken sie allmählich einen Wandel in den mitmenschlichen Beziehungen auch der anderen. Nicht alle freilich vermögen den Schritt aus dem Ich heraus zum Du zu vollziehen. Fearl Buck kennt das Leben und die Menschen zu gut, ist zu klug und zu wahrhaftig, um ein allseitiges, banales Happy-End anzubieten. Aber sie weiß eines: „Das Herz kann keinem allein gehören und auch niemandem, den er liebt. Man muß die Menschen lieben . . “ Sie moralisiert nicht über diese Erkenntnis, sie gibt ihr Leben in ihren Gestalten und überzeugt durch ihre Güte, ihren Humor und nicht zuletzt durch ihren Charme.
Hier offenbart sich wieder einmal souverän die
Fähigkeit der großen Geister Amerikas zu hellsichtiger Zeit- und Gesellschaftskritik, die nicht im Negativen steckenbleibt, sondern' an die Quellen führt, die Heilung gewähren. r .K}nBtr)p }ni;trbrJI %fb?. s saaiwas srns nr
Gerda Hagenau, eine aus Lodz stammende Deutsche, die heute in Oesterreich lebt, kennt aus eigener Erfahrung die nationale Problematik Polens und ihre vielfältigen Auswirkungen in menschlicher, in geistiger und politischer Hinsicht. Bewegt von dem Gedicht des polnischen Lyrikers Stanislaw Jerzy Lee über das tragische Schicksal der jungen polnischen Partisanin Lucyna Herz, hat sie das uns hier vorliegende Buch geschrieben.
Lucyna ist Halbjüdin; ihre Mutter stammt aus einer alten, traditionsbewußten, sehr patriotischen polnischen Familie. Ihr Vater, ein bekannter Rechtsanwalt, ist der Sohn eines armen russischen Juden, der nach einem Pogrom, bei dem seine Frau umkommt, nach Warschau geht und es dort langsam und zäh zu Wohlstand bringt. Lucyna weiß in ihrem kultivierten Elternhaus nichts mehr von den dunklen Schicksalen der väterlichen Familie; ihre Welt ist hell und unbeschwert; die Verlobung mit einem jungen Architekten krönt diese glückliche Jugend, der der zweite Weltkrieg dann jäh ein Ende bereitet. Lucyna ist zum Musikstudium in Paris, als die deutschen Truppen in Warschau einmarschieren, und wird nach England verschlagen, als die nationalsozialistische Bedrohung auch Frankreich erreicht. Nun geht es Schlag auf Schlag: sie erfährt, daß ihr Vater in Treblinka vergast wurde, und weiß ihre Mutter in Gefahr. Der einzige Weg, der sie nach Polen zurückbringen kann, ist der Eintritt in die russische Partisanengruppe, in deren Reihen sie, nach langen Umwegen, endlich in der Heimat kämpfen darf. Nachdem auch ihre Mutter als polnische Widerstandskämpferin von den Deutschen standrechtlich erschossen wird und sie entdecken muß, daß ihr Verlobter „Volksdeutscher“ geworden ist und die fiühere Bindung zu ihr verleugnet, versinkt sie völlig in Haß und Rachegedanken und kämpft wie besessen gegen die deutschen Unterdrücker, die ja auch ihr eigenes Leben zugrunde gerichtet haben.
Erst ganz zuletzt, in ihrer Todesstunde, durch ein Erlebnis mit einer jungen Deutschen, wird, ihr klar, daß sie einen falschen Weg gegangen ist. „Mein Herz war immer zu heiß, so voller Leidenschaft und Liebe, und aus der Liebe wurde dann der Haß, und aus dem Haß der Tod “ Die Reue bringt sie auch wieder Gott nahe, und sie stirbt im Vertrauen auf Sein Erbarmen.
So klingt das Buch versöhnlich aus, denn auch die anderen an Lucynas Schicksal Beteiligten haben aus dem furchtbaren Geschehen, in das sie verstrickt wurden, gelernt, daß genug gehaßt, gekämpft und zerstört worden ist, daß es nun gilt, auf neuen Grundlagen aufzubauen.....Ex corde lux“, so formuliert es Lucynas Verlobter.
.
Hildegard P1 i v i e r erzählt in ihrem ersten Roman die von politischen Ereignissen tragisch beschattete Geschickte einer Wolgadeutschen Lehrerin und ihres russischen Mannes. Anatol, obwohl Parteimitglied, wird eines Tages verhaftet und verschwindet ins Ungewisse. Nichts ist über sein Schicksal zu erfahren, nichts über die Gründe seiner Verhaftung. Schreckliche Jahre des Wartens beginnen für Lisa, bis endlich, als sie gerade, vom Tod ihres Mannes überzeugt, eine andere Bindung eingehen will, eine Nachricht aus Sibirien kommt, daß sie ihrem Gatten dorthin folgen dürfe. So sehr sie sich jenem Mann verbunden fühlt, der die Jahre der Ungewißheit und Leere mit ihr getragen und sie ihr erleichtert hat, zaudert sie doch keinen Augenblick, zu dem unglücklichen Anatol zu gehen und dessen schweres Los durch ihr Dasein für ihn zu erleichtern. Den beiden sind noch einige gemeinsame Jahre, reich an äußeren Entbehrungen, aber voll innerer Zufriedenheit, beschert, so daß sie sogar beschließen, auch nach Anatols Freilassung in Sibirien zu bleiben. „Wir haben uns hier eingelebt, Sibirien hat uns gefangen, wie schon so viele vor uns. Hier haben wir Freunde, dort sind wir allein .. .“ Aber ihre Rechnung soll nicht aufgehen. Ein tödlicher Arbeitsunfall Anatols läßt Lisa allein zurück, die nun, wieder ins Ungewisse, wieder ins Leere, nach Rußland geht.
Das Schönste an diesem Buch ist, wie hier in aller Unmenschlichkeit des Systems doch der Mensch triumphiert. Gewiß gibt es genug Bestien in Menschengestalt, die Roboter der politischen Maschinerie, aber deren unseliges Wirken scheint erst recht die Kräfte des Leidens, des Duldens, der gegenseitigen Anteilnahme und Hilfsbereitschaft in ihren Opfern und Gegenspielern zu aktivieren. — Hildegard Plivier hat schon in ihrem Buch „Meine Hunde und ich“ gezeigt, wie gut sie die russischen Menschen kennt, unter denen sie elf Jahre lebte. Man muß ihr dankbar sein, daß sie uns auch hier wieder Einblick gewährt in eine Seite des heutigen Rußlands, zu der wir nur selten Zugang gewinnen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!