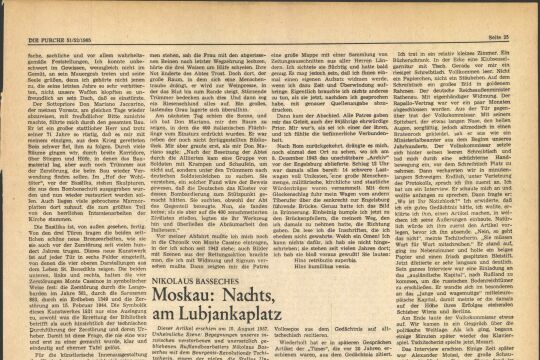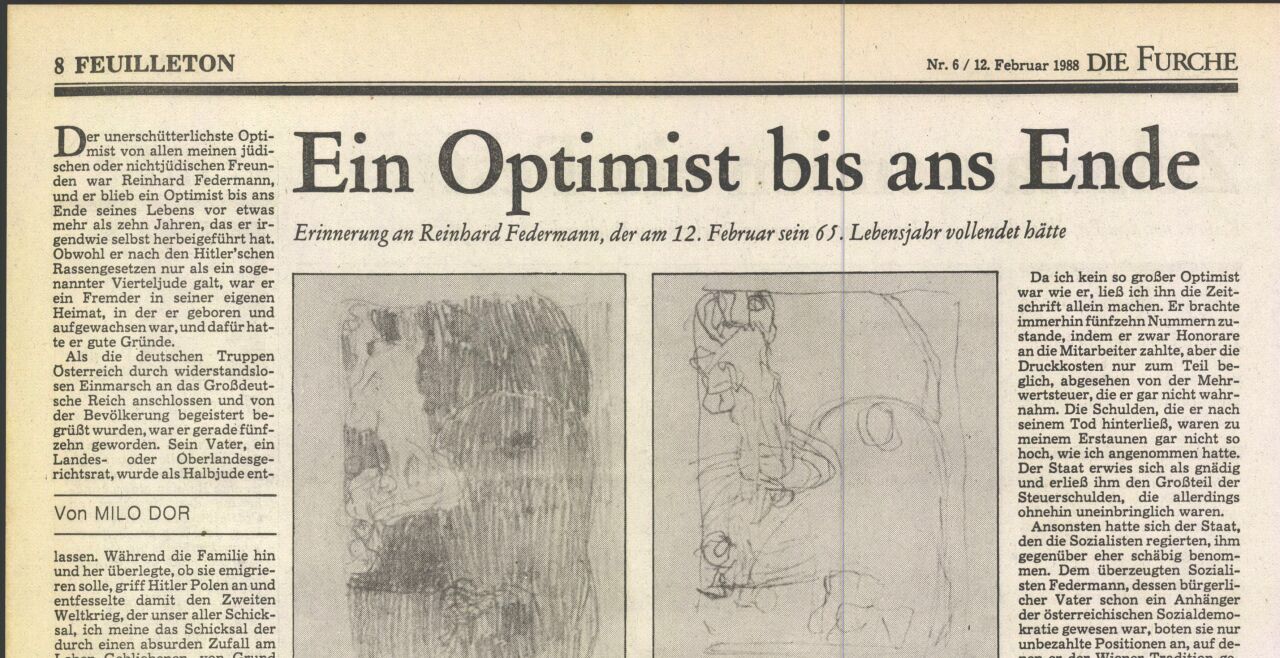
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Optimist bis ans Ende
Der unerschütterlichste Optimist von allen meinen jüdischen oder nichtjüdischen Freunden war Reinhard Federmann, und er blieb ein Optimist bis ans Ende seines Lebens vor etwas mehr als zehn Jahren, das er irgendwie selbst herbeigeführt hat. Obwohl er nach den Hitler'schen Rassengesetzen nur als ein sogenannter Vierteljude galt, war er ein Fremder in seiner eigenen Heimat, in der er geboren und aufgewachsen war, und dafür hatte er gute Gründe.
Als die deutschen Truppen Österreich durch widerstandslosen Einmarsch an das Großdeutsche Reich anschlössen und von der Bevölkerung begeistert begrüßt wurden, war er gerade fünfzehn geworden. Sein Vater, ein Landes- oder Öberlandesge-richtsrat, wurde als Halbjude entlassen. Während die Famüie hin und her überlegte, ob sie emigrieren solle, griff Hitler Polen an und entfesselte damit den Zweiten Weltkrieg, der unser aller Schicksal, ich meine das Schicksal der durch einen absurden Zufall am Leben Gebliebenen, von Grund auf veränderte.
Reinhard Federmann wurde bald nach der Matura genauso wie sein älterer Bruder in die deutsche Wehrmachtsuniform gesteckt und nach kurzer Ausbü-dung als Funker an die Ostfront geschickt, die der große Stratege Hitler nach den vergeblichen Versuchen, England in die Knie zu zwingen, eröffnet hatte. Was macht ein Mensch, der plötzlich vor der Tatsache steht, daß er an einem Raubzug teilnimmt, den ihm verhaßte Menschen begonnen haben? Er trachtet, am Leben zu bleiben, und das führt manchmal zu seltsamen Situationen.nenden Titel „Weltbürger im Niemandsland“ trug, fand keinen Verleger. Lediglich Otto Basil druckte in seiner Zeitschrift .Plan“ einen Auszug daraus ab, der im Verlag Erwin Müller erschien, bei dem Reinhard als Volontär tätig war.
Die „Chronik einer Nacht“„ Reinhards zweiter Roman, der im Vergleich zu seinem Erstling schon professionell geschrieben war, fand auch keinen Verleger, weil er in ihm das Schicksal eines heimgekehrten Juden in das Wien der vier Besatzungsmächte und dessen Begegnung mit seiner einstigen Geliebten schüderte.
Das Manuskript wurde nur in der .Arbeiter-Zeitung“ als Fortsetzungsroman abgedruckt, auf Vermittlung unseres Freundes Peter Strasser, der selbst jüdisch versippt und aus der Emigration heimgekehrt war.
Sein dritter Roman, „Das Himmelreich der Lügner“, versuchte, durch die Schüderung der Schicksale verschiedener Menschen die Geschichte seiner Heimat seit dem Bürgerkrieg des Jahres 1934 bis Ende der fünfziger Jahre zu erzählen, die Geschiente der Schmach und der Niederlage eines Volkes, das seit dem selbst verursachten Untergang der Monarchie nicht mehr imstande gewesen war, sich zurechtzufinden und einen eigenen Weg einzuschlagen. Es steht mir nicht zu als Freund, über die Qualitäten dieses Buches zu sprechen, aber darin gibt es ergreifende Passagen und erbarmungslose Aussagen über die jüngste Vergangenheit der Österreicher, die sie mit alle Kräften zu verdrängen trachteten, weil sie sie an ihre eigenen Schwächen, Unterlassungen und Dummheiten erinnerte, so daß sie diesen ganzen Zeit- und Lebensabschnitt am liebsten vollständig aus ihrem Gedächtnis gestrichen hätten.
So war es kein Wunder, daß nicht ein österreichischer Verlag sich bereitfand, dieses Buch zu drucken. Es erschien, dank Reinhards Auftritten bei der Gruppe 47, in einem deutschen Verlag,doch die Deutschen waren vollauf damit beschäftigt, ihre eigene Vergangenheit für die neuen Verhältnisse zu frisieren, so daß Reinhards Buch, abgesehen von ein paar respektvollen Besprechungen, so gut wie unbemerkt blieb.
Wir setzten uns in den siebziger Jahren wieder zusammen und begannen in dieser Zeit eines neuen Aufbruchs eine neue Zeitschrift zu planen, die nach mehreren Gesprächen, ich glaube, es war mein Einfall, aber da war ich bei unserer Art Zwiesprache nie sicher, die .Pestsäule“ heißen sollte. Bei der Kalkulation, die Reinhard nach Rückfrage bei Druckereien erarbeitet hatte, ergab sich ein beträchtliches Defizit. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, lachte er nur und sagte, das sei bei einer kulturpolitischen oder Uterarischen Zeitschrift ganz normal. Wir würden die Verluste durch Subventionen und Zuwendungen verschiedener Art schon hereinbringen.
Da ich kein so großer Optimist war wie er, ließ ich ihn die Zeitschrift allein machen. Er brachte immerhin fünfzehn Nummern zustande, indem er zwar Honorare an die Mitarbeiter zahlte, aber die Druckkosten nur zum Teil beglich, abgesehen von der Mehrwertsteuer, die er gar nicht wahrnahm. Die Schulden, die er nach seinem Tod hinterließ, waren zu meinem Erstaunen gar nicht so hoch, wie ich angenommen hatte. Der Staat erwies sich als gnädig und erließ ihm den Großteil der Steuerschulden, die allerdings ohnehin uneinbringlich waren.
Ansonsten hatte sich der Staat, den die Sozialisten regierten, ihm gegenüber eher schäbig benommen. Dem überzeugten Sozialisten Federmann, dessen bürgerlicher Vater schon ein Anhänger der österreichischen Sozialdemokratie gewesen war, boten sie nur unbezahlte Positionen an, auf denen er der Wiener Tradition gemäß für sie eifrig arbeiten durfte, aber dafür nichts außer einer fragwürdigen Anerkennung erhielt.
So werkte er als Sprecher der Schriftsteller und Künstler in der Hörer- und Sehervertretung beim österreichischen Rundfunk und Fernsehen und als Generalsekretär des Osterreichischen PEN-Clubs und focht leidenschaftlich für eine Sache, die er für richtig hielt. Er organisierte auch im Herbst 1975 den Internationalen PEN-Kongreß in Wien, der dem Ansehen seines Landes und seiner Stadt zugute kommen sollte. Das war seine letzte Tat, denn bald darauf starb er.
Ich bin der Letzte, der jemanden, der trinkt, verurteilen könnte, weil ich selbst gern trinke, aber was Reinhard betraf, mit dem ich im Verlauf unserer langjährigen Freundschaft und Zusammenarbeit immer wieder und ziemlich viel getrunken hatte, so war es mir geradezu unangenehm, zuzusehen, wie er trank, obwohl er schon schwer krank war und überhaupt nichts mehr vertrug. Er hatte Wein oder Schnaps, so dünn, schmächtig und nicht ganz gesund wie er war, eigentlich nie vertragen; aber er trank trotzdem, um zu verdrängen oder zu vergessen, daß er von Anfang an in einem fremden Land und unter fremden Menschen lebte, mit denen er trotz allem guten Willen von seiner Seite nie ganz einverstanden sein konnte.
Auszug aus dem Vorwort zum Roman „Chronik einer Nacht“ von Reinhard Federmann, der demnächst im Picus-Verlag erscheint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!