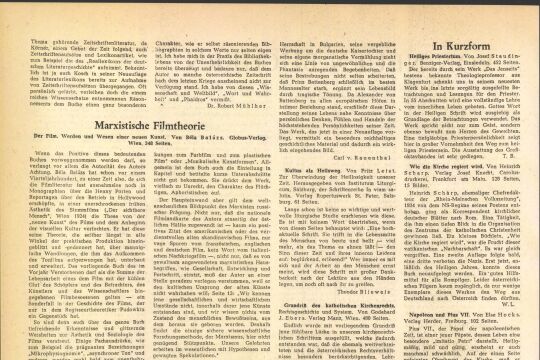Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Es darf wieder erzählt werden
Die Moden kommen und gehen — was bleibt, ist die Kalkulation. Ist es tatsächlich erst wenige Jahre her, daß sämtliche Buchmessenstände mit sozialistischer und revolutionärer Literatur, freilich meist sekundärer und tertiärer Art, vollgestopft waren? Fast; nichts ist davon geblieben. Auf dem langen Marsch durch die Institutionen haben selbige die Revolutionäre verschlungen, wer als Ergebnis der Ereignisse von 1967 und 1968 etwas mehr kritisches Bewußtsein in etwas mehr Gehirnen erhoffte, kann nur resignieren.
Die Moden kommen und gehen nicht nur in den Programmen der renommierten Verlage, sondern auch in der Subkultur, wo der Guru-Blick den Agitatoren-Blick langsam verdrängt. Pseudo-Buddhisten und Pseudo-Jogis stehlen immer öfter den Pseudo-Revolutionären die Show.
In den Regalen, in denen noch vor
wnigen Jahren bürgerliche Verleger revolutionäre Theorie anboten, die dann einen durchaus nicht unbedeutenden Beitrag zur Verhinderung praktischer Änderungen leistete, stehen heute neue Modeprodukte. Noch trägt man auch die Farbe des vergangenen Herbstes, nämlich die der falschen Mystik. Dänlken verzeichnet neue internationale Absatzerfolge, die sein Verleger ebensowenig erklären kann wie Soziologen und Psychologen. Dänlken (und was sonst auf verwandten „Psi-“ und ähnlichen Wellen reitet) ist freilich die extremste Antithese des vergangenen Trends, ein Maximum an Irrationalität nach einem für die Mägen der meisten offenbar unbekömmlichen Maß an Rationalität, die ja auch bald in linke Mystik umschlug.
Die Farbe des Herbstes 1973 ist Schwarzbraun wie die Haselnuß (im bekannten Soldatenlied). Der unsichtbare Star dieser Buchmesse hieß Hitler, die bevorzugte Einbandfarbe war an Stelle des eigentlich angebrachten Braun das in diesem Zusammenhang natürlich taktvollere Schwarz.
Joachim Fest, mit seiner 1200-Sed-ten- und 38-DM-Schwarte „Hitler“ (Propyläen-Verlag) der unbestrittene Trendleader der Saison, hatte die bei weitem glanzvollste Buchpremiere. Selbst Augstein, der Fest im
„Spiegel“ mit einem Halbverriß (die Schilderung des jungen Hitlers beurteilte er gnädig) gefördert hatte, beehrte den Autor und plauderte nek-kisch inmitten der Prominenz. Der Massenerfolg einer wissenschaftlich-historischen Arbeit (Fest hat längst den neuen Simmel überrundet) dürfte darauf beruhen, daß hier die große Mystifizierung und Napoleonisie-rung Hitlers auf steng wissenschaftlicher und somit unverfänglicher Basis eingeleitet wurde. Vereinfachend zusammengefaßt: Das deutsche Böse war von Hitler, das Böse in Hitler war das Dämonische in ihm, der Rest ein interessanter Mensch. Hitler als Produkt rational durchdringbarer Kräfte tritt in den Hintergrund.
Ungezählte Bücher zum Thema Hitler in ungezählten Ständen. Auf allen Niveaus, von der knapp kaschierten Apologie bis zu dem Buch „Geheimflug nach England“ von James Douglas-Hamilton, dem Sohn
jenes Herzogs von Hamilton, dessen Landsitz das Ziel des Heß-Fluges nach England war (besonders lesenswert: die Passagen über Haushof er, Vater und Sohn) und bis zu der verdienstvollen Neuherausgabe der „Gespräche mit Hitler“ von Rausch-ning (im Europa-Verlag), eine der wichtigsten Primärquellen über Hitler.
In der „Report“-Reihe desselben Verlages (Europa) erschienen brillante Analysen der Politik in der malaiischen Region (Peter Rindl: „Malaienreport“) und des kubanischen Weges zum Sozialismus (Gunnar Adler-Karlsson: „Kubareport“). Eine Ergänzung jeglicher Litertur, die sich mit den Problemen von Entwicklungsländern im Einflußbereich hochentwickelter kapitalistischer Staaten befaßt, bildet Anthony Sampsons „Weltmacht ITT“ (Rowohlt). Die Großmachtpolitik der ITT, die ihre wirtschaftliche Macht rücksichtslos einsetzt, ist atypisch im Ausmaß — und atypisch in ihrer Ungeschicklichkeit auf dem Gebiet der Geheimhaltung.
Robert Jungk schrieb — nach sieben Jahren — wieder ein (bemerkenswertes) Buch: „Der Jahrtausendmensch“ (bei Bertelsmann). Jahrhundert- und noch mehr Jahrtausendwenden werden mit Bedeutung quasi — magisch aufgeladen,
seit die Menschen Jahre zählen. Trotzdem ist es kaum noch möglich, die (wieder einmal?) endzeitlich anmutenden Tendenzen unserer Zeit ziu ignorieren, die auf einen Kulminationspunkt in näherer Zukunft hinstreben. Jungk isoliert die einzelnen Tendenzen, arbeitet positive und negative heraus und gibt mehr einen Uberblick möglicher Programme als seinerseits ein Programm.
Eine zwischen Zukunftsangst und Zukunftseuphorie schwankende Gesellschaft, die immer mehr einen Spiegel in ihrer eigenen Vergangenheit sucht: Jahr für Jahr entdeckt und popularisiert der Econ-Verlag ein versunkenes Volk, und es ist keinesfalls abzusehen, wann es ihrer alle werden. Diesmal beschreibt Gerhard Herrn „Die Phönizier — Das Purpurreich der Antike“, und sein Unternehmen hat durchaus Meriten, es korrigiert nicht nur Legenden,
derreihung von Amouren abzutun, wie es geschehen ist, war ein Mißgriff, aber einer, der der Auflage guttat.
Romane brauchen neuerdings nicht mehr trocken und unverdaulich zu sein, um literarisch für voll genommen zu werden, man darf
wieder erzählen, man soll sogar so gut wie möglich erzählen. Handke war einer von jenen, die diese neue Tendenz früh erkannten. „Der neue Siegfried Lenz“ allerdings ist kaum zu kauen, so gespreizt stelzt „Das Vorbild“ (Hoffmann und Campe) einher, und man fühlt die Angst des Erzählers, beim unreflektierten Erzählen ertappt und deshalb gleich als Dichter disqualifiziert zu werden. Das Resultat ist eine Realitätsferne, die die gesellschaftskritische Hai-
tung des Buches zur Pose stempelt. Hingegen werden die „Mordverläufe“ von Manfred Franke (Luchterhand) wohl kein Bestseller werden — obwohl dieses Buch um vieles wichtiger (und auch besser geschrieben!) ist als Lenzens Abrechnung mit den Lehrern. Franke rekonstruiert im Jetzt und Hier die Ereignisse der Reichskristallnacht in einer kleinen deutschen Stadt, er schrieb eine dichterische Reportage mit Verwandtschaft zu Norman Mailers „Heeren in der Nacht“, freilich ohne Mailers Ich-Besessenheit, objektiver, trockener.
Peter Marginter („Königrufen“, Langen-Müller-Verlag) schrieb eine neue Geschichte — oder besser: eine neue Fortsetzung seiner Geschichte von den Geistern der Vergangenheit, ohne alles Gespenstische, mit einem Wort „skurril“, welches Verlegenheitsvokabel zwar das Genre trifft, nicht aber den Reiz dieser Erzählung, die sich dem Versuch einer Inhaltsangabe, und schon gar einer knappen, verschließt, worin vielleicht ein Haupthemmmis für den längst überfälligen Erfolg dieses Österreichers (sprich: seine Zur-kenntniisnahme durch mehr als
zwei- oder dreitausend Leute) zu sehen ist.
Als Außenseiter unter den Dichtern vom Dienst (er ist nämlich Verfasser von Büchern über bildende Kunst) schrieb Lothar-Günther Buchheim einen Roman, dem höchstens Pliviers „Stalingrad“ wird den Ruf streitig machen können, der deutsche Roman des Zweiten Weltkrieges zu sein. Was „Das Boot“ (Piper-Verlag) vor so vielen anderen erfolgreichen Nach-45-Kriegsbü-chern auszeichnet, von „08/15“ bis „Haie und kleine Fische“, sind sowohl literarische als auch moralische Qualitäten. Er ist Wahrscheinlich um genauso viel literarisch besser, wie er ehrlicher ist. Buchheim schrieb kein „sensationelles“ Kriegsbuch, ein U-Boot-Buch ohne Heldentaten, ohne Helden, ohne
menschliche Konflikte, in dem über lange Partien (und vor allem in einer langen Exposition, die einem knalleffektigen Auftakt folgt) eigentlich nichts passiert, ein Buch, das aber trotzdem, und trotz seiner 600 Seiten, äußerst spannend ist und dem man kaum zu glauben vermag, daß es wirklich erst ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende entstand. (Es wäre interessant, mehr über seine Genesis zu erfahren.)
sondern auch den vorherrschenden gräkozentrischen Blickwinkel.
Freunde gut geschriebener Biographien und Autobiographien werden (wie üblich) bestens bedient. Kaum zu glauben, daß einem so gründlich ausgeschlachteten Leben wie dem Napoleons neue Akzente abzugewinnen sind — Vincent Cronin, dem Sohn des Berühmten, gelang es auf Grund neuer, in den letzten Jahren erschlossener Dokumente (Cronin: „Napoleon.“ Econ-Verlag). Beaumarchais starb zwar 1799, trotzdem erfährt man aus der Beaumarchais-Biographie „Die tollen Tage“ von Bernard Fay (List-Verlag) mehr darüber, wie schön es vor der Revolution war, als darüber, was zu ihr führte.
Eine Autobiographie überragt alles, was es in dieser Saison in die-
sem Genre gab, sie ist eines der bemerkenswertesten Bücher der Messe: Arthur Rubinstein, „Erinnerungen. Die frühen Jahre.“ Hier stimmt die Definition einer Autobiographie als Büd einer Zeit, gesehen durch ein Temperament, und das Temperament Rubinsteins, des Drei-undneunzigjährigen, ist so ungeheuer, wie die Zeit, die er schildert, seine Zeit, interessant. Diese Autobiographie vor allem als Aneinan-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!