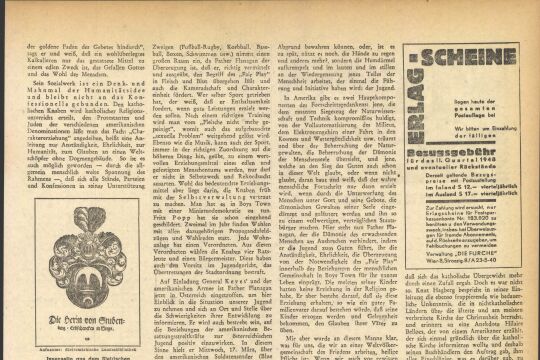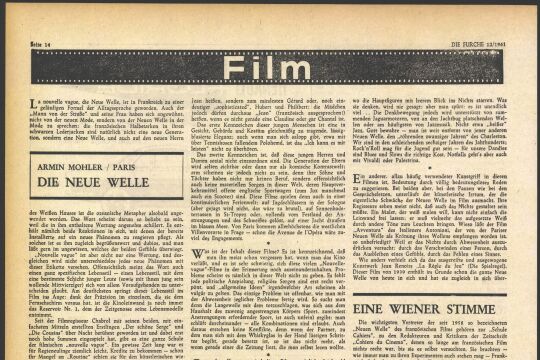Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
FILM
Die Franzosen verstanden sich schon immer sehr gut auf die Gestaltung erotischer Stoffe. In der Literatur seit Jahrhunderten, und von Fall zu Fall auch im Film. Obgleich auch Sie in den letzten Jahren der primitiven Pomowelle ihren Tribut zollten.
„Cousin, Cousine” deutet schon im Titel etwas von jenem beschwingten Spiel an, das sich hier innerhalb einer Großfamilie entwickelt. Bei der Hochzeit einer vitalen Dame von fünfzig lernen Marthe und Ludovic, die durch diese Verbindung Cousin und Cousine geworden sind, einander kennen. Aus verschiedenen Gründen finden beide in ihrer Ehe nicht die Erfüllung und kommen einander- zuerst auf rein menschlicher Basis und auch wieder bei Familienfesten - immer näher. Bis sie eines Tages auch den Schritt in die intime Beziehung wagen, sich, entgegen allen bürgerlichen Konventionen, offen zu ihrer Liaison bekennen und, ihre ehelichen Bindungen außer acht lassend, sich auf einen gemeinsamen Weg machen.
Eine solche Schlußwendung ist selbst in unserer in sittlichen Dingen so freizügig gewordenen Zeit nicht die Filmnorm. Als Louis Malle 1958 in seinem damals einen Festivalskandal entfachenden Film „Die Liebenden” das ehebrecherische Paar in ein Happy-End entließ, brach er damit ein Tabu. Sein junger Regiekollege Jean-Charles Ta- chella schockiert sicher nicht mehr im gleichen Ausmaß, aber er rüttelt mit seinem Film doch an der Institution der Ehe und Familie, speziell im traditionell bürgerlichen Milieu. Er tut es mit jenem graziösen Charme, der sich in Glücksfallen aus gallischem Esprit entwickelt und kann dadurch den Beschauer nicht nur unterhalten, sondern ihn auch in seinem psychischen und gesellschaftlichen Bereich betroffen machen. Die lebensecht gezeichneten Figuren und die ausgezeichneten Darsteller bieten dem Publikum sicher manche Identifikationsmöglichkeiten, und hierin liegt neben der Qualität des Films zugleich seine Bedenklichkeit.
Kaum eine Chance, sich dem Zuschauer in solcher’Art mitzuteilen, hat wohl der deutsche Streifen „Grete Mindė - der Wald ist voller Wölfe”. Obzwar auch hier ein junger Mensch die Konventionen seiner Zeit bricht. Nur liegen uns Schauplatz und Epoche recht fern, denn der Film spielt, einer Novelle Theodor Fontanes folgend, in Preußen zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Heidi Genėe, bisher Cutterin und Regieassistentin, hat zwar für ihre Erstlingsinszenierung einen deutschen Bundesfilmpreis bekommen, betont aber eher die melodramatischen Elemente der Erzählung und pfropft ihr manche gesellschaftskritischen Akzente auf. So verdient im Grunde nur die Kameraarbeit des Streifens einige positive Erwähnung. Wenn man sich daran erinnert, wie stil- und zeitgerecht Rainer Werner Fassbinder ein anderes Fontane-Werk, „Effi Briest”, auf die Leinwand transpo- , niert hat, fällt „Grete Mindė” noch mehr ab. Der Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden deutschen Filmen ist gewaltig.
Nun hat Großmaul Cassius Clay (pardon: Muhammad Ali) bereits sein filmisches Denkmal. Der regierende Schwergewichtsweltmeister spielt natürlich selbst die Hauptrolle in „Ich bin der Größte”, nur die Figur des jugendlichen Olympiasiegers von Rom ist einem anderen Schauspieler anvertraut. Da viele Kampfausschnitte aus Clays Karriere - bis zur Wiedererringung des Titels von George Foreman - eingeschnitten sind, erfahrt man im Grunde nicht mehr, als man aus Zeitungen und Fernsehen schon kennt. So bringen nur Clays Übertritt zum Islam und seine Wehrdienstverweigerung einige interessantere Momente ins Spiel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!