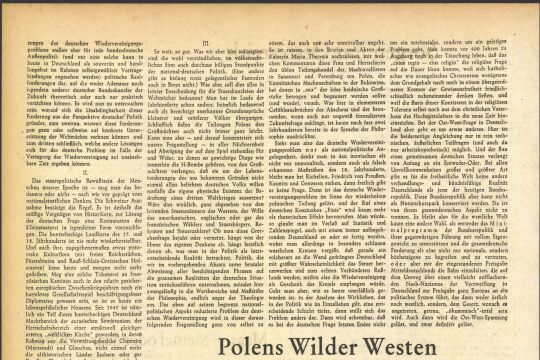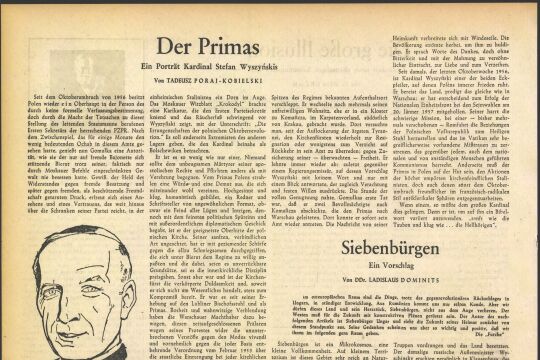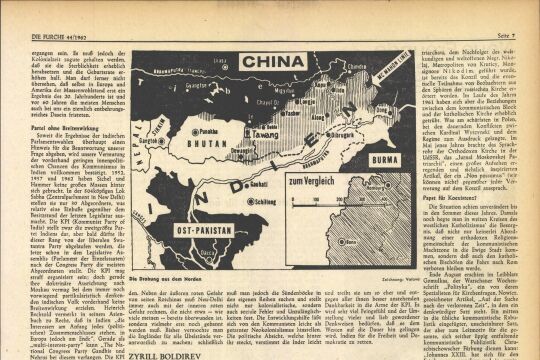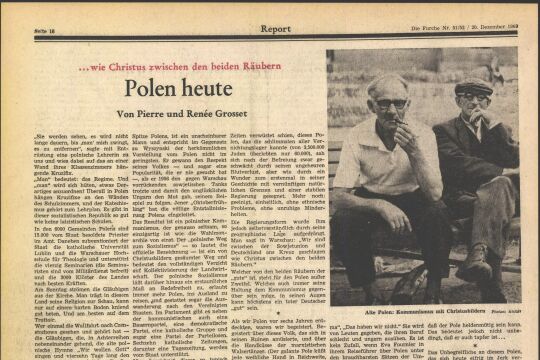Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Freiheit kostet
Der Papst hat sich in Polen auf dem schmalen Grat zwischen dem Ruf wider die Verzweiflung und der Ermutigung zum Ausbruch aus bitterer Wirklichkeit bewegt. War es die traumwandlerische Sicherheit des nationalen Propheten und Hohepriesters, der sein Volk doch noch trockenen Fußes ins Gelobte Land führen zu können glaubt? Oder war es der halsbrecherische Mut eines charismatischen Volkstribunen, der den Untergang der
Seinen in den Wellen des „Roten Meeres“ riskiert — wenn sie schon nicht weichen?
Dabei hat nationalreligiöse Romantik während dieses zweiten Heimatbesuchs Johannes Pauls II. so wenig gefehlt wie nüchterne, doch angesichts der „sehr schwierigen geopolitischen Lage“ (so der Papst) wenig aussichtsreiche Aufforderungen zum Dialog zwischen Regierung und Nation, Gesellschaft und Regime. Der Papst selber führte dieses Gespräch öffentlich und „privat“ mit Jaruzelski. Dabei war es bezeichnend genug, daß der römischey’Pontifex über die Lage der Kirche in Polen kein Wort zu verlieren brauchte, während der kommunistische Parteichef den „besonderen Platz“ dieser Kirche würdigte. Mit Worten, deren sprachliches Niveau von protokollarischen Phrasen weit entfernt war, versuchte der General seine Politik, auch den Militärstreich vom 13. Dezember 1981, vor dem Landsmann aus Rom zu rechtfertigen. Das hat es in der Geschichte kommunistischer Machtbehauptung noch nie gegeben.
Nach der Begegnung ließen beide, Papst und General, wissen, man habe sich viel besser als erwartet verstanden, ja gegenseitige Sympathie sei spürbar gewesen. Das lag wohl daran, daß zwei Polen einander gegenüberstanden, deren Realitätssinn auf verschiedene und doch auch ähnliche Weise getrübt ist von jenen Wunschvorstellungen, die in der nationalen Leidensgeschichte der Polen, in ihrem so schwer erfüllbaren Traum von wirklicher Unabhängigkeit wurzeln.
„Es gibt Zeiten, in denen man vieles opfern muß, um alles zu retten“, zitierte der General mit belegter Stimme den polnisch-amerikanischen Freiheitshelden Kos>- ciuszko. Er redete seinem Gast wie sich selber ein, daß der Reformkurs — die schon sagenhaft gewordene odnova, die gesellschaftliche Erneuerung — trotz allem „faktisch unumkehrbar“ sei. Die Hoffnung eben darauf predigte der Papst Tag für Tag, von Warschau bis Kattowitz, von Posen bis Breslau. Aber er knüpfte dabei ganz konkret an jene Volksbewegung an, von der ihm der General deutlich gesagt hatte, daß sie niemals wiederkehren könne: die Solidamošč.
Der Papst benützte das Wort zwar meist nur in kleinen Buchstaben, als zwischenmenschliche, christliche, nationale Solidarität. Doch das Wort flatterte auf Fahnen und Spruchbändern, wie ein Notsignal letzter Hoffnung, so oft über den frommen Millionen- Massen, die Johannes Paul II. zujubelten, daß der kirchliche Ordnungsdienst es nicht überall zum Verschwinden bringen konnte.
Anders als der General, aber nicht minder dialektisch, flüchtete sich der Papst in eine Rettungsund Opfermystik, die vor allem eine tief enttäuschte Jugend aus der Apathie reißen soll: Die Freiheit, um die Polen so oft gekämpft habe, sei besonders kostbar, weil der Preis, den es dabei zahlte, nicht so leicht wiege wie jener für die Freiheit von Franzosen, Deutschen und Amerikanern. „Wir wollen kein Polen, das nichts kostet“, tönte seine Stimme von den Wällen des Klosters in Tschensto- chau. Es war zu spüren, wie sich die Tragik einer bitteren Ge-
schichte in den Gemütern einer verlorenen Generation in politikfremde Heilsgewißheit verwandelte.
War es das, womit der Papst seine eigene politische Ohnmacht kompensieren und die gegenseitige Belagerung von Regime und Nation durchbrechen wollte? Nachdem die drei ersten Abende mit Massendemonstrationen geendet hatten, setzte er bei der großen Sonntagsmesse zur 600- Jahr-Feier der Schwarzen Madonna mäßigende Akzente. Den demonstrativen Beifall bremste er energisch ab, er tauschte den aus Rom mitgebrachten Text seines Abendappells gegen einen neuen aus, der die Gefühlsaufwallungen dämpfen sollte: „Haß ist eine zerstörerische Kraft; wir dürfen mit ihm weder zerstören noch uns selber zerstören lassen“, rief er und bat um die Hilfe der „Königin Polens“ auch für die „schwierige Aufgabe derer, die auf polnischer Erde die Macht ausüben“. \
Konnte er ihnen diese Aufgabe erleichtern, indem er in Kattowitz wieder unmißverständlich die Gewerkschaftsfrage anschnitt? Den begeisterten Bergleuten sagte er dort, alle Welt sei Zeuge dessen, was im Namen der „moralischen Ordnung der Arbeitswelt“ in Polen geschehen sei seit August 1980 („vor dem Dezember 1981“ stand in seinem Manuskript). Geschickt zitierte er aus seiner eige- x nen Sozial-Enzyklika den Schluß, der ihm auch den Beifall von Marxisten (wenn es in Polen noch solche gäbe) einbringen könnte: „Der arbeitende Mensch hat Vorrang vor dem Kapital“, er könne nicht mehr arbeiten, wenn der Sinn seiner Arbeit „irgendwie verdeckt“ wäre („weggenommen“, stand im vorbereiteten Text).
Derlei Korrekturen konnten die wachsende Nervosität in den Warschauer Amtsstuben nur wenig mindern. Zwar hatte Regierungssprecher Urban direkte Kritik am päpstlichen Gast vermieden, doch seiner Erklärung war zu entnehmen, was den Papst schon in Form einer diplomatischen Meinung auf dem Reiseweg erreicht hatte: Die Kreml-Führer blickten tief beunruhigt nach Polen. Urban mußte öffentlich beteuern, daß der Besucher aus Rom weder „die Ideale des Sozialismus“ noch die „Zusammenarbeit mit unseren sozialistischen Verbündeten“ beschädigen könne.
Aber der Besuch hätte auch aus der Sicht der katholischen Weltkirche problematischen Charakter annehmen können. Karol Woj tyla schien erst auf dieser Reise ganz zum polnischen Papst geworden zu sein. Das Eintauchen in die kranke Nation wirkte auf ihn wie ein Gesundbrunnen; erstmals seit dem Attentat lebte er physisch auf. Der Vatikan, ja die Welt schienen in weite Ferne gerückt, Polen die einzige Sorge. Doch dann wurde er wieder im wörtlichen Sinne zum Pontifex, zum Brückenbauer. In Breslau, im polnischen Wroclaw, gelang es ihm, beides, patriotisches Interesse und übernationale Mission, zu einer Versöhnungsgeste zu verbinden, die weit über Schlesien hinaus wirken könnte.
Zunächst bestätigte er, so wie es seine kirchlichen wie staatlichen Gastgeber erwartet hatten, daß die ehemals deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße „nach Jahrhunderten wieder Teil des polnischen Staates sind“. Das hatte er in den ersten Minuten nach der Landung in Warschau schon mit einem Hinweis auf die Neuordnung der west- und nordpolnischen Bistümer durch Paul VI. bekräftigt. Wer sich selber und anderen in Deutschland noch immer einredet, daß es nach 38 Jahren eine Chance gäbe, die Geschichte umzukehren, wird sich dadurch freilich nicht umstimmen lassen.
Aber vielleicht mag ihn wenigstens das Wort „Versöhnung“ beeindrucken, das dieser polnische Papst in deutscher Sprache über die Grenze rief. Das Vermächtnis
Boleslaw Komineks wurde lebendig: Der erste polnische Kardinal von Breslau hatte schon 1965, beargwöhnt in Ost und West, die Hand zur Verständigung ausgestreckt, er hatte damals schon erkannt, daß dies — um nicht zum Vehikel für Propagandisten zu verkommen — auch begleitet sein müßte von einem vernünftigen Modus vivendi zwischen den Polen und ihrem ungeliebten Regime.
Deshalb hat der Papst jetzt in Breslau neben der äußeren auch zur inneren Versöhnung, zur Herstellung eines „gegenseitigen Vertrauens“ gerufen. Davon hängt, wie der Papst sagte, Polens Zukunft ab, „auch die der polnischen Staatsräson“. Aber das würde voraussetzen, wie er hinzufügte, daß „der Hunger und Durst so vieler Polen nach Gerechtigkeit befriedigt würde“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!