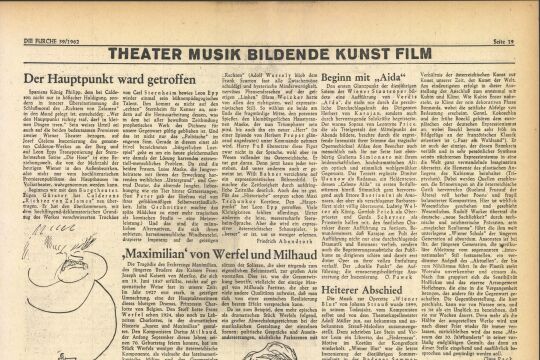Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Freud vorweggenommen
Adalbert Stifter schrieb 1847 in einem Brief, er müsse Hebbels bisheriges Schaffen „völlig verwerfen“, Hebbel ergehe sich in „Verrenkungen“, er biete „statt des Tragischen immer das Widerwärtige“, den Leser beschleiche „Verachtung gegen den Dichter.“ Das zielte wohl vor allem auf das Trauerspiel „Judith“ — derzeit aufgeführt im Burgtheater —, da Stifter in diesem Brief Holofeines als den „größten Theaterhanswurst“ bezeichnet, der ihm je vorgekommen sei.
Diesem Empfindsamen ist aber doch sehr zu widersprechen. Der erst 27jährige Hebbel bot in „Judith“ eine psychologische Situation, deren Festlegung spätere Einsichten vorwegnimmt — man denkt an Freud —, er präsentiert einen Sonderfall, in dem heftig Emotionales von Reflexivem durchdrungen wird. Das ist zweifellos Konstruktion, aber eine überaus packende. Hebbel exerziert da nahezu ein psychologisches Rechenexempel vor.
Die junge Witwe Judith ist „nicht Jungfrau und nicht Weib“, sie bleibt in der Hochzeitsnacht und danach durch Unfähigkeit des Manns unberührt. Ein Trauma entstand, sie kam sich „verunreinigt“ vor, sie „haßte und verabscheute“ sich, wurde zur Liebe unfähig, für den braven Durchschnittsmenschen Ephraim, der sie liebt, hat sie kaum viel mehr als Hohn übrig. Zwangsläufige Folge: Nur ein Übermann könnte sie faszinieren, es würde sie aber wohl zugleioh reizen, an ihm als Vertreter des nunmehr verhaßten männlichen Geschlechts ihre Schmach, ihre „Verunreinigung“ zu rächen. Als nun in ihr, bei tiefer Religiosität, Vaterlandsliebe aufflammt, sie ihre Heimatstadt vor dem Belagerer Holofer-nes retten will, ist sie aus ihrer inneren Situation heraus fähig, diesem Übermann gegenüber Sex einzusetzen; die Scheu vor dem Mord zu überwinden und ihn dabei zu töten. Die Rechnung geht auf.
Holofernes muß ein Ubermann sein, das bedingt die psychologische Grundanlage des Stückes, aber diese Gestalt fordert, im Gegensatz zu den heutigen Theaterunholden, zum Spott heraus, das hat Nestroy richtig erkannt. Wodurch? Es steckt nicht nur Kraft in Holofernes, sondern auch Kraftmeierei, seine Ruhmredigkeit, die Protzerei macht ihn lächerlich. Und Judith? Ihre Tat vor sich selbst als gottbefohlen zu rechtfertigen —, damit kommt sie schließlich nicht durch, sie erklärt, ihre Tat zermalme sie. Doch davon merkt man nicht viel, sie will nur ge-' tötet werden, falls ihre Hingabe Folgen hat. Ein weiter Abstand trennt diese „Judith“ nicht nur von Adalbert Stifters Urteil, sondern, gegensätzlich dazu, auch von heutigen li-bertinen Einstellungen. Übrigens sollte man die Aufführung mit vollbrachter Tat beschließen.
Die Schwierigkeit für die Aufführung besteht in dem vielen Reflexiven, das nur durch besondere Vitalität aufgefangen werden kann, die aber unter der Regie von Gerhard Klingenberg allzuoft fehlt. Schon das ständige Zerdehnen der Szenen schwächt die Wirkung. Unter den Bühnenbildern von Ezio Fri-gerio gibt es einen sehr starken optischen Eindruck: Statt des Platzes in Bethulien richtet er eine hohe ockerfarbene Stadtmauer mit schmalen Treppen daran auf, von der sich die Gestalten in ihren weißen Burnussen vorzüglich abheben. Das hat aber den Nachteil, daß sich diese Szenen nicht genügend ballen. Martha Wallner setzt als Judith gut an, es fehlt aber die sinnliche Ausstrahlung, die diese Gestalt doch auch besitzt, so daß die Zeltszene nicht überzeugt. Allerdings ist der ansonsten treffliche Rolf Boyesen eine völlige Fehlbesetzung, das ist keine unbändige übervitale Gewaltnatur, sondern ein kalter, intellektueller Finsterling mit Burgtheatertönen von anno 1880. Frank Hofmann sollte als Emphraim ein Schwächling sein, der sich aufputscht, das liegt ihm nicht. Hilde Krahl exaltiert in einer kleinen Rolle. Schade.
Vom Wiener Französischen Kulturinstitut veranstaltet, spielte die Truppe „Les Treteaux du Sud Pari-sien“ im Renaissance-Theater Mo-lieres Komödie „Dom Juan“, die sie auf Tourneen in Frankreich, Tunesien, Haiti vorgeführt hat. Dieses Stück, rasch geschrieben, wurde wegen seines lockeren Aufbaus bisher als Nebenwerk angesehen, daher wenig gespielt. Man übersah aber die Vehemenz, mit der hier die hemmungslose erotische Triebbesessenheit Don Juans, der Affront gegenüber den Menschen und der Transzendenz, dem Himmel, vorangetrieben wird, man übersah die eloquente Rationalisierung des Elementaren vor allem in den Dialogen zwischen dem Herrn und seinem Diener Sga-narelle, in denen sich dieser Heuchler und Gottesleugner dekuvriert, ehe er schließlich zur Hölle fährt. In manchem ist voraus de Sade zu spüren.
, Schlichte Inszenierung durch Roger Mollien, den geringen Möglichkeiten einer Wandertruppe gemäß: Schwarze Bühne, einige Stufen, einige hängende Metallplatten, im Proszenium vier Reproduktionen nach Hieronymus Bosch. Einen starken Eindruck bietet Mollien als Dom Juan durch gelassene, unprätenziöse Überlegenheit, die nur gelegentlich aufbricht, durch nuancenreiches Spiel. Jean-Claude Sachot ist ein sprudeliger Sganarelle. Die anderen Darsteller reichen da nicht heran.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!