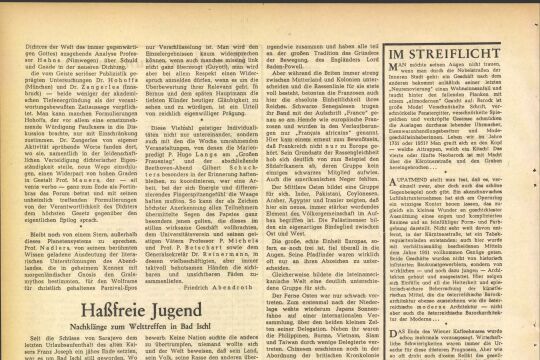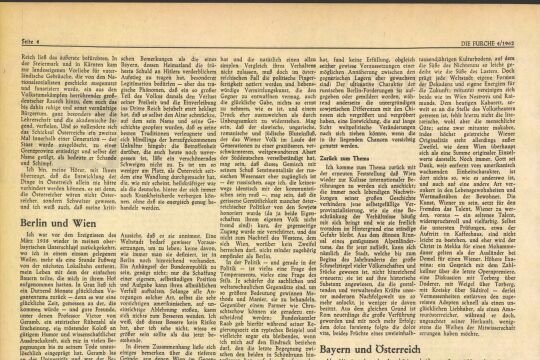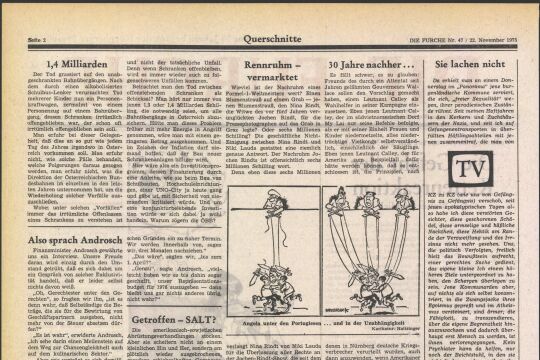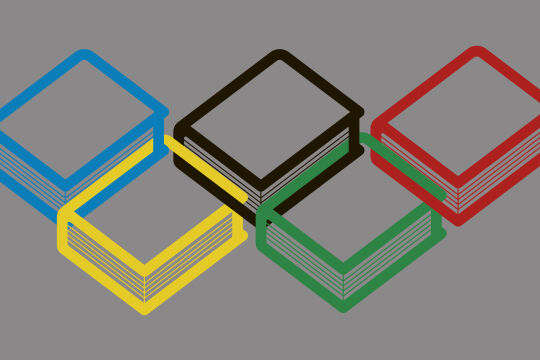Gladiatorenmarsch 1972
„The singing, chcering crowds demonstrated a sound instinct for commercial values. A disproportionate share of Austria's money and Jobs comes from the skimaking industry, with a mighty boost from the prestige of ski Champions like Schranz.“
„The singing, chcering crowds demonstrated a sound instinct for commercial values. A disproportionate share of Austria's money and Jobs comes from the skimaking industry, with a mighty boost from the prestige of ski Champions like Schranz.“
US-amerikanisches Nachrichtenmagazin „Time“ am 21. Februar 1972 über die Schranz-Ehrungen in Österreich.
Im Austrian-Look des US-amerikanischen Durchschnittsbürgers ist ein „gesunder Instinkt für kommerzielle Werte“ zweifellos eine höchst interessante und bemerkenswerte Novität. Die längste Zeit war es für unsere Erfolgsgeneration, cool, smart und clever wie sie sein möchte, schmerzlich genug zu hören, daß in fortschrittlichen Industriestaaten der Name Österreich fast ausschließlich mit Erinnerungen an romantische Dinge der Vergangenheit verbunden wird: The White Horses der Spanischen Reitschule, Schönbrunn, the Hapsburger, verballhornt wie Chee-seburger, Mayerling, bestenfalls Ty-rol; oder mit Namen von Geistesheroen von Mozart bis Freud. Lauter Dinge, die zu jener Vergangenheit gehören, über die Helmut Qualtinger im Vorwort eines populär gewordenen Bildbands schreibt: diese Vergangenheit ist schäbig geworden.
Und so wie das US-Magazin „Time“, 6 Auflagen in 150 Ländern der Erde, schreiben fast alle nach diesem Modell getrimmten Nachrichtenmagazine der freien Welt des Westens, namentlich „Der Spiegel“. Für sie ist der Fall Schranz nicht der tragische Konflikt des jungenhaften Skiidols aus Österreich mit dem vergreisten, vertrottelten, im Geld erstickenden „Olympiabösewicht“ Nr. 1, Avery Brundage.Was sie interessiert, ist die fabelhafte Story von jenen österreichischen „Wägermeistern und Skitischlern“, die innerhalb weniger Jahre die mächtigsten Skifabrikanten der Erde wurden. Im Jahr der XI. Olympischen Winterspiele 1972 in Sapporo erreicht der Anteil der österreichischen Skiproduktion mit 34,2 Prozent der Weltproduktion die Spitze, gefolgt an zweiter Stelle von Japan mit 29,5 Prozent. Auch das ist ein Aspekt
Konkurrenz rund um Sapporo
„Time“ glaubt mehr zu wissen als die Österreicher ahnen: In den letzten Jahren wurden einige der führenden Skifabriken der Schweiz, Deutschlands und Italiens von amerikanischen und britischen Interessenten aufgekauft, österreichische Skiindustrielle hätten sich aber dagegen gewehrt, richtiger: noch dagegen gewehrt, to seil out. Einer dieser Industriellen, früher selbst ein Skias, meint laut „Time“: Ich werde (mit meiner Firma) jeden Tag mehr wert; warum sollte ich also jetzt verkaufen. Und: In wenigen Jahren wird die Skiproduktion der ganzen Welt Sache von etwa zehn Unternehmern sein. Diese werden dann das Produktionsprogramm, vor allen bei sinkender Nachfrage, unter sich in Ordnung bringen. So wie dieser Exklusivklub dann wohl auch das Probelm der Olympischen Winterspiele, des World-Cup, der Weltmeisterschaften usw. in die Hand nehmen wird. Nicht nur im Skisport und im Wintersport gilt nämlich heute das Prinzip: Wer die Musikanten bezahlt, dem gehört der Tanz.
Man muß nicht unibedingt den erwähnten Produkten des modernen News Management glauben. Aber viele Menschen in aller Welt glauben im Falle Schranz das, was „Time“ und „Der Spiegel“ produzieren und verkaufen. So wie viele Österreicher sich die längste Zeit über das aufregten, was sie in Schlagzeilen zu lesen bekamen. Im olympischen Jahr 1972 sind die modernen Menschen in aller Welt, und also auch in Österreich, vielfach noch nicht so weit wie der grand old man der Demokratie, Abraham Lincoln, vor mehr als hundert Jahren, der meinte: Eine Zeitlang kann man die Leute an der
Nase herumführen. Was aber nicht gelingt, ist der Versuch, alle Leute die ganze Zeit an der Nase herumführen zu wollen.
Laßt den Schranz in Ruh
An dem Skandal, der schließlich um Karl Schranz entstand, ist etwas erfreulich. Ich meine, daß Schranz selbst das Menschenmögliche getan hat, um sich vom skandalösen Betragen anderer trotz aller Reklame fernzuhalten. So wie Traudl Hecher vor Jahren einem fanatisierten Haufen von Fans zurief: „Ja seid's denn ös narrisch wordn?“, fragte sich Schranz angesichts der Massen: „Für was soll das gut sein?“ Und wenn ihm ein Boulevardblatt den Satz in den Mund legt: „Das ist ja Wahnsinn!“, dann wird dieser Satz wahrscheinlich länger interessant bleiben als der Rest der aufgemascherlten Sensationsreportage. Bei der Begegnung mit seiner Mutter, als Schranz aus dem Narrenturm der Welt heimkehrte nach Tirol, legte sich dieser Sportsmann ein Bild ein, wie es unter den am besten „geschossenen“ Bildern von Sapporo kein gleich gutes gibt.
Schranz beweist, daß auch im Sport der gute Profi so wie der gute Amateur zuerst und zuletzt ein good sportsman sein muß. Er widerlegte den neuerdings in Kreisen des Fußballsports “aufgekommenen Typ, der glauben machen will, Höhe des Handgelds und Transfersumme seien an sich Hinweise auf Qualität und Leistungsfähigkeit. Anderseits: Wer die Leistungskonkurrenz in den höchsten Rängen des Weltspitzensport will, der muß auch zur Kenntnis nehmen, daß solche Leistungen nicht in der Nachmittagsbeschäftigung, in der Freizeit des berufstätigen Menschen, in Weekendtrainingslagern usw. erarbeitet werden können. Dazu gehört auoh mehr als ein bestimmter Lebensstil und der Wille sowie die Entschiedenheit, nur diesen Stil zu leben. Im Falle des alpinen Skisports braucht es zum Beispiel unter anderem ein kompliziertes, kostspieliges und spezielles Service, von dem ein halbes Dutzend Betreuer pro Mann und Start nur ein Teil sind. Je ein Coach, einige Spezialtrainer, ein Arzt, ein Masseur, ein Psychologe, ein Zeitnehmer, ein Wachsler usw. für die ganze Mannschaft genügen nicht. Das Service für alle kann nicht die aufs höchste gesteigerte und in aller Welt einmalige Leistung des Einzigen stimulieren. Schranz sagt uns, daß dieses Service der Skifirmen nur von diesen und nicht vom ÖSV oder vom ÖOC geliefert werden kann. Er kennt die Konfliktsmotive der diversen Ehrgeizigen und Verdiener in Diensten der Industrie und des Sportmanagements. Und er weiß, was inmitten des Skandals oft vergessen wurde, daß nämlich dieses ganze System des übersteigerten Leistungssports mit dem traditionellen Zuschnitt Olympischer Spiele ex 1896 unter keinen Umständen länger vereinbart werden kann. In diesem Punkt gibt es auch keinen Konflikt zwischen Karl Schranz, dem ÖSV und dem ÖOC.
Brundage ist kein Idiot
Avery Brundage, Jahrgang 1887, dreimal Sieger in den All-round-Meisterschaften der USA, 1912 Fünfter im Olympischen Fünfkampf, 1929 Präsident des NOC der USA, seit 1952 Präsident des IOC, versteht wahrscheinlich mehr vom Athletiksport, als er im Umgang mit dem News Management nötig hätte. Wenn Brundage — mit anderen Worten — sagt: die Gigantomanie, die bei
Olympischen Spielen eingerissen ist, bedeutet eine Gafahr für den Sport, lOOprozentige Abhängigkeit des Athleten vom Training für kontinuierliche Höchstleistungen ist auf die Dauer in physischer und psychischer Hinsicht ungesund, der Mammonismus im Sport bringt den Sport um usw. und wenn Brundage vor dem Typ des Gladiators warnt, dann hat er wahrscheinlich alle vernünftig denkenden Menschen außerhalb der Reihen der Fans und Idolschwärmer für sich. Vor allem auch Karl Schranz.
Aber Brundage ist nicht konservativ aus Prinzip, wie viele meinen, sondern reaktionär in der Methode. Er kommt von der Ausgangslage der Olympischen Bewegung, von der sehr zeitbedingten und inzwischen wackelig gewordenen Grundannahme des Baron Pierre de Couber-tin, des Erneuerers der Olympischen Spiele der Neuzelt, nicht weg. Damals konnte es 1896 bei den I. Olympischen Spielen in Athen geschehen, daß Robert Garret (USA), der in Athen zum erstenmal einen Diskus sah, vom Fleck weg die Goldmedaille im Diskuswerfen errang. Und dazu noch eine Goldmedaille (Kugelstoßen), eine Silbermedaille (Weitsprung) und eine Bronzemedaille (Hochsprung) in jenen Disziplinen, deretwegen er eigentlich über den Atlantik gekommen war.
Die Leistungen Garrets aus 1896 verhaltenen sich aber zu denen aus 1972 wie das idyllische olympische Stadion, in dem Brundage 1912 in Stockholm einen fünften Platz erringen konnte, zu einem olympischen Stadion, Modell 1972, das eine verzweifelte Ähnlichkeit mit einer militärischen Großkampfanlage aus Stahlbeton hat.
Olympische Spiele, wie sie Brundage 1972 haben möchte, kämen nie mehr zustande. Weil sich keine Stadt, kein Staat und kein internationaler Fachverband um eine derartige Konkurrenz bewerben würde. Eine Konkurrenz mit Leistungen, die wegen der Amateurbestimmungen aus der Zeit vor 1914 weit unter dem Level der heutigen Weltbestleistungen liegen müßten, würde aber weder Zuschauermassen, noch Finanziers und Nutznießer der diversen Prestigeerfolge reizen.
Und doch sind Olympische Spiele, deren heutiges Einzugsgebiet weit jenseits der Grenze zwischen Professionalismus und Amateurismus existiert, von eminenter Bedeutung für eine Welt, die nur noch sehr wenige world-wide Veranstaltungen der Jugend der ganzen Welt kennt. Ob es nach der Ära Brundage solche Spiele — oder ähnliche — noch geben wird, das bestreiten jene, die wissen, daß die Cliquen in den nationalen Olympischen Comites und die Interessen-tengesossenschaft der internationalen Fachverbände des Sports nie mehr jenen Zusammenihailt bieten könnten, den der bei Kommunisten und Kapitalisten reell eingeschätzte Avery Brundage noch Kraft seiner Persönlichkeit, Herkunft und Anschauung aufrechterhält.
In dieser Hinsicht ist Brundage allerdings „out“ im Sinne der herrschenden soziologischen und politischen Anschauungen. Nicht auszudenken, was wohl aus unserer Welt werden könnte, wenn nicht mehr allein Massenorganisationen und deren Apparate, sondern der Mensch Haltepunkt wäre.
Einer der Gebrannten unserer Generation verfaßte unlängst eine „Geschichte der Römer“. Ein Kapitel dieses Bestsellers des Deutschen Joachim Fernau: „Cäsar läßt grüßen“, das über die Wettkämpfe, reflektiert auf die Story von Sapporo: In der Ära des jetzt wieder legendär gewordenen Spartacus waren die Kämpfe der Gladiatoren nicht mehr an kultische Feiern gebunden. So wie heute im Ablauf der Konkurrenzen des World-Cup, jagte eine Veranstaltung die andere. Und so wie es heute chic ist und lukrativ dazu, einen „Stall“ zu haben, so gab es auch im alten Rom genug Neureiche, die sich ein Gladiatorenteam halten konnten. Abgeschirmt vom Rest der Welt lebten die Kämpfer in ihren Trainingsquartieren, um von Zeit zu Zeit an Veranstalter verliehen zu werden. Denn Stallbesitzer und Zirkusveranstalter waren verschiedene Unternehmer. In den Staatsspielen des Kaisers Augustus und bei den Volksspieien des Kaisers Trajan fochten tausende Kämpfer, und unzählige Beucher verbrachten ein Drittel des Jahres im Zirkus.
Die Musik der Ktesibios-Orgel simulierte mystische Motive. Und der Einzug der Gladiatoren war ein faszinierender Anlblick, der die Massen „von den Sitzen riß“. Der Reiz der Todesgefahr, die ganze Atmosphäre der gekonnt gemachten Show ging den Leuten „unter die Haut“. Das war damals „das bißchen Freude“, das „unsereins ohnedies nur hat“. Es war etwas für harte Männer und für Frauen, die schon emanzipiert genug waren, um den männlichen Stil angesichts des Massaker mitzumachen.
Im Zirkus war die Masse Souverän. Sie kannte sich besser aus als die oben, die mit ihren Prognosen über den Ausgang der Kämpfe bei weitem nicht so sehr recht behielten wie die Stehplatzbesucher mit ihren Tips für Wetten. Im übrigen war alles wie heute: Man erhitzte sich vor, während und nach dem Kampf, schlug zuweilen alles kurz und klein, verhimmelte ein Idol oder ließ es „kalt sterben“. Jetzt ist das Ganze massenpsychologisch und soziologisch erkundet und wegen der Gefährlichkeit des Triebverzichts zuweilen geradezu staatspolitisch wertvoll.
Aber wer möchte sich noch mit der Antike beschäftigen, deren Studium nach dem Urteil eines prominenten Staatsmannes nur von der Beschäftigung mit Zeitgeschichte abhält. Und welcher Gebildete beschäftigt sich mit Sport oder mit Literatur wie eben zitiert. Vielleicht wird man sich an den historischen Vergleich erinnern, wenn bei den Olympischen Spielen in München das Idol des Reitsports über den Parcours jagen wird. Auf einem Pferd, das den Namen einer der bekanntesten Schnapsbrennereien trägt. Pardon: dessen Namen diskreter Hinweis auf die schöne Pflicht des Sponsors und des Mäzens ist. Und man wird sich fragen: Hat der Sport, abseits von Extremen, die rund um Sapporo sichtbar wurden, eine Chance. Oder: Ist überall und zu allen Zeiten Rom? Und nachher nicht mehr?