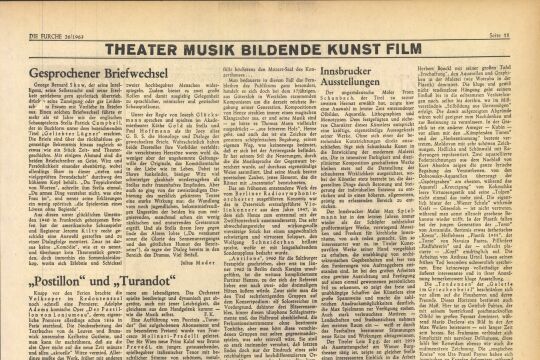Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Henzes nostalgische Moderne
Mit größter Spannung erwartete die internationale Musikwelt die Uraufführung von Hons Werner Hernes „La Cubana — oder ein Leben für die Kunst“ im Bayerischen Staatstheater am Gärtnerplatz. Die Frage war: wird es gelingen, totales Theater, das Musik, Schauspiel, Gesang und Tanz in ein Ganzes bindet, zu realisieren? Nicht etwa in der bekannten Form des Musicals, sondern viel konsequenter und absoluter, denn der Orchestergraben ist verschwunden, die Musiker in die Szene integriert! Der Versuch ist nicht nur geglückt, sondern so exemplarisch ausgefallen, daß er gleichzeitig als Maßstab für die Realisation ähnlicher Produktionen zu gelten hat. Darauf kann Staatsintendant Pscherer stolz sein — auch wenn diesmal Imo Moszokicz am Regiepult saß —, so ist es doch Pscherers unermüdlichem Aufbau seines Ensembles zu danken, daß diese Uraufführung, trotz des außergewöhnlichen Schwierigkeitsgrades, mit solcher Präzision abgewickelt werden konnte.
Zunächst aber zum Werk selbst. Anstoß zur Barbeitung des Sujets gab Hons Magnus Enzenberger. Er hatten den Stoff einem Buch des jungen kubanischen Dichters Miguel Barnet entnommen und daraus ein sehr wirkungsvolles Libretto geformt. Wenn man dieses Textbuch betrachtet und über die jüngsten Ideen des Komponisten Henze — die bereits in „El Cimarron“ deutlich hervorgetreten sind — informiert ist, läßt sich unschwer die Affinität herausfinden, die diese gemeinsame Produktion in Form und Inhalt bestimmt. Im Mittelpunkt steht die Lebensgeschichte der Variete-Tänzerin Rachel, die im Ungarn der k. u. k. Donaumonarchie aufgewachsen, nach Havanna verschlagen wurde und Stationen ihres Daseins noch einmal Revue passieren
läßt. Dramaturgisch bedeutet das: Rückblende in Tableau-Technik. Während die alte Rachel in einem Lehnstuhl seitlich im Bühnenvordergrund sitzt, werden ihre Erinnerungen szenisch dargestellt, wobei die junge Rachel in all den Etablissements agiert, in denen sie aufgetreten ist, vom Tivoli über den Zirkus bis zum Alhambra. Enzensberger wäre nicht Enzensberger und Henze nicht Henze, wenn Fidel Castros kubanische Revolution nicht ihren Platz in diesem Stück hätte, aber sie bildet nicht mehr als den historischen Hintergrund, sie zieht an der Figur der Rachel vorüber, ja sie wird von dieser überhaupt nicht beachtet, denn sie ist zu egozentrisch in ihre Allüren undl Selbstbestätigungen verstrickt. Der Untertitel: „... oder ein Leben für die Kunst“ gibt Aufschluß über das Anliegen der Autoren, dieses Leben für die Kunst und diese Kunst selbst sollen demaskiert werden, daä Leben im Tingel-TangelHMief, das sich für die alte Rachel in der Erinnerung verklärt, dem jedoch — in der Darstellung durch die junge Rachel — auf Schritt und Tritt die Wirklichkeit konfrontiert wird.
Hans Werner Henze hat dazu eine sehr eigenartige Musik geschrieben. Jede szenische Situation wurde von ihm musikalisch präzisiert. Das geschieht igenau durchdacht, mit klarem Kalkül, man hat den Eindruck, daß nichts anderes zu eben diesem Zeitpunkt möglich ist, als beispielsweise eine Mundharmonika, daß Maultrommeln und Ratschen, Lautenklänge, Orgelmusik, Blockflöten-Passagen, Beethovens „Mondscheinsonate“, Blech- und Schlaginstrumente, oder der Mahagonny-Sound Kurt Weills genau dann eingesetzt werden, wenn dafür eine atmosphärische Notwendigkeit besteht. Die Stärke Henzes liegt also in diesem Fall nicht in der eigenen, musikalisch-thematischen oder motivischen Erfindung, sondern in einer meister-
halt angewandten Form der Persiflage, des Zitats, der rhythmisch-folkloristischen Elemente. Dabei läßt sich Henze keinen Theatereffekt entgehen, ob es sich um zirzensische Clownerien, um die Durchdringung der Scheinwelt eines showbedingten Keep-smiling auf Variete-Brettern, um einen Leichenzug mit Kardinal, oder einen Striptease handelt — alles ist eingefangen und ergibt Hen-zes neue, nostalgische Moderne. Der Kunstgriff Henzes und Enzenbergers ist dabei: Desillusion der Kunst durch Kunst! Wie verdreht unsere Welt ist, wird dadurch deutlich, daß die Autoren eine derart artifizielle und intellektuell-kompliaierte Konstruktion schaffen mußten, um den Eindruck einer gewissen Simplizität zu erzielen!
Doch zur Wiedergabe: Zunächst müssen wohl der Dirigent Peter Flak und die Orchestermusiker genannt werden, denn sie haben die ungewöhnlichsten Aufgaben zu lösen. Falk 'dirigiert — vom Publikum nicht eingesehen — auf der Beleuchtungsbrücke sitzend, vor einer Fernsehkamera und ist mit den Sängern und Musikern über Monitore verbunden. Die Musiker selbst spielen ihren Part je nach Auftritt in kleineren oder größeren Gruppen und man hat durchaus den Eindruck, daß es ihnen Freude macht, aktiviert worden und aus ihrer Anonymität
herausgeholt worden zu sein. Dabei läuft alles mit einer Perfektion ab, die im Orchestergraben beileibe nicht immer die Regel ist. Regisseur Imo Moskowicz nützt die Intimität des Hauses, die noch intensiviert ist durch die Tatsache, daß sich die Spielfläche — die jetzt auch den Orchestergraben überdeckt — weit in den Zuschauerraum hinein vorschiebt. Bisweilen koninte Moszko-wicz das Tempo nicht durchhalten, auch hätte es noch einiger Striche bedurft, gar zu lasziv welkt die junge Rachel ihrem Alter entgegen, aber nachdem es Tamara Lund ist, die man hier in einer geradezu vollkommenen Einheit von Spiel, Gesang und Tanz bewundem kann, bleibt es doch kurzweilig. Eine schönere, prä-destiniertere Rachel hätte Henze nicht finden können! Auch Nava Shan ist im Typ großartig getroffen, diese Tschechin aus Israel gestaltet die Rolle der alten Rachel so glaubhaft, daß man beinahe versucht wäre, Autobiographisches zu vermuten. Alle übrigen Partien sind klein, aber nicht unbedeutend — das Gärtnerplatztheater-Ensemble übertraf sich selbst. Auch die vortrefflichen Bühnenbilder und Kostümentwürfe von Jürgen Henze sollen noch erwähnt sein. Buhrufe für die Autoren, Bravo dem Ensemble.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!