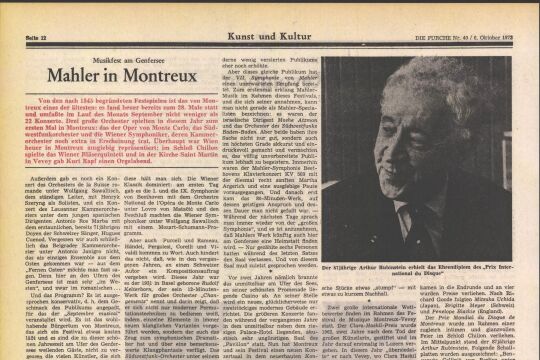Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von und mit Hans Werner Henze
Das Henze-Konzert im Zyklus „Werke lebender Meister“, eines der letzten des XI. Internationalen Musikfestes der Wiener Konzerthausgesellschaft, war ohne Zweifel das interessanteste, leider aber auch das am schlechtesten besuchte im Rahmen der Wiener Festwochen. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Hans Werner Henze ist in Wien und in Österreich weit weniger bekannt als etwa in Deutschland, Italien oder England. Von seinen Bühnenwerken — mit den Balletten sind es ein rundes Dutzend — wurde in Österreich ein
einziges szenisch aufgeführt — und das nicht in Wien. Im Konzertsaal begegnet man seinen Werken nur ab und zu. Also ein fast unbekannter Komponist. Bedenkt man etwa, daß Brittens „Kriegsrequiem“ recht gut besucht war, so kommt man leicht auf die Gründe für den halbleeren Saal beim Henze-Konzert: es fehlte, zumindest für das Wiener Publikum, der Stardirgent (Henze leitete sein Kompositionskonzert nämlich selbst) oder der „berühmte“ Solist. Ohne diese geht es nun einmal in Wien nicht. lenes Publikum, das auf diese Attraktionen verzichten kann,
füllt höchstens den Mozart-Saal des Konzerthauses ___
Man bedauerte in diesem Fall das Fernbleiben des Publikums ganz besonders, handelt es sich doch bei dem 37jährigen, aus Gütersloh in Westfalen stammenden Komponisten um die derzeit reichste Begabung seiner Generation. Kompositionen von Henze strahlen immer einen magischen Klangzauber aus, er und seine Musik sind — so hätte es Thomas Mann vielleicht ausgedrückt — „aus feinerem Holz“. Henze geht, und auch das ist ein Zeichen der genuinen schöpferischen Begabung, seinen eigenen Weg, was keineswegs bedeutet, daß er sich bei der Arrieregarde befindet. Er hat seinem Stil die Neuerungen, durch die die Musiksprache der Gegenwart bereichert wurde, auf durchaus eigenständige Weise assimiliert. Und seine Musik besitzt poetischen Zauber, jenes Element, das die Römer mit „incantatio“ bezeichneten.
Das am frühesten entstandene Werk des vom Berliner Radiosymphonieorchester ausgeführten Konzerts war das in Österreich erstaufgeführte Violinkonzert aus dem Jahre 1947, in dem sich Henze zum erstenmal mit der Zwölftontechnik auseinandersetzt. Das sehr abwechslungsreiche und wirkungsvolle viersätzige Stück hat einen ungewöhnlich schwierigen und virtuosen Solopart, den Wolfgang Schneiderhan brillant spielte, wofür er mit langanhaltendem Sonderapplaus bedacht wurde.
„Antifone“, 1960 für die Salzburger Festspiele geschrieben, aber erst im Jänner 1962 in Berlin durch Karajan uraufgeführt, ist die weitaus komplizierteste Partitur Henzes, zu der sich der Referent lieber erst nach zwei- oder dreimaligem Hören äußern würde. Zwar sieht man die den Titel rechtfertigenden Gruppen auf dem Konzertpodium: elf Solostreicher im Vordergrund, dahinter drei Bläserensembles, hinter diesen idiophone Schlaginstrumente und, das Halbrund abschließend, die Perkussionsinstrumente ohne bestimmte Tonhöhe, aber man hört diese verschiedenen Gruppen nur selten gegeneinander-spielen, was sehr reizvoll wäre. Sie sind so stark ineinander verzahnt, daß letzten Endes doch nur der Eindruck eines sehr reichhaltigen und hochdifferenzierten Orchesterklanges entsteht, dessen allzu komplizierte Faktur das Hören erschwert.
Diese Gefahr des Schwerdurchhörbaren, Amorphen ist in Henzes vorläufig letztem Werk, seiner im Mai dieses Jahres in New York uraufgeführten 5. Symphonie völlig gebannt. Das knapp zwanzig Minuten dauernde dreisätzige Stück beginnt mit einem schwungvollen und dramatischen „Movimentato“ mit standigem Wechsel von Zweier- und Dreiertakten in erweiter-ter&hafenför*. ÄÜ? diesen folgt ein kurzes lyrisches Adagio mit immer anders gefärbten liegenden Akkorden, die von teils ariosen, teils rezitativischen Melodiebögen überspannt beziehungsweise unterbrochen werden. Der dritte Teil besteht aus 32 in gleichmäßiger Achtelbewegung ablaufenden Variationen: ein wirkungsvolles Finale. Gehalt und Tonsprache dieser Symphonie sind, nach dem Kommentar Henzes, durch die Menschenwelt und Landschaft Roms, wo er während der letzten Jahre lebte, sowie durch den vergleichsweise härteren römischen Dialekt beeinflußt. Der eigentliche Fortschritt aber liegt in der erhöhten Plastik und Faßbarkeit dieser Musik, deren ausgezeichneter Interpret das Berliner Orchester unter der Leitung des Komponisten war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!