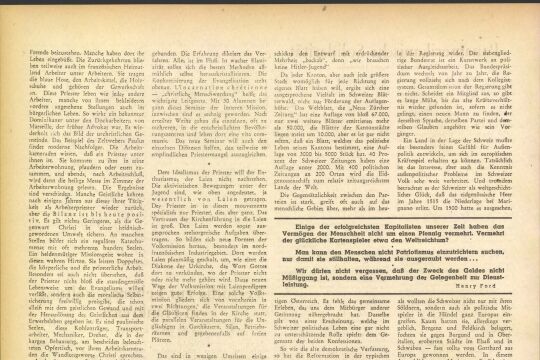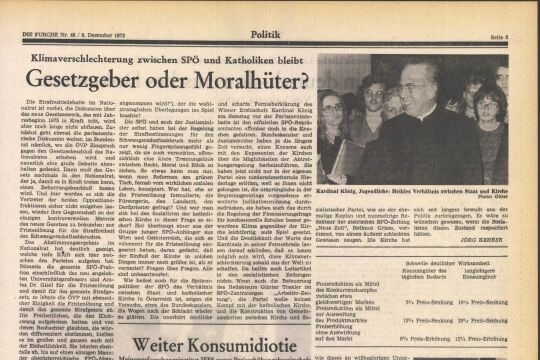Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nein zur Fristenlösung verpflichtet alle Stimmbürger
Als erstes Volk haben die Schweizer an den Urnen direkt zur Abtreibung Stellung nehmen können, und sie haben sich mit 994.677 gegen 929.239 Stimmen gegen die Freigabe des Abortus in den drei ersten Schwangerschaftsmonaten (also gegen die „Fristenlösung“) ausgesprochen. Zufallsentscheid oder Tendenzwende? Anachronismus oder Testfall für einen Trend?
Die Volksabstimmung der Eidgenossen bietet als denkbar größte Form der Meinungsumfrage erstmals verlässliche Grundlagen zur Neubeurteilung eines fundamentalen sozialpolitischen Problems, dessen Lösung in verschiedenen Ländern mangels direkter Volksbefragung zu parteitaktischen Schachzügen mißbraucht worden ist. Der Entscheid des Schweizer Souveräns kann unter, drei Gesichtspunkten - nach Repräsentativität, Ursachen und Konsequenzen - durchleuchtet werden, unter einem abstimmungstechnischen Gesichtspunkt, einem politischen und einem weltanschaulich-grundsätzlichen.
Was am 25. September zur Entscheidung gebracht worden ist, war die von rund 65.000 Bürgern unterschriebene Volksinitiative für eine Fristenlösung, die 1976 „aus realpolitischen Gründen“ und „weil dem Volksempfinden näherstehend“ die Nachfolge einer ersten, bereits 1971 gestarteten Initiative angetreten hatte; dieses erste Volksbegehren hatte eine völlige Straffreiheit des Abortus, ohne zeitliche Beschränkung, verlangt. Da für eine im vorliegenden Fall nötige Verfassungsänderung neben der Volksmehrheit auch das „Ständemehr“, also eine Mehrheit aller Kantone gefordert ist, war von vornherein klar, daß sich das Schicksal der Fristenlösung nicht am Volksmehr, sondern am Ständemehr entscheiden würde. Und dieses fiel denn auch mit 7:15 ganz klar und eindeutig aus. Diese Regelung einer „doppelten Zustimmung“, gewachsen aus dem in der Schwei* hqchgehalte- nen Prinzip des Minderheitenschutzes, dürfte denn auch für absehbare Zeit weitere Vorstöße zur Einführung einer wie auch immer definierten Fristenlösung aussichtslos machen. Bleibt also in der Schweiz bezüglich der Abtreibung alles beim alten, bei einer Freigabe der Abtreibung also nur aus Gründen medizinischer Indikation, mit auffallenden Unterschieden in der Rechtsauslegung von Kanton zu Kanton? Die Entscheidung darüber wird im Laufe der nächsten drei Monate fallen; die eidgenössischen Räte haben nämlich einen Gegenvorschlag vorbereitet, der in einer „erweiterten Indikationenlösung“ neben der medizinischen auch die juristische, eugenische und die heiß umstrittene soziale Indikation als straffrei anerkennt. Diese soziale Indikation wird aber von weiten Kreisen als verkappte Fristenlösung durchschaut, weshalb damit zu rechnen ist, daß die Volksabstimmung auch über dieses Gesetz verlangt werden wird. Seine Chancen gelten denn auch zur Zeit als mehr denn ungewiß, nicht zuletzt deshalb, weil es durchaus möglich ist, daß eine Allianz erklärter Gegner der sozialen Indikation und enttäuschter Anhänger der Fristenlösung diese zweite Vorlage noch deutlicher zu Fall bringen könnte.
Sicher ist freilich, daß die 52 Prozent Nein-Stimmen zur Fristenlösung kaum ausreichen, um die mancherorts herrschende Abtreibungspraxis, die de facto der Fristenlösung gleichkommt, wieder strenger zu fassen; dies um so mehr, als gerade die „liberalen“ Kantone - Zürich, Basel, Neuenburg, Waadt und Genf - durch Ja- Mehrheiten zwischen 60 und 78 Prozent in ihrer Gesetzesinterpretation eher noch bestärkt worden sind. Neben diesen beiden Stadtkantonen und den drei welschen Kantonen protestantisch-liberaler Observanz vermochte die Fristenlösung nur noch Schaffhausen und Bern zu dünnen bis hauchdünnen Ja-Mehrheiten zu bewegen, in allen anderen 15 Kantonen erfuhr sie eine deutliche bis wuchtige Ablehnung. Wenngleich in den vorwiegend katholischen Kantonen die eindrücklichsten Nein-UberschüSse zu verzeichnen waren - das engagierte Nein der Bischöfe und der Synode 72 hatte dort Gewicht -, so zeichnet sich doch die deutlichste Polarisierung nicht ‘zwischen den Konfessionen, sondern zwischen Stadt und Land ab, wo auch überwiegend protestantische Kantone wie Thurgau, Graubünden und Appenzell-Ausserrhoden die Fristenlösung deutlich ablehnten. Ob man diese Polarisierung als Ausfluß einer konservativen Einstellung der Landbevölkerung oder aber als Ausdruck eines dort noch intakten rechtlichen und ethischen Verantwortungsbewußtseins bezeichnen will, ist eine Frage des Standpunkts. Daß die. Dinge aber nicht unbedingt so einfach liegen müssen, zeigt die 6 : 4-Ableh- nung im Aargau, einem in jeder Beziehung gemischten Kanton von eher industriell-städtischem Charakter, der sich für einen eventuellen Vorwurf des „Hinterwäldlertums“ bedanken würde! Das eindeutig ablehnende Votum in den Gebieten mit erhaltener politisch-konfessionell-sozialer Struktur und Tradition legt vielmehr den Schluß nahe, daß die Kontinuität einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf das rechtlich-ethische Empfinden des einzelnen und damit auch auf seinen Entscheid an der Urne ausgeübt hat. Wie sehr der Sachentscheid als grundsätzliche Stellungnahme zur Abtreibung überhaupt aufgefaßt worden ist, zeigte nicht nur die manchmal überbordende Leidenschaftlichkeit in der Abstimmungskampagne, sondern auch die für Schweizer Verhältnisse hohe Stimmbeteiligung von rund 51 Prozent. Nur noch die Uberfrem- dungsinitiativen und die Frauenstimmrechts Vorlage haben im Laufe der letzten fünfzehn Jahre noch mehr Stimmvolk zu mobilisieren vermocht Das führt uns zum dritten, grundsätzlichen Aspekt. „Die Frage ist nicht: Abtreibung ja oder nein, sondern schlicht: Abtreibung legal oder illegal!“ Dieser simple Slogan, von den Anhängern der Fristenlösung vorgetragen, versuchte Kapital aus dem verbreiteten Unbehagen zu schlagen, das aus der von Kanton zu Kanton ver schiedenen Handhabung der Abtreibungsparagraphen des Strafgesetzbuches erwächst. Es ist ganz unbestritten, daß die Abtreibungsfrage jedes Staatswesen vor eine unausweichliche Grundsatzentscheidung stellt, soll nicht der Anspruch auf Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit, und damit das Existenzrecht dieser Gemeinschaft aufgegeben werden. Der Staat hat Interesse daran, die Abtreibung als gegebenes soziales Phänomen im Einklang mit seinen Rechtsnormen zu regeln - die Frage ist nur, ob dabei die Rechtsnormen oder die Abtreibungspraxis die variable Größe darstellen, ob also die Grundsätze oder die Tatsachen geändert werden sollen. Es ist irgendwie symptomatisch, daß im Abstimmungskampf diesem Kernpunkt und den daraus erwachsenden sozialpolitischen Konsequenzen recht wenig Beachtung geschenkt wurde. Durch die Polarisierung auf eingängige Schlagworte - das „Recht auf den eigenen Bauch“ wurde der „Achtung vor dem Leben“ entgegengestellt - ließ sich zwar eine breite Masse mobilisieren. Im Schlachtgetümmel der Emotionen ging jedoch die schüchterne, aber zielführende Frage unter, ob denn in der heutigen Zeit eine soziale Notlage sich nicht noch anders als nur durch Abtreibung lösen ließe. Und wo Vorschläge zur sozialen und rechtlichen Besserstellung der gefährdeten Familien, Mütter und Kinder gemacht wurden, sahen sich diese Vorschläge alsbald als „Lippenbekenntnis“ und „Heuchelei“ disqualifiziert.
Zum Glück gibt es einige vielversprechende Projekte, ausgearbeitet vor allem von Fristenlösungsgegnern, denen es darum geht, die im Abstimmungskampf freigewordenen Kräfte in ein längerfristiges Engagement umzusetzen. Dazu zählen auf parlamentarischer Ebene zwei Vorstöße der CVP-Fraktion, die ein „Sozialpaket für Mutter und Kind“ verlangen, das in concreto eine Mutterschaftsversicherung mit Deckung aller medizinischen Kosten, einen viermonatigen Mutterschaftsurlaub und Lohnfortzahlung enthalten soll; ferner sollen Einrichtungen zur beruflichen Wiedereingliederung nach beendeter Erziehungsaufgabe, ein Kündigungsschutz für Schwangere und Mütter kleiner Kinder, und verbesserte finanzielle Unterstützungen realisiert werden. Eine neuartige Aktion startete die Caritas Schweiz. Unter dem Titel „Ein Nein, das uns verpflichtet“ will sie alle Schweizer, die durch ideellen oder politischen Einsatz, direkte Hilfeleistung an überlastete Mütter und Familien, durch regelmäßige finanzielle Beiträge oder spezifische Hilfeleistung als Arzt, Jurist oder Psychologe einen Beitrag leisten wollen, in einer zentralen Computerdatenbank erfassen, um überall rasch helfen zu können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!