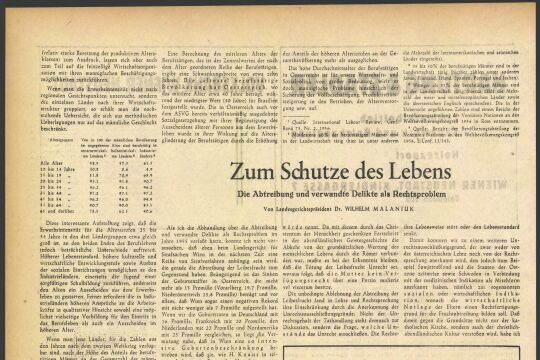Dilemmata zur Abtreibung
Deutschlands Bischöfe kommen der Papstbitte in Sachen Schwangerenberatung nach. Auch das Verfassungsgericht mischt in der aktuellen Abtreibungsdebatte mit.
Deutschlands Bischöfe kommen der Papstbitte in Sachen Schwangerenberatung nach. Auch das Verfassungsgericht mischt in der aktuellen Abtreibungsdebatte mit.
Die Auseinandersetzung um die Schwangerenkonfliktberatung in Deutschland geht weiter. Nach einem vergangene Woche veröffentlichten Brief des Papstes soll die katholische Kirche in ihren Beratungsstellen künftig keine Beratungsscheine mehr ausstellen, die in Deutschland für eine Abtreibung notwendig sind. Zwar nennt der Brief keine Fristen, sodaß bis zu einem endgültigen "Aus" der Beratungsscheinausstellung noch eine Nachdenkpause bleibt.
Die politischen Parteien, allen voran die CDU, waren insofern erleichtert, als durch diese Vorgangsweise die Abtreibung nicht automatisch zum Wahlkampfthema wird. Einen "Abtreibungswahlkampf" fürchtet vor allem Helmut Kohl, da er in einem solchen die Stimmen der rechtskonservativen Christen zu verlieren droht, die für ihn - obzwar zahlenmäßig gering - wahlentscheidend sein könnten.
Obligatorischer Schein Eine besondere Rolle in der gesamten bundesdeutschen Diskussion spielt das Bundesverfassungsgericht. Zuletzt hatte dieses die junge Familienministerin Claudia Nolte aus dem ostdeutschen Thüringen ins Spiel gebracht. Nolte befürwortete eine neue Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht zur Neuregelung des berühmten § 218, jenem Paragraphen, der Abtreibung unter bestimmten Bedingungen straffrei läßt. Kanzler Kohl pfiff seine Ministerin zwar umgehend zurück, dennoch rückte das Bundesverfassungsgericht erneut in den Blick der Öffentlichkeit.
1993 hatte das Gericht die Neufassung des § 218 aufgehoben, der eine Fristenlösung vorsah: Die deutsche Verfassung fordere vom Staat eindeutig den Schutz jedes menschlichen Lebens. Eine Fristenlösung, die Abtreibung bis zum dritten Monat (wenngleich unter bestimmten Bedingungen) gestattet, sei grundgesetzwidrig. Aber der Schutz des Lebens könne auch anders gewährleistet werden als durch strafgesetzliche Verfolgung. Etwa durch eine Beratung, die für die Schwangere vor einer allfälligen Abtreibung verpflichtend ist.
In diesem Sinn einigten sich 1995 die Regierungsparteien und die SPD auf ein Gesetz, das jene Beratung vorschreibt, die durch den "Beratungsschein" nachgewiesen werden muß. Diese Beratung, so der Parteienkonsens, ist ergebnisoffen zu führen. Mit anderen Worten: Es darf nicht schon von Anfang an feststehen, daß eine Abtreibung nicht empfehlenswert ist. Es wäre sonst zu befürchten, daß die meisten Besucherinnen das Beratungsgespräch als reine Pflichtübung sehen, um den für die Abtreibung nötigen Schein zu holen, ohne sich überhaupt für andere Ansichten zu öffnen.
Die katholische Kirche, die bundesweit 260 (von insgesamt 1.685) Beratungsstellen führt, geriet in ein Dilemma: Konservative Kreise sahen in der Ausstellung des Beratungsscheins eine Mitwirkung an der Abtreibung und eine "Lizenz zum Töten". Fuldas Erzbischof Johannes Dyba, einer der Exponenten dieses Kirchenflügels, verbot in seiner Diözese die Ausstellung des Scheins. Die Mehrheit der Bischöfe argumentierte hingegen, durch die Beratung könnten mehr Frauen von einer Abtreibung abgehalten werden als durch die Verweigerung des Scheins. Den Konflikt sollte Rom entscheiden, wohin deutsche Bischöfe deswegen schon im Dezember 1995 und im April 1997 gepilgert waren. Am 27. Jänner wurde dann der Papstbrief veröffentlicht, der aber doch vorsichtiger als befürchtet gefaßt war: Keine Terminangabe, kein sofortiger Ausstieg, aber die Suche nach ernsthaften Alternativen. Das wollten sie auch tun, entschieden die deutschen Bischöfe dazu einstimmig und luden zum Gespräch darüber ein, wie eine solche Lösung aussehen könnte.
Tatsächlich müssen sowohl kirchliche als auch staatliche Repräsentanten an einer konsensualen Lösung interessiert sein: Für den Staat geht es um die Glaubwürdigkeit der Lösung und um die gesellschaftliche Akzeptanz des mühsam erzielten Kompromisses. Für die Kirche geht es um die Lösung dieses moralischen aber auch kircheninternen Konflikts, in dessen Vorfeld mehrere verbale Entgleisungen geschehen waren.
Bayerngesetz gekappt Neben der politischen Diskussion der letzten Tage schwelt in der Abtreibungsfrage eine weitere Auseinandersetzung rund um das Bundesverfassungsgericht. Dieses hat auch in den vergangenen Monaten wiederholt zu Fragen um die Abtreibung Stellung genommen.
1997 beschäftigte das Gericht ein bayrisches Sondergesetz, das insbesondere vorsah, daß ein Arzt nicht mehr als 25 Prozent seines Einkommens aus Abtreibung erzielen dürfe, was auf die Schließung von zwei Abtreibungskliniken hinausgelaufen wäre. Die beiden betroffenen Ärzte klagten dagegen und erreichten eine einstweilige Verfügung, wonach dieses Gesetz wahrscheinlich im Gegensatz zum Bundesrecht steht (nach deutschem Recht bricht Bundesrecht Landesrecht). Die Ärzte können ihre Praxen vorerst weiterführen.
Heftiger Kritik setzte sich das Verfassungsgericht aus, als Erster und Zweiter Senat offensichtlich einander widersprechende Entscheidungen fällten. Es ging darum, ob ein ärztlicher Fehler - etwa bei einer Sterilisation oder bei einer Abtreibung - Schadenersatzforderungen nach sich ziehen könnte. Dieser Schadenersatz wäre unter anderem der Unterhalt für ein Kind.
Der Zweite Senat hatte dies 1995 verneint. Ein ungewolltes Kind könne nach der deutschen Rechtsordnung nicht als Schadensquelle gewertet werden.
"Schadensquelle" Kind Im Dezember 1997 entschied der Erste Senat, der Vertrag zwischen dem Patienten und dem Arzt ist von ihm nicht erfüllt worden, daher muß der Arzt Schadenersatz bezahlen. Dabei ging es einmal um eine Sterilisation, die zum Zweck der Familienplanung erfolgt war, in einem anderen Fall um die Geburt eines Kindes, das die gleiche Behinderung hatte, wie die ältere Schwester. Der Arzt hatte eine solche Behinderung als sehr unwahrscheinlich bezeichnet.
Der Konflikt zwischen den beiden Senaten ist bisher in der deutschen Rechtsgeschichte einmalig (in der österreichischen hatte es ähnliches zur Frage der damals unmöglichen Scheidung in der Ersten Republik gegeben). Nach praktisch einhelliger Auffassung hätte der Zweite Senat das Plenum anrufen müssen, wollte er von einer Auffassung des anderen Senates abgehen, die dieser als "tragende Rechtsansicht" gezeichnet hatte. Offensichtlich war in dieser Angelegenheit dem Senat die Entscheidung in der Sache wichtiger als die Aufgabe des Gerichts, für Rechtseinheitlichkeit zu sorgen, wie die "Frankfurter Allgemeine" in einem Kommentar bemerkte.
Die juristische und politische sowie die kirchendisziplinäre Diskussion, die in Deutschland in bezug auf die Abtreibung herrscht, ist nur das äußere Zeichen dafür, wie weit die Gesellschaft von einem moralischen Konsens in dieser Frage entfernt ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!