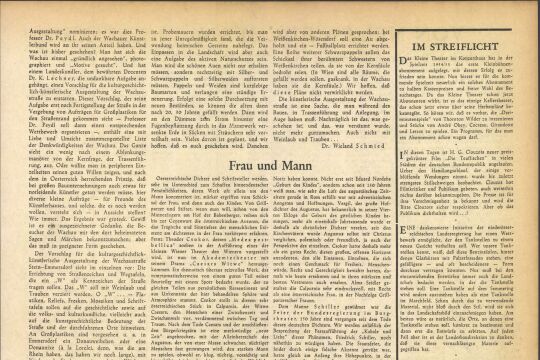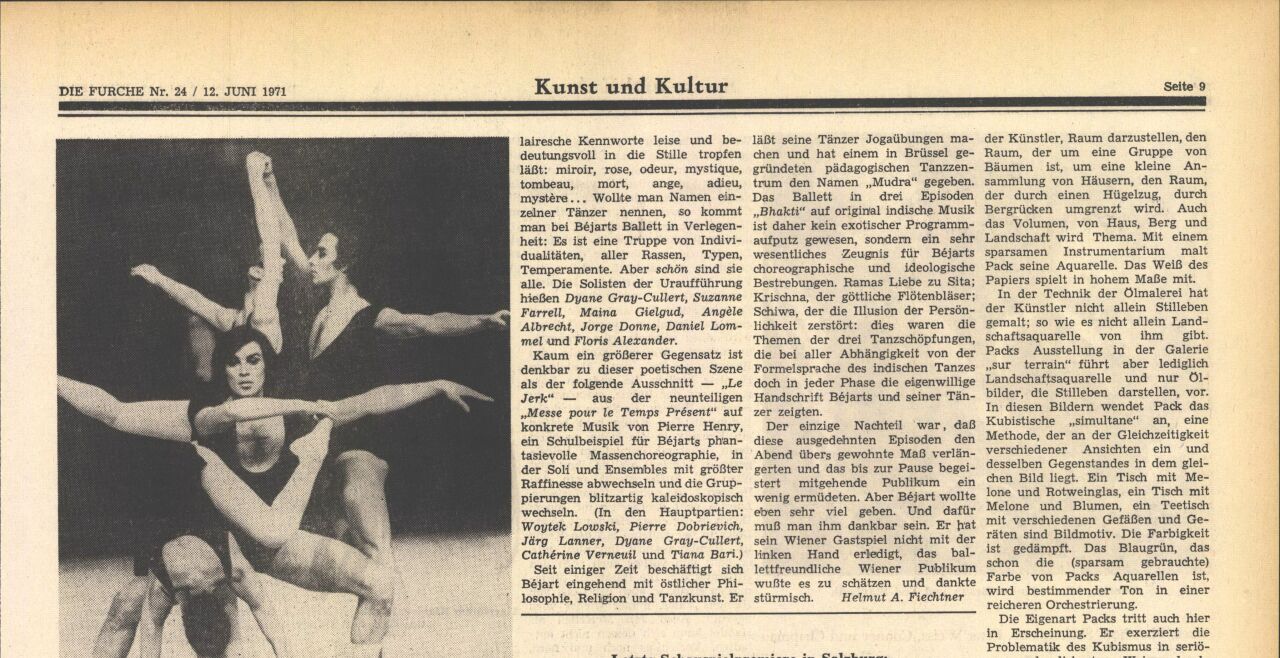
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schiller tur die Gegenwart
Was man so als Pflichtlektüre in der Mittelschule absolvieren mußte,, des wird man im Theater kaum froh. Allzu pathetisch hatte man die Stücke deutscher Klassik in Erinnerung, gezwungenermaßen beschäftigte man sich mit Fragen, die begannen „Inwieweit ist Teil… Was hat Goethe bewogen… und: Warum ist Schiller so zeitgemäß?“
Gerd Potyka setzte Schillers bürgerliches Trauerspiel „Kabale und Liebe“ so in Szene, daß man in Salzburg eigentlich aufatmen konnte. Denn er hat des Stürmers und Drängers letztes Stück seiner vorwärts- presch enden und ausbrechenden Periode durchaus nicht zimperlich, aber mit Verstand und Gefühl entrümpelt, reduziert, den Klassiker wirklich als Klassiker und vor allem als bühnenwirksamen Autor erstehen lassen.
Das zweite Plus dieser Aufführung im Landestheater resultiert aus zwei vollkommen unpathetisch verstandenen Rollenauffassungen. Einmal hat Johannes Schütz eine seiner besten Leistungen im- Laufe seiner Salzburger Engagements als Präsident auf die Bühne gestellt. Da stimmt einfach alles. Er ist unsentimental und durchtriebener Machtmensch, der alles angeblich nur für seinen Sohn tat. Dieser Ferdinand ist von Gerhard Balluch sorgfältig einstudiert und interpretiert, der junge Fant mit dem Übermaß an Ehrgefühl steht korrekt in diesem Spiel zwischen Liebe und Macht an seinem Platz.
Die zweite äußerst sympathische Auffassung einer Rolle nach Schütz gibt Georges Ourth als Wurm. Da ist nichts von dem mephistophelischen Bösewicht, sondern da steht ein Mann, der seinen Chef mit hochgebracht hat, der ihnaus diesem Grund jederzeit beherrscht und sogar imstande ist, seine Fehler auszumerzen. Die Wahl der Mittel hierzu ist ihm freilich gleichgültig.
Dieser durchaus ordentlichen Besetzung der Hauptrollen ist noch die Luise Rosemarie Schrammels hinzuzufügen, die zwischen Adel der Seele und bürgerlicher Herkunft hin und her pendelt. Herzlich in seiner robusten Art Vater Miller von Alfred Schnös, Isolde Stiegler versuchte als seine Frau das Schlampige und Unsympathische herauszuarbeiten. Antje Geerk, neu im Haus an der Schwarzstraße, kam mit der Lady Milfprd. kaum zurecht, ebensowenig Hermann Schober mit dem, Kammerdiener des Fürsten — die Szene mit dem Schmuck geriet ärmlich. Das Bühnenbild von Franz Weizner knüpft an Vorhandenes an, ungemütlich das Zimmer der Lady, kalt wie der Präsident sein Arbeitsraum, voll Stimmung, die an Gorkis „Nachtasyl“ erinnert, die Stube bei Miller. Die Kostüme von Hildegard Dicker schmeichelten der Lady, Luise und der Millerin. Unigekonnt die Ton- bandeinblendungen mit der Zwischenmusik. Aber: ein erfreulicher Abend, weil der Schiller dieser Gegenwart erträglicher ist als jener der Pennälererinnerung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!