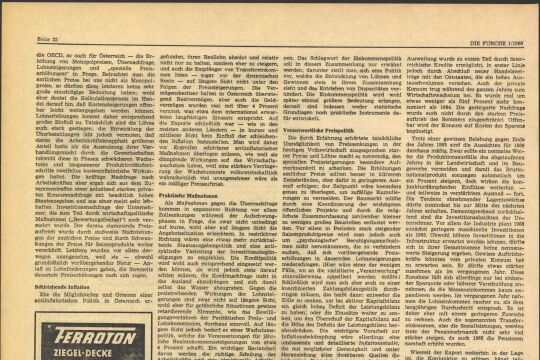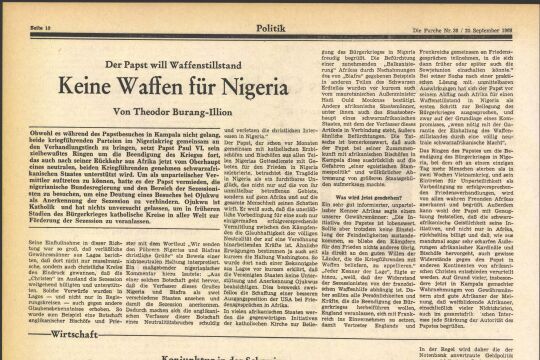Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stirbt ein harter Schilling am chronischen Defizit?
Wenn der Dollarkurs an der Börse lediglich um 10 Prozent sinke, bedeute dies für seine Firma - auf das Jahr umgerechnet - einen Einnahmeverlust von 4,5 Millionen Schüling, erklärte dieser Tage der Generaldirektor der Chemiefaser Len-zing AG, eines der potentesten Unternehmen Österreichs und eines unserer wichtigsten Devisenbringer.
So wie er argumentieren viele Firmenleiter - gleichgültig, ob es sich um private oder verstaatlichte Unternehmen handelt. Gerade in Kreisen der Exportwirtschaft - und zu ihr gehören in erster Linie die leistungsfähigsten und erfolgreichsten österreichischen Unternehmen - wird gegen die „starre Bindung“ des Schillings an D-Mark und Schweizer Franken opponiert, weil dadurch die internationale Konkurrenzfähigkeit Österreichs in Frage gestellt werde.
Derartige Argumente finden eine objektive Bestätigung in der Entwicklung der österreichischen Handelsbilanz: Während im abgelaufenen Jahr die Exporte um 6,4 Prozent auf 162 Milliarden Schilling gestiegen sind, erhöhten sich die Importe um nicht weniger als 14 Prozent auf 235 Müliarden. Das Defizit machte bereits 73 Milliarden Schilling aus und war um nahezu 50 Prozent höher als im vorhergegangenen Jahr.
Zu Beginn dieses Jahres verbesserte sich die Relation zwischen Export und Import zwar ein wenig - was angesichts der im Vorjahr erfolgten Vorziehkäufe im Hinblick auf das zweite Abgabenänderungsgesetz, speziell bei Automobüen, aber auch bei anderen Waren zu erwarten gewesen ist. Dieser künstliche Effekt verliert aber mit der Zeit seine Wirksamkeit, und der bisherige Trend findet seine Fortsetzung.
Der Grund für das weiterhin zunehmende Handelsbilanzdefizit - dies läßt sich nicht wegeskamotieren - ist der, wie die Exporteure es nennen, „unrealistische Wechselkurs“. So lange die österreichische Währungspolitik an einem Wechselkurs festhalte, welcher der tatsächlichen Kaufkraft des Schillings nicht mehr entspreche, so lange werden unsere Handels- und unsere Leistungsbüanz immer tiefer in die roten Zahlen rutschen. Betroffen sind von dieser Entwick-
lung nicht „nur“ die Exporteure, sondern auch die Anbieter auf dem Inlandsmarkt, auf dem ihnen die unter günstigeren Kostenkonditionen produzierte Auslandsware immer stärkere Konkurrenz macht. Betroffen ist nicht zuletzt auch der Fremdenverkehr, dessen Leistungen infolge der hohen Schillingparität vielen Ausländern bereits unverhältnismäßig teuer erscheinen.
Auf der anderen Seite plädiert Finanzminister Hannes Androsch unvermindert für den „harten“ Schilling und für einen möglichst engen Währungsverbund mit Deutschland und der Schweiz. Er wird dabei eifrig von Nationalbankpräsident Stephan Koren sekundiert.
Auch sie haben gute Argumente:
Wenn die österreichischen Inflationsraten im westeuropäischen Vergleich nach wie vor niedrig sind, so ist dies dieser Wechselkurspolitik zu verdanken. Androsch spricht sogar offen von „importierter Stabüität“.
Tatsächlich müßte eine Lockerung der Bindung an D-Mark und Franken fatale Folgen haben: Vergessen wir nicht, daß etwa 60 Prozent unserer Importe aus der Bundesrepublik und der Schweiz stammen.
Eine stärkere Angleichung der Schü-lingparität an den Dollar und andere Weichwährungen müßte zu einer konstanten Verteuerung der Importwaren aus diesen beiden Relationen führen, was wieder eine Beschleunigung der Inflation nach sich ziehen müßte.
Abwertungen — auch wenn es ledig-
lieh „relative“ sind - bringen keine Lösung des Außenhandelsproblems. Dies hat sich in allen Staaten gezeigt, welche auf diese bequeme Manier ihre Devisensorgen los werden wollten.
Hat also Androsch doch recht? Ja und nein. Er selbst liefert uns den Schlüssel zum Problem, wenn er von der „importierten Stabüität“ spricht. Ja, unsere - relative - Stabüität ist importiert, fatalerweise ausschließlich importiert. Wenn unsere Inflationsraten verhältnismäßig niedrig sind, so ist dies nur der Fall, weü wir an der Stabilität von Franken und D-Mark mitnaschen. Eine interne Stabüitätspolitik ist hingegen schmerzlich zu vermissen.
Bereits vor Jahren bezeichnete die „Furche“ den Schüling als eine „Auster“, welche zwar eine harte Schale besitzt, innen aber weich ist. Und prophezeite - und dies war gar nicht schwer -, daß dies auf die Dauer nicht gut gehen kann. Den Wähler mag man vielleicht mit einer derartigen Pseu-do-Stabilitätspolitik, die sich nur auf den Wechselkurs abstützt, täuschen können, die Handels- und Leistungsbilanz nicht. Dort schlägt sich ein solcher währungspolitischer Pfusch in der explosionsartigen Steigerung der Defizite nieder.
Wechselkurspolitik kann immer nur eine flankierende Maßnahme sein, welche die interne Stabilitätspolitik unterstützt. Wenn aber im Inland eine inflationstreibende Schulden- und Kostensteigerungspolitik munter drauf los betrieben wird, wenn vor allem die österreichischen Inflationsraten deutlich über denjenigen der Deutschen und der Schweizer liegen, werden auch unsere Außenschulden immer stärker ansteigen und uns letzten Endes eine Schillingabwertung aufzwingen, ob wir diese nun wollen oder nicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!