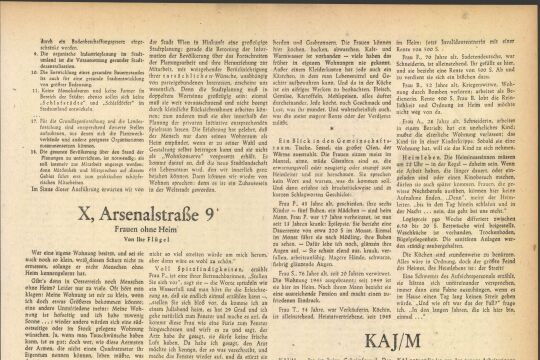Leben im Schubkarren
Nachts schlafen sie in Schubkarren, tagsüber sammeln sie darin Abfall. Alltag für etwa 5000 Familien in Manila. Die Regierung will sie von der Straße holen - auch mit Gewalt.
Nachts schlafen sie in Schubkarren, tagsüber sammeln sie darin Abfall. Alltag für etwa 5000 Familien in Manila. Die Regierung will sie von der Straße holen - auch mit Gewalt.
Seit vier Monaten ist die Holzplatte auf dem Gehsteig, über den eine Plastikplane gespannt ist, das Zuhause von Joel und Apple. An ihrem Lager brausen jeden Tag tausende Autos vorbei und blasen Abgase in ihre Kleider, die an der Wäscheleine hängen. Hier, neben einer viel befahrenen Straße mitten in der philippinischen Hauptstadt Manila, dienen die Kleider auch mehr als Sichtschutz, um ein wenig Privatsphäre zu simulieren. "An den Lärm und den Staub haben wir uns gewöhnt", sagt Apple resignierend. Ihr zweijähriger Sohn zappelt in ihren Armen. Schließlich gibt sie ihm die Brust. Joel und Apple sind nicht groß geworden, sie werden in ihrem Leben auch nichts Großes erreichen. Das Leben auf der Straße hat ihre Gesichtszüge gehärtet, wodurch sie älter aussehen als die 30 und 32 Jahre, die sie angeben zu sein.
Joel und Apple gehören zu den etwa 4000 bis 5000 "Schubkarren-Familien", die auf den Straßen Manilas leben. Sie heißen so, weil ihre gesamte Existenz von einem Schubkarren aus Holz abhängt, mit dem sie tagsüber durch die Straßen ziehen und in dem manche von ihnen nachts auch schlafen. Tagsüber sammelt Joel Sperrmüll, Plastikflaschen, Kartons und alte Zeitungen ein, die er in einem Altwarenladen verkauft.
"Für ein Kilo Plastikflaschen bekomme ich 10 Pesos", sagt Joel - das entspricht knapp 2 Cent. Ein Kilo Zeitungen bringt nur die Hälfte. Die Menge, die er täglich sammelt, hängt davon ab, wie viel ihm die Menschen geben. Mit seinem Schubkarren zieht er von Haus zu Haus und fragt nach Abfall. Auch bei kleinen Händlern fragt er nach. Müllsammler wie er sind meistens an einen bestimmten Altwarenladen gebunden, wo sie den Schubkarren erhalten haben. Nur dort dürfen sie ihr Gesammeltes verkaufen und müssen außerdem zehn Prozent des Wertes an den Ladenbesitzer abgeben. Was am Ende des Tages übrig bleibt, reicht oft nicht, um die Familie ausreichend zu ernähren.
"Meistens essen wir nur Reis", sagt Apple. "Manchmal gibt es Suppe." Auch für die Suppe dient Reis als Basis, der zu einem Brei verkocht wird.
93 Millionen unter Armutsgrenze
Laut den offiziellen Daten lebt über ein Viertel der etwa 93 Millionen Filipinos unter der nationalen Armutsgrenze. Das heißt, sie haben im Monat weniger als 1400 Pesos (25 Euro) zur Verfügung. Am stärksten sind die ländlichen Regionen betroffen, wo die Asiatische Entwicklungsbank 56 Prozent der Haushalte als arm einstuft. Viele Menschen aus den Provinzen zieht es daher in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Hauptstadt. Doch der philippinische Traum endet oft auf der Straße. Offiziell leben in Manila zwölf Millionen Menschen, berücksichtigt man die Bevölkerung in den Slums, könnten es aber bis zu 20 Millionen sein. Jene, die sich nicht in den Slums ansiedeln, landen auf der Straße. Die Stadtbehörden wollen sie dort aber nicht haben, ihre Lebensweise störe den öffentlichen Raum.
Joel und Apple haben deshalb gelernt, so wenig wie möglich aufzufallen. "Tagsüber kehren wir den Gehsteig und räumen unsere Sachen zur Seite", sagt Apple. "Wir wollen ja auch nicht, dass es hier unordentlich und schmutzig ist." Ihre größte Angst ist es, Opfer von sogenannten "Rettungsoperationen" zu werden, in denen die Stadt verwaltung gemeinsam mit dem Sozialministerium und der Polizei die Menschen verhaftet und schließlich in die Provinzen zurückschickt.
Auch wenn Joel und Apple selbst noch nicht aufgegriffen wurden, sahen sie die Gefahr in ihrer unmittelbaren Nähe. "Zwei Straßen weiter zerstörten die Behörden gleich mehrere Lager und nahmen die Leute fest", sagt Joel. Der Anrainer, ein Busunternehmen, hatte sich wegen der Straßenfamilien beschwert. Ihre Anwesenheit würde dem Geschäft schaden, hieß es.
"Die Menschen werden wie Kriminelle behandelt", sagt Jerel vom Kariton Empowerment Center, einer Organisation, die sich für die Schubkarren-Familien einsetzt. "Niemand fragt sie, ob sie überhaupt gerettet werden wollen." Das Kariton Empowerment Center informiert die Menschen über Grundrechte, die ihnen auch als Straßenbewohner zustehen, wie die Rechte auf eine menschenwürdige Unterkunft und auf Arbeit. Daneben gibt die Organisation Jobtrainings, die den Menschen alternative Einkommensquellen schaffen sollen, wie Nähen oder Schweißen. Anders als Joel und Apple, die sich eine relativ feste Unterkunft gebaut haben, führen andere Straßenfamilien ein Nomadenleben. Sie ziehen ständig mit ihren Schubkarren umher und schlafen nachts darin. Ein Versuch, den oft gewaltsamen Rettungsaktionen zu entgehen. "Das macht auch unsere Arbeit schwieriger, da die Familien nicht so leicht zu finden sind", sagt Jerel, dessen Blicke an der achtspurigen Hauptverkehrsstraße entlang wandern. Lastwagen und Busse rasen hupend vorbei, während aus den Auspuffen schwarzer Rauch quillt. Über der Straße verläuft die Hochbahn der Stadt.
Schließlich steht am Straßenrand ein einsamer Schubkarren. Eine blaue Plastikplane ist als Dach darüber gespannt, an den Seiten hängen Plastiksäcke, in denen Geschirr, Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände verstaut sind. Daneben sitzt die 18-jährige Joan-April mit dickem Bauch. Auf ihrem Schoß ihre acht Monate alte Tochter, mittlerweile ist Joan-April zum zweiten Mal schwanger. "Seit ich neun Jahre alt bin, kenne ich nur das Leben auf der Straße", sagt sie mit leiser Stimme und blickt den vorbeifahrenden Autos nach. "Mein Vater hat bereits vom Müllsammeln gelebt." Während ihr Mann unterwegs ist, um Müll zu verkaufen, sitzt sie täglich am Straßenrand und hofft auf Spenden von Passanten. "Ab und zu geben mir die Leute Geld", sagt sie.
Im Auffangzentrum
Währenddessen sitzt Ilene Lotino vom Sozialministerium in einem Großraumbüro, abgeschirmt vom Trubel und der Hitze auf den Straßen. Die Klimaanlage ist so kalt eingestellt, dass sich einige der Mitarbeiter Jacken übergezogen haben. Lotino arbeitet in der Abteilung "Spezielle Projekte" und ist für die "Rettungsaktionen" im Großraum Manila zuständig. "Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass das Leben auf der Straße nicht gesund ist", sagt sie. Lotino ist zierlich und spricht mit strenger Stimme. Sogar sie weiß, dass die "Rettungsoperationen" keinen guten Ruf mehr haben. Deshalb heißen sie jetzt "reach-out operation", was so viel bedeutet, wie jemandem die Hand reichen. Der Unterschied ist ein minimaler, nun ist bei den Aktionen auch ein Sozialarbeiter anwesend. Außerdem würde man mit den betroffenen Familien reden. "Wehren sich die Menschen dennoch, muss Gewalt angewendet werden." Außerdem erklärt Lotino, warum die Anwesenheit von Sicherheitsbeamten notwendig sei:
"Zum Schutz der Sozialarbeiter. Denn man weiß nie, was in den Köpfen der Menschen vorgeht." Mit dieser Haltung folgen die Behörden den üblichen Vorurteilen gegenüber Straßenfamilien - dass sie kriminell seien, schmutzig und faul.
Aufgegriffene Familien landen schließlich in Aufnahmezentren wie dem Jose Fabella Center (JFC). Dort warten sie auf die Rückführung in ihre Provinzen - in Gesellschaft mit psychisch kranken Obdachlosen.
Ursprünglich war das JFC ein Diagnosezentrum, das ausschließlich Erwachsene beherbergte. 220 Personen können offiziell untergebracht werden. "Manchmal haben wir auch 300 bis 400 Klienten", sagt Laurence Dy, der Leiter des Zentrums. Gut gelaunt führt er durch das Gelände. Immer wieder betont Dy, dass es die Menschen in diesem "schönen Umfeld" viel besser hätten als auf der Straße.
Bedrückender Ort
Dys gute Laune kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Zentrum ein bedrückender Ort ist. In den Gebäudeeingängen sitzen Menschen mit apathischem Blick.
Der Geruch ungewaschener Körper und alter Kleidung zieht sich durch die Räume. Außer Stockbetten und einem Fernseher gibt es keine Einrichtung. Der Schlafsaal wird nachts von außen verriegelt: "Zum Schutz der Klienten", sagt Dy. "Bei den Behörden ist die Idee, den Menschen auf diese Art zu helfen, bereits fest verankert", sagt Jerel vom Kariton Empowerment Center. "Die Regierung hat kein umfassendes Programm, um diesen Menschen zu helfen", sagt Jerel. Das Kariton Center versucht daher die Menschen zu motivieren, selbst Alternativen zum Leben auf der Straße zu suchen.
Eine Kariton-Imbissstube ist ein Beispiel für solche Alternativen. "Alle Angestellten lebten früher auf der Straße", sagt Jerel und zeigt auf die lächelnden Frauen in grünen Schürzen und Haarnetzen. Das nächste Projekt soll ein kleines Altstoffsammelzentrum sein, das von Schubkarren-Familien geleitet wird. Damit nutzen sie das Potential ihrer Hauptbeschäftigung, dem Müllsammeln. "Viele Leute verstehen nicht, dass die Straßenbewohner zur Mülltrennung beitragen", sagt Jerel. "Sie wissen genau, was wieder verwertbar ist und was nicht." Er sieht in den Müllsammlern sogar das Potential zum Umweltschützer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!