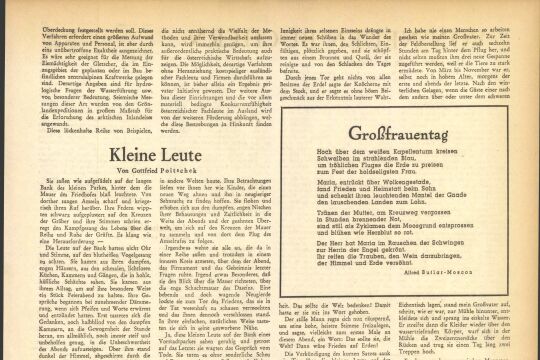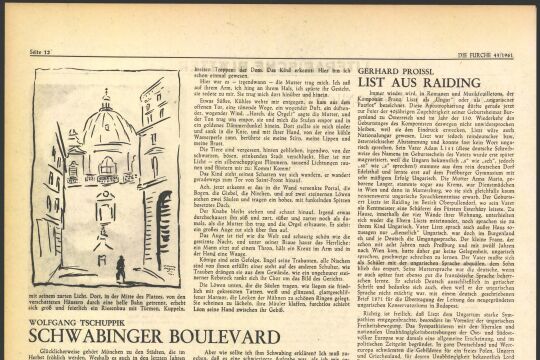Spuren von einst
FOKUS
Erinnerungen an Sarajevo: Die Tauben auf dem Sebilj
FURCHE-Redakteurin Manuela Tomic wurde in den 1980er Jahren in Sarajevo geboren. Bald darauf brach der Jugoslawien-Krieg aus. Über eine Kindheit im Konjunktiv, fragile Identitäten und die Suche nach Geschichten.
FURCHE-Redakteurin Manuela Tomic wurde in den 1980er Jahren in Sarajevo geboren. Bald darauf brach der Jugoslawien-Krieg aus. Über eine Kindheit im Konjunktiv, fragile Identitäten und die Suche nach Geschichten.
Wenn ich meine Augen schließe, höre ich bellende Straßenhunde aus verwinkelten Gassen. Ich höre Katzen über Gräber schleichen, ein leises Rascheln, zwischen gurrenden Tauben am Brunnen „Sebilj“. In dieser Stadt sprechen nur die Tiere, während die Menschen schweigen. Sie haben sich nichts mehr zu sagen, nippen stattdessen in der Altstadt, der Baščaršija, an ihrem schwarzen Kaffee. Nur die Muezzine rufen kläglich in die ankommende Nacht.
Ich höre das Plätschern des Sebilj-Brunnens im Herzen der Stadt, der vor allem Reisenden, so die Legende, Wasser schenken soll. Ein Sprichwort sagt, dass jeder, der aus diesem Brunnen trinkt, irgendwann wieder nach Sarajevo zurückkehren wird. Dieser hölzerne Brunnen in Form eines Kiosks, um den sich Männer mit Säcken voll Taubenfutter scharen, er ist meine Luke in eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Der Sebilj, Sarajevos Wahrzeichen, hat den Krieg überdauert. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto weilen Menschen wie kleine Schachfiguren auf Pflastersteinen, und Schnee legt sich wie ein schützender Helm über die Kuppel des Brunnens.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Meine Geburtsstadt Sarajevo hat für mich zwei Gesichter: eines vor und eines nach dem Krieg. An jenes vor dem Krieg kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war das wohl für eine Stadt, als mich Mutter an einem Julitag 1988 im Entbindungsheim Jezero, einem monolithartigen Betonklotz, zur Welt brachte?
Ich fiel in die warmen, weichen Hände einer Hebamme namens Alma. Sie hatte dichtes schwarzes Haar, große runde Augen und eine helle Stimme. Es war ein greller Montagmorgen, der mich bei meiner Ankunft blendete. Draußen gingen die Erwachsenen ihrer Arbeit nach, die Kinder in die Schule. Ich höre, noch immer mit geschlossenen Augen, meine eigenen Schreie. Dann verschwindet Alma, gemeinsam mit meinen Erinnerungen, hinter einem Milchglas.
Da Vincis Geier
Wer sich nicht erinnert, hat keine Identität. Oder etwa doch? Dann nämlich bleibt Raum für Geschichten, die gelesen, gehört, geliehen sind, wie jene von Leonardo da Vinci. In einer seiner wissenschaftlichen Schriften schreibt der große Maler über eine frühe Kindheitserinnerung: „(...) als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinem Schwanz gegen meine Lippen gestoßen.“ Diese abstruse bedrohliche Schilderung war für Sigmund Freud gefundenes Fressen. 1910 schrieb er eine Abhandlung über diese wirre Erzählung. Es wundert nicht, dass sie im Sinne Freuds sexuell gedeutet wurde. In einer Sache ist sich der Vater der Psychoanalyse aber sicher: Diese Säuglingserinnerung könne nicht echt sein. Vielmehr sei sie eine Phantasie, die da Vinci später gebildet und in seine Kindheit versetzt habe. Sind wir beim Erinnern unserer Einbildungskraft näher als den tatsächlichen Begebenheiten? Dichte auch ich immer etwas Neues hinzu?
Mein bedrohlicher Geier ist ein alter Mann mit buschigen Augenbrauen. Er war ein Bekannter meiner Eltern. Mutter prophezeite er, sie würde ein „schwarzhaariges Mädchen mit dunklen Augen“ zur Welt bringen. Als ich, schwarzhaarig und mit dunklen Augen, auf die Welt kam, wollte er mich begrüßen, doch ich hatte so große Angst, dass ich einen entsetzlichen Schrei losließ. Der alte Mann hatte tiefe Linien, die wie Grenzen sein Gesicht zeichneten. Erzählten sie Geschichten über unsere Zukunft?
In den 1970er Jahren war diese Zukunft noch weit weg. Jugoslawien war dem Musik-Rausch verfallen und auch meine Eltern tummelten sich auf Rockkonzerten. Ein wilder Sänger namens Zdravko Čolić, der neue Popstar einer jungen Generation, tanzte im roten Leder-Overall auf der Bühne. Mein Vater raste mit seinem Fićo, einer kleinen blauen Kiste, durch kurvige Straßen, trank Rakija und warf aus Liebeskummer leere Bierflaschen gegen vertäfelte Wände verrauchter Bars. Die Stadt war reich an Stimmen, die wie Stromschläge durch die Straßen blitzten. Kaum vorstellbar, dass wenige Jahre später absolute Stille Einzug halten sollte.
Jergovićs Kaktus
Wie aber die Stille beschreiben? In seinem Roman „Sarajevo Marlboro“ erzählt der Schrifsteller Miljenko Jergović über die Belagerung Sarajevos. Er schreibt über einen Kaktus, für dessen Pflege der Ich-Erzähler sein Leben riskiert und über dessen Freundin, die die Stadt schon verlassen hat: „Alle fünf Tage ging ich hoch und goss den Kaktus. Jetzt krümmte er sich zu den Stellungen der Tschetniks hin. Ich schaute angestrengt gegen die Sonne und rechnete jeden Moment mit einer Kugel. Unten war es warm, feucht und anheimelnd. Es roch nach faulen Kartoffeln, Kohlenstaub reizte die Augen. Eine Gebärmutter kann nicht gemütlicher sein. Meine Freundin war überzeugt, dass der Tod nur in Sarajevo wohne. Sie wurde pathetisch und war ganz weit weg. Sie fragte, ob ich mit ihr nach Neuseeland gehen würde. Ich sagte, ich würde im Keller wohnen, das Land sei sehr weit weg, und ich könne mir nicht vorstellen, dort besonders glücklich zu sein. Nach dem Kaktus fragte sie nie. Ich erwähnte ihn nicht.“
Mit 1425 Tagen war die Belagerung Sarajevos, die im Frühjahr 1992 ihren Ausgang nahm, die längste des vergangenen Jahrhunderts. Sie endete am 29. Februar 1996. Im Juni ebendiesen Jahres fotografierte der Schotte Jim Marshall die vom Krieg gezeichnete Innenstadt, in der sich Ruinen wie Dominosteine aneinanderreihten. Das berühmte Holiday-Inn, das Parlament und die UNIS-Türme, das World Trade Center Sarajevos, lagen in Trümmern; die Ringe des Olympischen Dorfs am Rande der Stadt waren durch Einschusslöcher entzweit. 15 Jahre später lichtete Marshall dieselben Orte noch einmal ab. Strahlende Neubauten wichen den Ruinen und beendeten ein Kapitel, an das sich vor allem jene, die dageblieben sind, nicht mehr erinnern wollen.
Großmutters Fußstapfen
Sich zu erinnern, scheint heute hinfällig. Wenn ich nach Sarajevo google, kann ich mir die Stadt durch die Jahrzehnte ansehen. Ich klicke mich durch den Bazar, durch Menschenmassen, Männer mit Eseln, bettelnde Kinder, Teppiche, frisches Obst und alte Weberinnen. Ich folge den Spuren dieser Bilder, und höre, immer noch mit geschlossenen Augen, die Fußstapfen meiner Großmutter im Schnee. In einem kleinen Dorf zog sie drei Kinder alleine auf, weil mein Großvater früh verstarb. Sie schickte meine 14-jährige Mutter nach Sarajevo, damit sie eine Textil-Fachschule besuchen konnte, und gab sie in die Obhut einer alten Frau. Von da an musste Mutter in der großen Stadt alleine zurecht kommen. Bald darauf lernte sie Vater kennen.
Viele Jahre später reiste ich als junge Studentin in meine Geburtsstadt. Mit meinem guten Freund Dželil stand ich eines Nachts auf einem sandigen Hügel und blickte auf Sarajevo hinab. Wir starrten hinunter auf die muslimischen Gräber, deren schlichte weiße Grabsteine in den Himmel schossen. Darunter wirkten die Häuser winzig klein. Wie Mondscheinmurmeln leuchteten sie in den schwarzen Wald. „Ich werde hier nie wegziehen“, sagte Dželil. Ich folgte seinen Worten, doch sie blieben mir fremd. Dželil erinnerte sich zwar an alles, aber er sprach nicht darüber. Stunden später stiegen wir vom Hügel herab und Dželil zeigte mir, wo es den besten Schwarztee gibt. Die Stadt war voller amerikanischer und australischer Touristen mit dicken Europa-Reiseführern. Dželil verabschiedete sich und verschwand lächelnd im Gewimmel.
Ich blickte ihm nach. Wie ein Schwarm zogen mich die vielen Touristen wieder ins Zentrum. Dort leuchtete der Sebilj, um den, wie auf dem Schwarz-Weiß-Foto, Menschen neben gurrenden Tauben weilten. Es war ein heißer Juliabend und ich dachte an die Kinder, die in dieser Sekunde im Entbindungsheim Jezero auf die Welt kommen. Woran werden sie sich erinnern? Meine Kindheit in Sarajevo bleibt ein Mosaik aus geliehenen Geschichten. Ich gehe zum Brunnen und nehme einen großen Schluck kühles Wasser. Wenn die Legende stimmt, werde ich wiederkommen.
Am 19. Dezember um 21:40 Uhr wird der Prosatext „Blaupausen“ von FURCHE-Redakteurin Manuela Tomic in der Ö1-Sendereihe „Neue Texte“ präsentiert. Mehr unter oe1.orf.at.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!