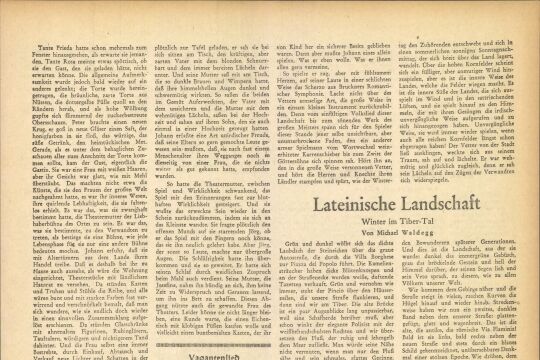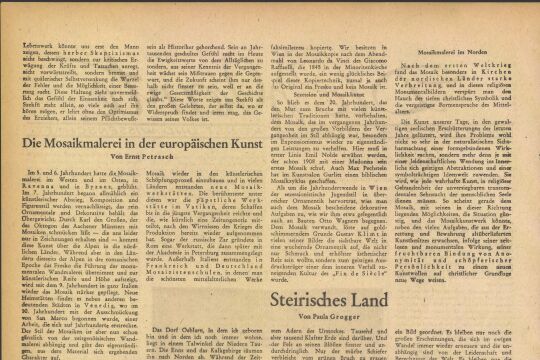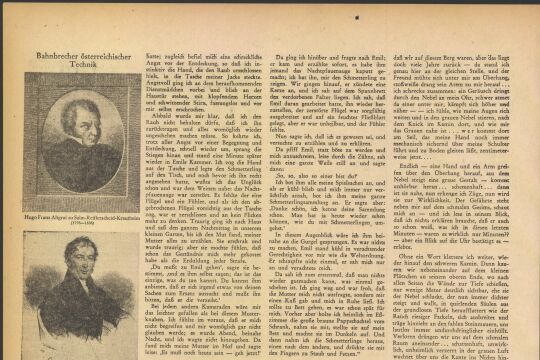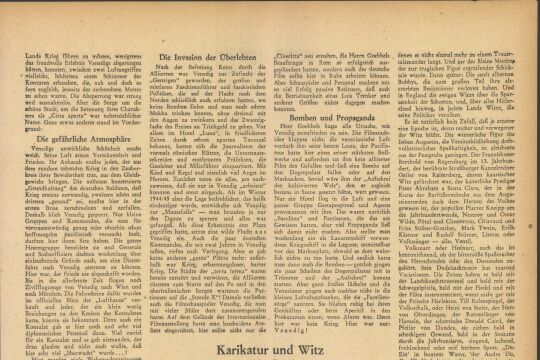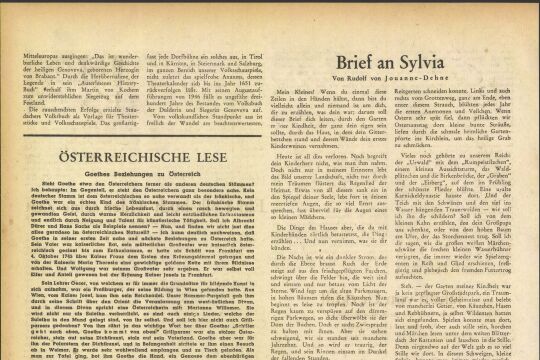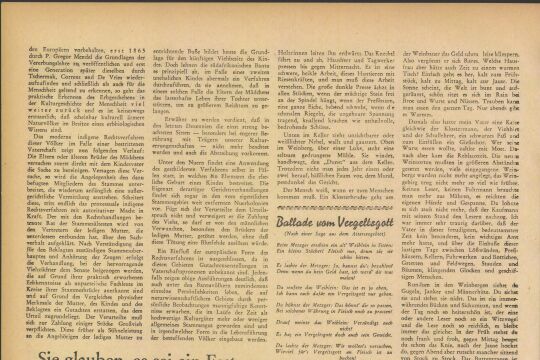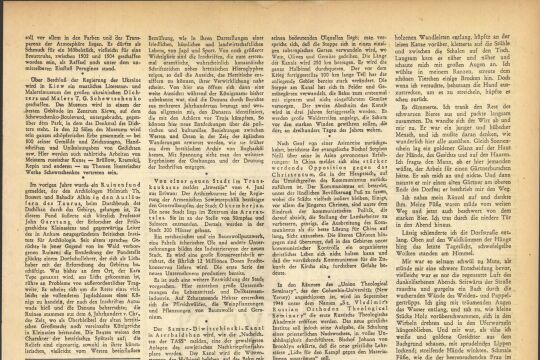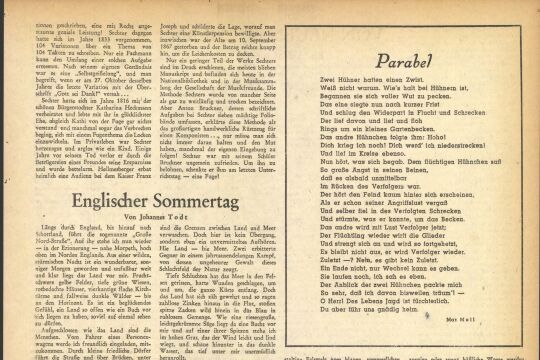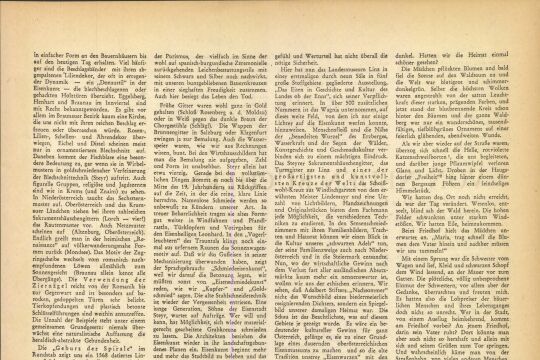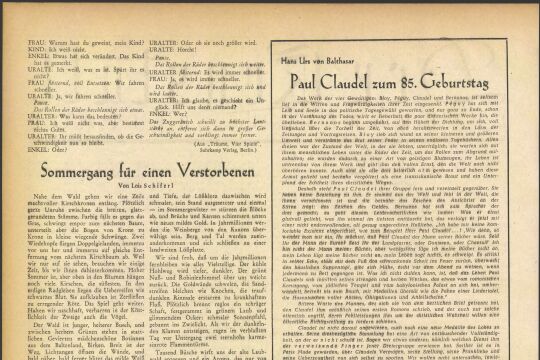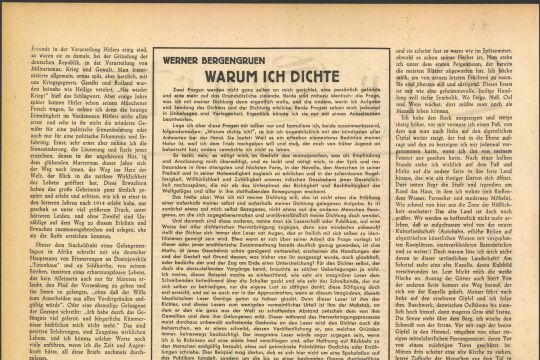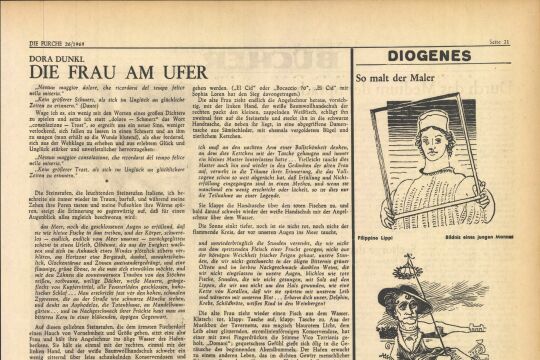Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine stille Straße am Rande von Wien
Das Wasser des Bisamberges hat sie ausgeschwemmt, bevor die Menschen sie zu nutzen begannen, „meine" Straße, die ungewöhnlichste Straße in Wien, von der ich nicht ahnte, daß es sie gibt, und doch ist sie sofort mit allen Zeiten anwesend, kaum bin ich einige Schritte weit gegangen. Irrte ich mich, oder irrte sie sich?
Ich betrat die Straße von oben. Am Anfang, der eigentlich ihr Ende ist, tarnt sie sich mit einigen häßlichen Häuschen, dann aber verbirgt sie nichts mehr von ihrer Schönheit. Leicht abfallend zieht sie sich zur Stadt hinunter, ist hier tief eingeschnitten, links und rechts Hänge, erdig, sandig, sie geben die Wurzeln der Sträucher und Bäume frei, die stellenweise ein Dach formen, durchsichtiges Dach, unerreichbar wie der Himmel darüber, gewölbtes Dach über der schmalen Straße. Jetzt, im Herbst, rascheln die Blätter, viele sind noch grün, viele bereits von einem strahlenden Hellgelb, nur die Blätter der vereinzelt stehenden Kastanienbäume verfärben sich braun, von den Spitzen her.
Das Kopfsteinpflaster hallt, ich drehe mich um, eine Frau läuft auf mich zu, ohne mich zu bemerken, läuft an mir vorbei, erstaunt betrachte ich sie, ihre Hast wirkt in der Abgeschiedenheit und Stille dieser Straße auf mich befremdend. Ihr Atem hinterläßt einen schmalen Kondensstreifen, in ihm versammeln sich die Mücken, Heuschrecken springen hoch und nehmen ein kurzes Bad, die Spinnen tanzen auf ihm, tragen ihn in einen Strauch und weiter, hinaus auf die Felder, die ich von meinem Platz aus nicht sehe, von denen ich nur weiß. Hier durchschneidet „meine" Straße noch den Weinberg, befinden sich links und rechts Keller, die die Bauern in ihn hineingebaut haben, als Vorratsräume, nicht unbedingt nur für Rebensaft, auch Kartoffeln und rote Rüben und Obst lagerten und lagern sie hier. Sie sind kaum breiter
als das Tor, das von ihnen zu sehen ist. Ihre Mauern verbirgt der Berg. Ich bleibe stehen und schaue zurück, kann mich nicht sattsehen an dieser mir ungewohnten Harmonie zwischen Gebäuden und Natur.
Im Gegensatz zu den Kastanienbäumen, die keine Früchte tragen, sind die Hollersträuche voll mit reifen Beeren, manche fallen von selbst ab, färben die Pflastersteine schwarzblau. Niemand pflückt den Holler. Kein Vogel ist zu sehen.
Manche Keller werden heute nicht mehr benützt. In einem von ihnen, der bereits Verfallserscheinungen zeigt und der am Nachmittag von der Sonne beschienen ist, haben drei Menschen, ich weiß es, den Faschismus überlebt. Es kann nicht anders sein, einer dieser Keller muß Menschen beherbergt haben, ein Mensch aus dem nahegelegenen Stammersdorf muß für diese Versteckten gesorgt haben... Wie oft wagten es diese Versteckten, auf die Straße zu gehen? Hielt jemand Wache, damit sie einmal in der Sonne sein konnten, fünf Minuten in der Sonne sein? In diesem sanften Licht der Straße, inmitten der langen Schatten,
selbst einen Schatten werfen, einen ganz anderen als in dem künstlichen Licht im Keller, einen, der nirgendwo anstößt, der die Bäume hinaufklettert und sich mit dem Sand berührt. War „meine" schönste Straße für sie schön oder verfluchten sie sie, die Schutzgebende und doch vor allem mit ihrer Kälte Schutzgebende. Die Kälte im Keller war gut für die Lagerung von Wein, Obst und Gemüse, aber was tat die Kälte mit den Menschen? Und die Nächte, in denen ich die Straße nicht kenne, in denen ich sie mir unheimlich vorstelle, konnten die Versteckten die Nächte nutzen, um sich die Beine zu vertreten, um frische Luft zu
atmen? Im Winter die Spuren im Schnee, wer verwischte ihre Spuren? Oder gab es keine Straße im Winter? Räumte niemand den Schnee weg? Blieben die Tore versperrt? Gab es keine Spaziergänge? Auch nicht im Sommer? War „meine" Straße ohne rettendes Geheimnis?
Links zweigt ein kleiner Weg von ihr ab, hinauf in den Weinberg, sie empfiehlt mir, sie zu verlassen, zum Heurigen zu gehen, der versteckt inmitten von Rebstöcken liegt. Ein kleiner, gemütlicher Heuriger mit einem guten Wein. Der Wirt ist freundlich, er fängt ein Gespräch an, eines, wie
ich es nur von Wiener Wirten und Wirtinnen kenne, über die Arbeitslosen, was sie denn wohl jetzt machen, wie es ihnen gehen mag, erzählt von seiner eigenen Arbeitslosigkeit in den zwanziger Jahren, er jedenfalls habe die alltäglichen Demütigungen nicht ausgehalten und sich in die Straße zurückgezogen. Wir sehen uns an, ja, wir meinen die gleiche. Damals, sagt er, sei die Straße noch viel verwachsener gewesen, niemand habe dort auf ihn hinabsehen können, nur dort habe er sich manchmal wohlfühlen können.
Bei der Rückkehr empfängt mich die Straße erfreut. Ich grüße sie re-
spektvoll, wie es ihr gebührt. Nach einem kurzen Wegstück bemerke ich, daß sie sich etwas verändert hat. Die linken Hügel sind jetzt stellenweise niedriger, der Raum beginnt sich aufzulösen, entsteht wieder, später verliert er sich ganz. Es gibt auch in der Straße einen Heurigen. Er hat, wie ich einer schwarzen Tafel auf der Kellermauer entnehmen kann, nur sonntags geöffnet. Die Keller werden breiter. Vor manchen befindet sich eine selbstgezimmerte Bank, bei einem stehen die beiden Türflügel offen, er ist vollgeräumt mit Säcken und Arbeitsgeräten, ein Kind versucht, darin skizufahren, ständig stößt es irgendwo an. Die Keller, über denen der Hang für eine Terrasse oder einen Wohnraum eingeebnet wurde, mehren sich. Dabei wird es nicht bleiben. Die Straße ist nicht mehr zu sehen, statt dessen eine Autoschlange, Giftgase, Hupgeräusche, endlich verlassen die Autos die Straße, parken inmitten des Weinberges, wenigstens ist von der Straße aus das Gasthaus kaum zu sehen, es genügt das häßliche Werbeschild, das grellbunt in sie hineinragt.
Manchmal kreuzt sich „meine" Straße mit einer anderen ebenso schmalen Straße, die von Stammersdorf zum Bis-amberg führt, aber keine ist so schön wie sie. Dort hingegen, wo sie in die Stadt mündet, in einen Randbezirk -Strebersdorf - und bereits vorher, bereits bei dem Teich, der mit einer grünen Schlammschicht bedeckt ist und heute ganz wenig Wasser hat, wodurch er den Blick freigibt auf all das Gerumpel, das Menschen in ihm zum Verschwinden bringen wollten, wird sie häßlich, von einer nebensächlichen Häßlichkeit. Von der Stadt kommend wird niemand Lust verspüren, sie zu gehen. Wie klug sie ist.
Da sehe ich eine Gruppe Menschen die Erde in Körbe schaufeln, die vol-
len Körbe auf die Weinberge tragen und sie dort ausleeren, mit den leeren Körben kommen sie zurück, füllen sie wieder, noch ist die Straße unge-pflastert, ohne die Vertiefung zur Mitte hin, ziehen Pferde die Lasten, aber wie viele Bauern hier hatten schon Pferde, die anderen versinken im Matsch nach jedem Gewitter, der Matsch ist fruchtbar, die Wasser tragen den Berg ab, mühsame Arbeit, den Berg zu erhalten.
In ihrem mittleren Teil gibt die Straße den Blick frei auf Wien. Gegenüber der Kahlenberg und der Leopoldsberg, wir lachen, dort stellen sich die Wienblicksuchenden um einen guten Aussichtsplatz an, wir hingegen, wir haben den Wienblick ganz allein für uns. können bleiben, solange wir etwas erschauen. Hier sind die Hänge links und rechts der Straße verschwunden, die Weinstök-ke liegen hinter uns, vor uns ziehen sich die herbstlichen Felder - zumeist braun, manche grün, auf einem steht noch immer der Mais - bis zu den Häusern.
Ich setze mich an den Straßenrand, in das letzte zum Trocknen ausgelegte Heu. Es ist nicht mehr weit bis zur Tramway. Ich kenne das Wegstück, das vor mir liegt. Neonröhren statt der Blätter über meinem Kopf, rechts die Villen, links eine große Gstätt'n, zunehmender Autoverkehr, ein umgefallenes Schild, das einst auf den Strebersdorfer Friedhof hinwies, eine Telefonzelle, die Anlagen des Sportzentrums, der Chorgesang von Siegern und Besiegten, dann Häuser, die niedrigen Häuser dieser Gegend, eins ans andere gebaut, zwischen ihnen die Großheurigen, die Busse davor. Wozu diesen Weg gehen, warum nicht bleiben, dort, wo die Straße mit den Hängen und den Ästen eine Einheit bildet, in der auch ich meinen Platz finde, mühelos.
Eine Erzählung aus dem Ende f ebruar erscheinenden Erzählband: LA VALSE. Von Elisabeth Reichart. Otto Müller Verlag, Salzburg 1992. Ca. 200 Seiten, öS 248,-.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!