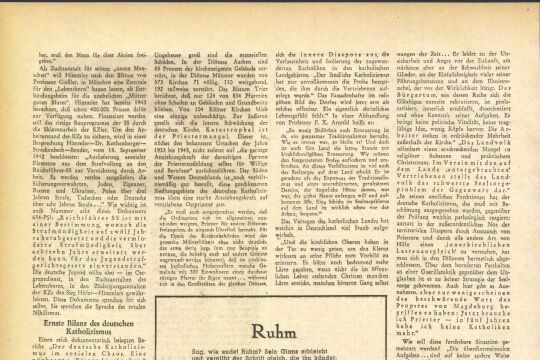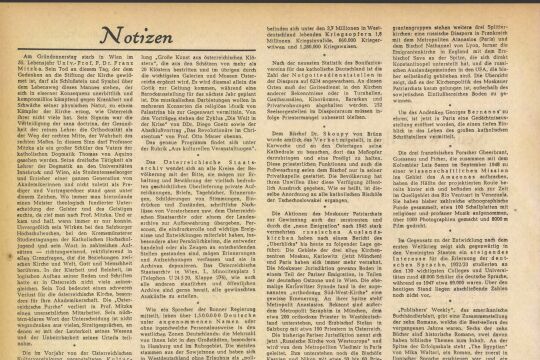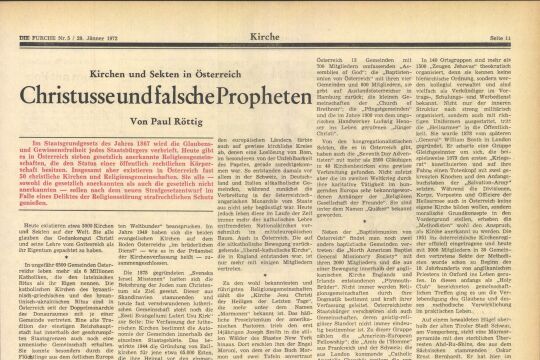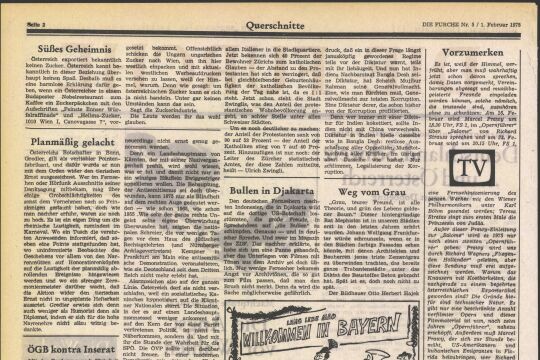Die Ermordung eines katholischen Bischofs in der Türkei verdeutlicht die schwierige Situation der christlichen Kirchen: Sie ringen verzweifelt um ihren Status in Recht und Gesellschaft.
„Das Christentum ist bis heute gewissermaßen ein Fremdkörper in der türkischen Kultur geblieben. Außerdem haben wir als Kirche keinen Rechtsstatus, wir existieren de facto, aber nicht de jure.“ – Es ist Anfang Juni 2008. Brütende Hitze liegt über Iskenderun, einer Bezirksstadt im Südosten der Türkei. Wohl geschützt von dichtem Blätterwerk sitzen einige Journalisten im Innenhof eines kleinen Palais, ein Springbrunnen plätschert gegen die nachmittägliche Trägheit an. Niemand ahnt, dass der Gesprächspartner, der mit bestimmten Worten die Situation der Christen in der Türkei beschreibt, zwei Jahre später Opfer eines Mordes werden wird. Es ist Luigi Padovese, bis zu seinem Tod am 3. Juni Apostolischer Vikar von Anatolien und als Vorsitzender der Türkischen Bischofskonferenz einer der wichtigsten katholischen Repräsentanten in der Türkei.
Lebten auf dem Boden der heutigen Türkei noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund zwei Millionen Christen, so ist ihre Zahl heute auf rund 100.000 zusammengeschmolzen, die Zahl der Katholiken beträgt nur rund 30.000. Ein geregeltes Pfarrleben ist unter diesen Umständen kaum möglich. Schikanen bei Arbeitsbewilligungen für ausländische Geistliche, bei der Restitution von Gebäuden und bei Behördengängen sind weiterhin an der Tagesordnung. „Das Christentum wird hier wie ein Fremdkörper betrachtet“, so Padovese damals, „obwohl das Christentum hier doch tief verwurzelt ist.“
Noch ist das Motiv des Mordes an Bischof Padovese unklar. Doch er lenkt den Blick auf die prekäre Situation der Christen im Land - eine Situation, die differenziert zu betrachten ist, reicht das Spektrum „der Christen“ doch von zum Teil aggressiv-missionarisch auftretenden evangelischen Freikirchen über die um Integration bemühte katholische Kirche bis hin zum auf wenige Tausend Gläubige geschmolzenen Ökumenischen Patriarchat in Istanbul.
Die Rolle des Harlekins unter den Christen in der Türkei spielen zweifellos die evangelischen Freikirchen. Verzeichnen sie auf der einen Seite durch ihre rege, zum Teil aggressive Missionstätigkeit derzeit ein Wachstum, so ist ihr mediales Image bestimmt von lautstarker Ablehnung in der Türkei. Bestens aus dem Ausland organisiert und finanziert, werben sie via Satellitenfernsehen oder auch Bibelverteilaktionen offen um Gläubige – koste es auch nicht selten die Leben der Missionare, wie etwa bei jenem grausamen Mord an drei Mitarbeitern eines christlichen Verlags 2007 in Malatya.
Doch auch hier ist Nüchternheit angesagt: So wurden etwa in den Jahren zwischen 1997 und 2004 laut parlamentarischer Anfrage nur 288 Konversionen zum Christentum vermeldet. Bei einer Gesamtbevölkerung von rund 72 Millionen Einwohnern müsse man das oftmals heraufbeschworene „Gespenst der Christianisierung der Türkei als psychotisch bezeichnen“, so der deutsche Türkei-Experte und „Missio“-Menschenrechtsbeauftrage Otmar Oehring.
Wohl nirgends wird indes das ungelöste Problem der Präsenz des Christentums in der Türkei sichtbarer als in Person des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I.
Schwache Position
Wird er in der Weltöffentlichkeit als wichtigster Repräsentant der Orthodoxie und zugleich als herausragender Intellektueller und Mahner für Frieden, Gerechtigkeit betrachtet, so ist seine Position an seinem Amtssitz in Istanbul, dem Phanar, eine schwache.
Zuletzt sagte er dem US-Sender CBS gar, man fühle sich als Christ in der Türkei „zweitklassig“, ja „gekreuzigt“. Seit dem „morgenländischen Schisma“ von 1054 zwischen den östlich-orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche erfuhr das Patriarchat zunächst eine stetige Aufwertung und rückte an die erste Stelle unter den orthodoxen Kirchen – eine Position, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und den Aussiedelungen von rund zwei Millionen Griechen aus der Türkei eine starke Schwächung erfuhr – und von der sich das Patriarchat bis heute nicht erholt hat. Es ringt bis heute um eine gesicherte Rechtsstellung. Ein leichtes Wachstum verzeichnen die syrischen Christen, die in der Region von Tur Abdin ihr geistliches Zentrum haben. Sie sind lebendiges Mahnmal an jenen dunkelsten Punkt der christlich-muslimischen Geschichte in der Türkei: dem Völkermord an den armenischen Christen 1915 - 1917, dem rund 1,5 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Bis heute zeitigt dieser Konflikt, der sich tief ins kollektive Gedächtnis sowohl der Türkei wie in der verfolgten christlichen Minderheit eingegraben hat, Nachbeben – etwa im Blick auf den Priesternachwuchs, der mangels Ausbildungsstätten für alle christlichen Kirchen ein Problem darstellt. Noch einmal der verstorbene Bischof Luigi Padovese: „Unser Priesternachwuchs stammt gänzlich aus dem europäischen Ausland - Italien, Frankreich, England, Deutschland. Zugleich sind dies die Länder, die in der Türkei als ehemalige Kolonialmächte wahrgenommen werden. Das Christentum wird immer noch als Religion der ehemaligen Kolonialmächte empfunden.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!